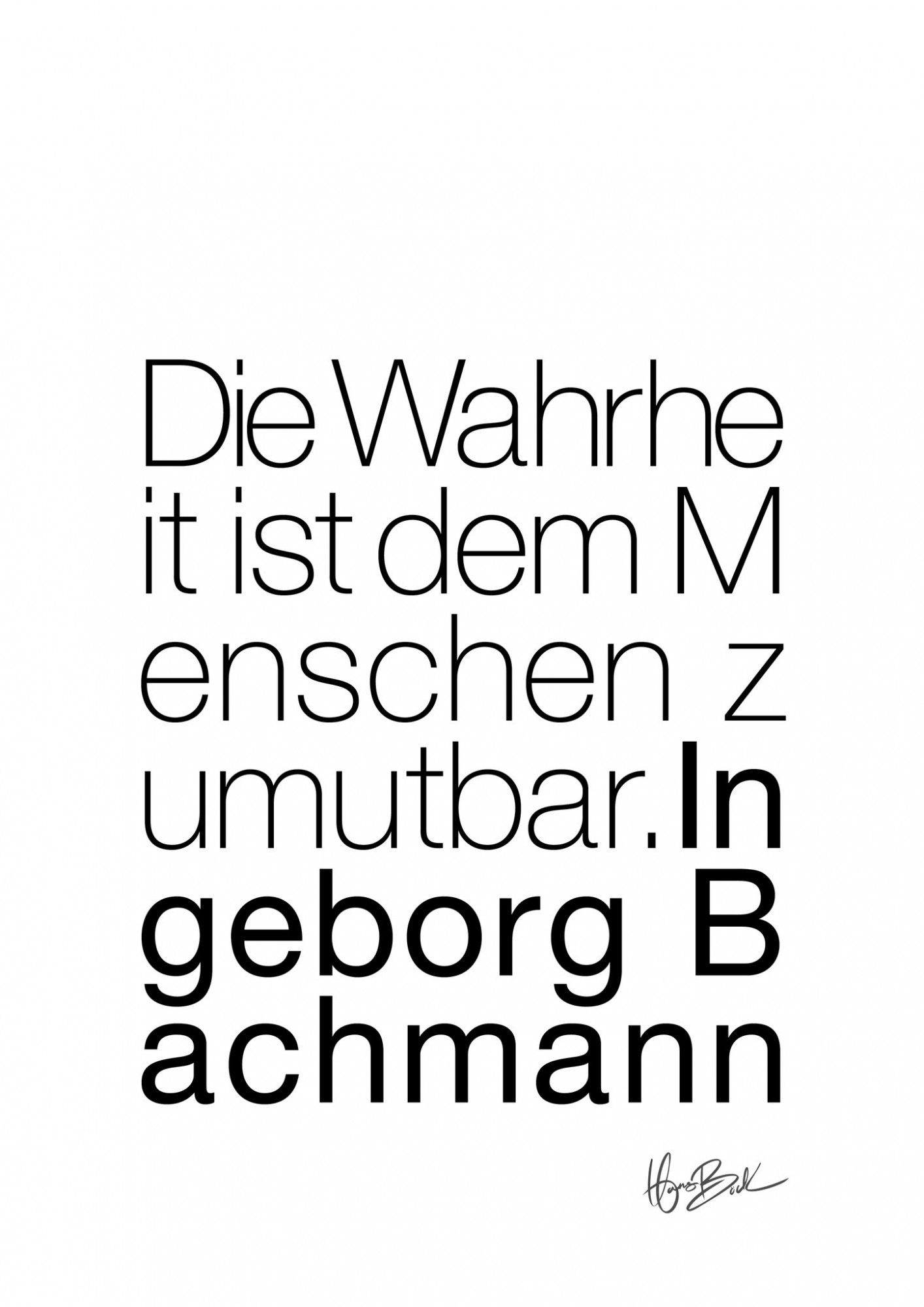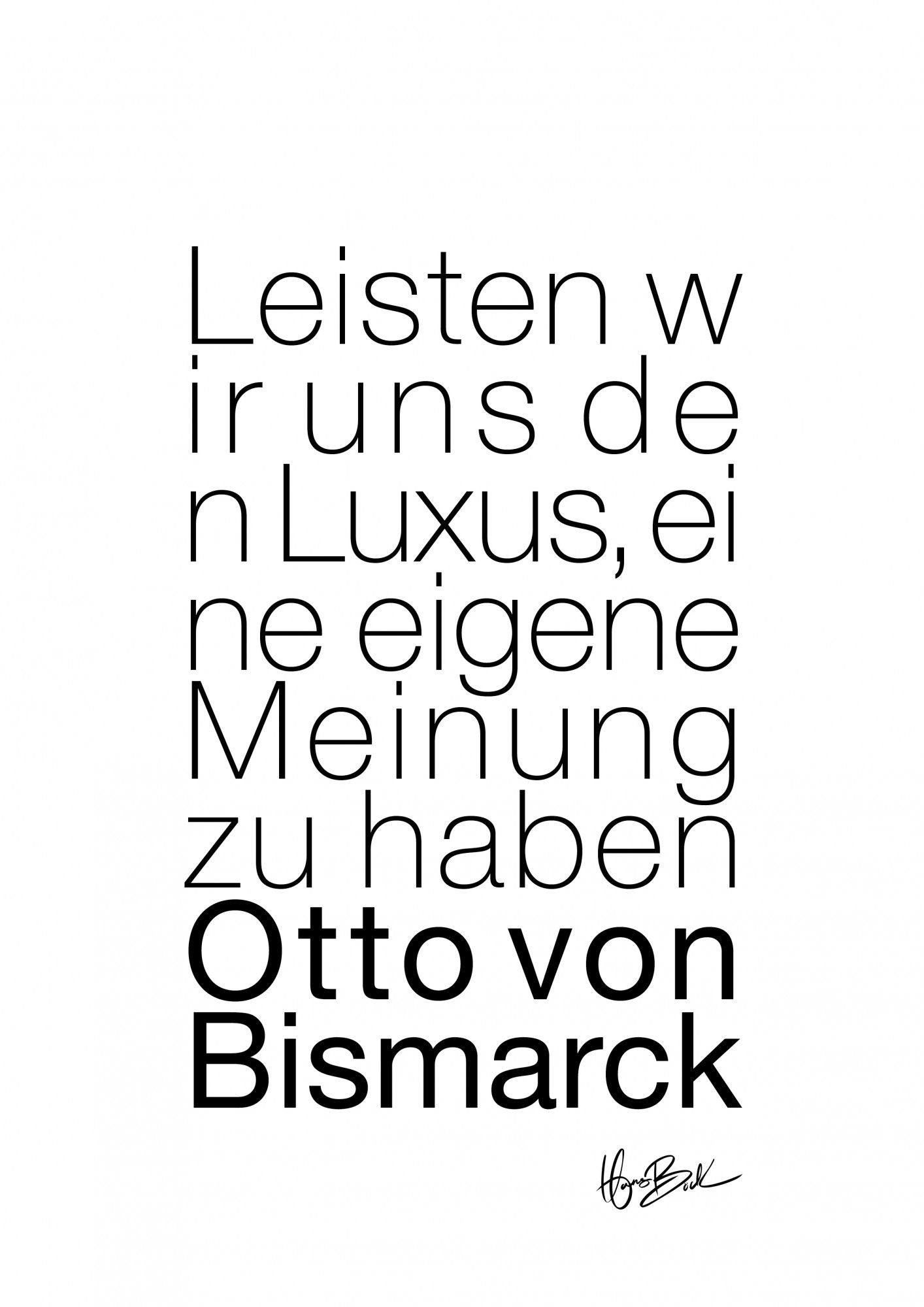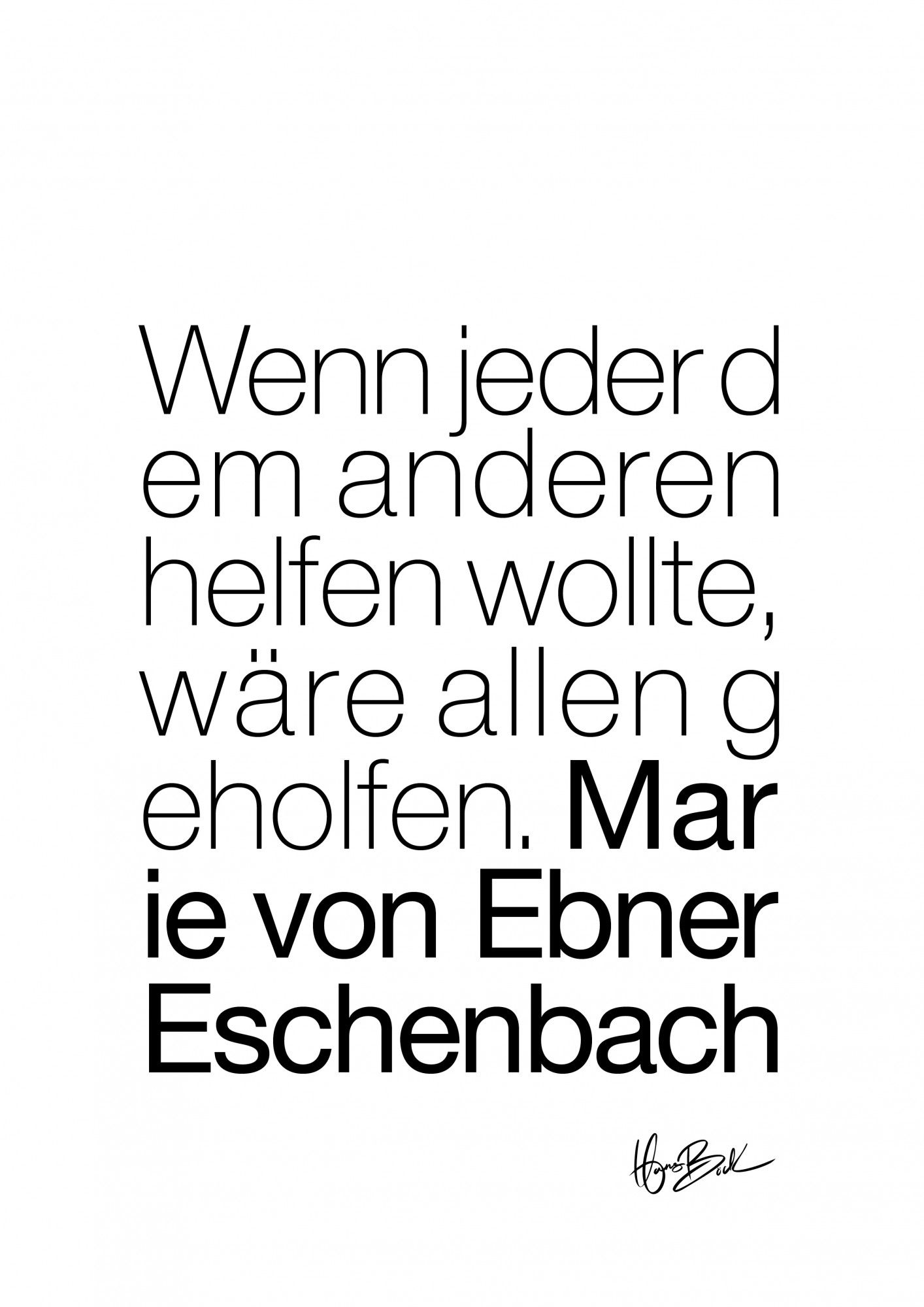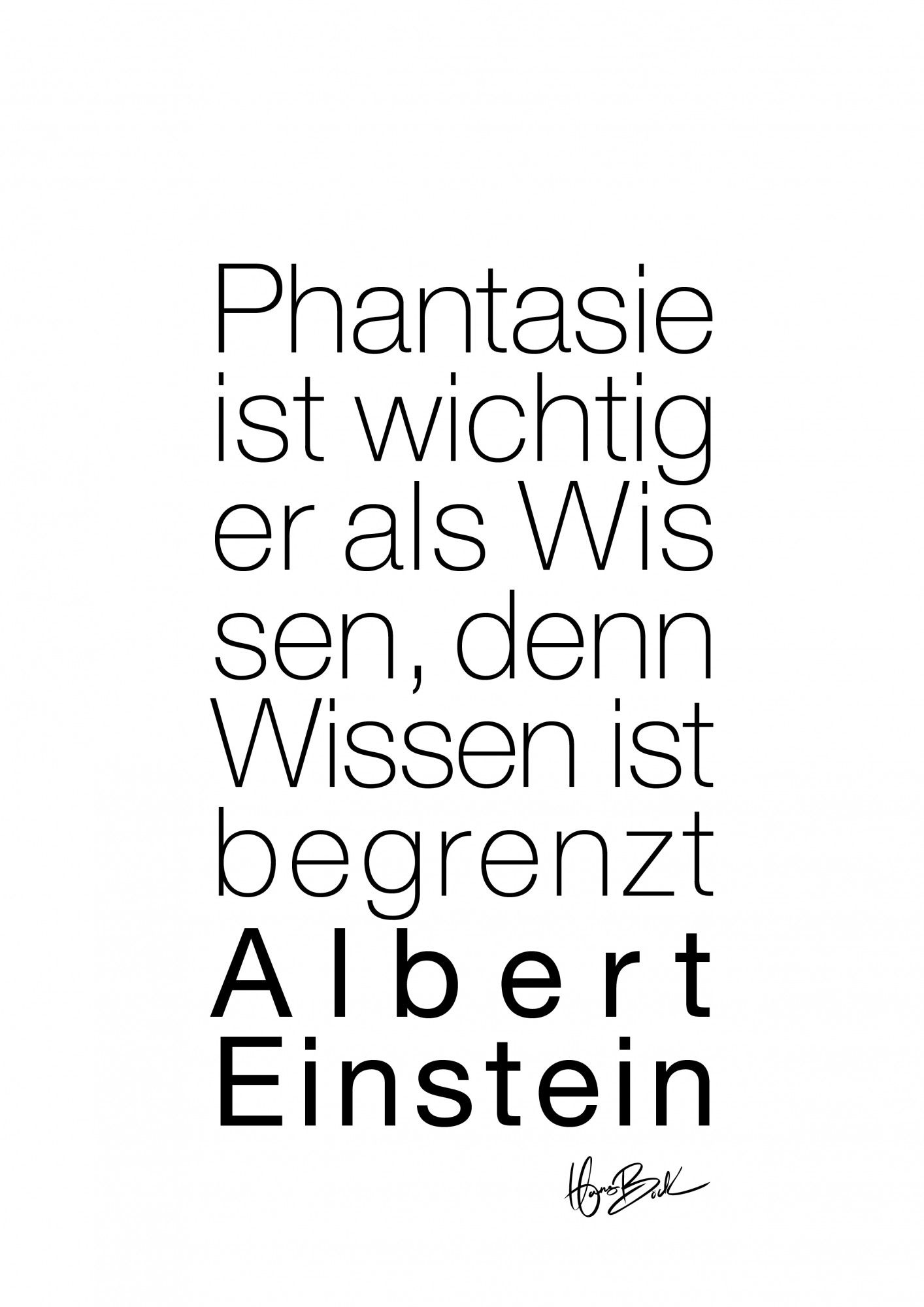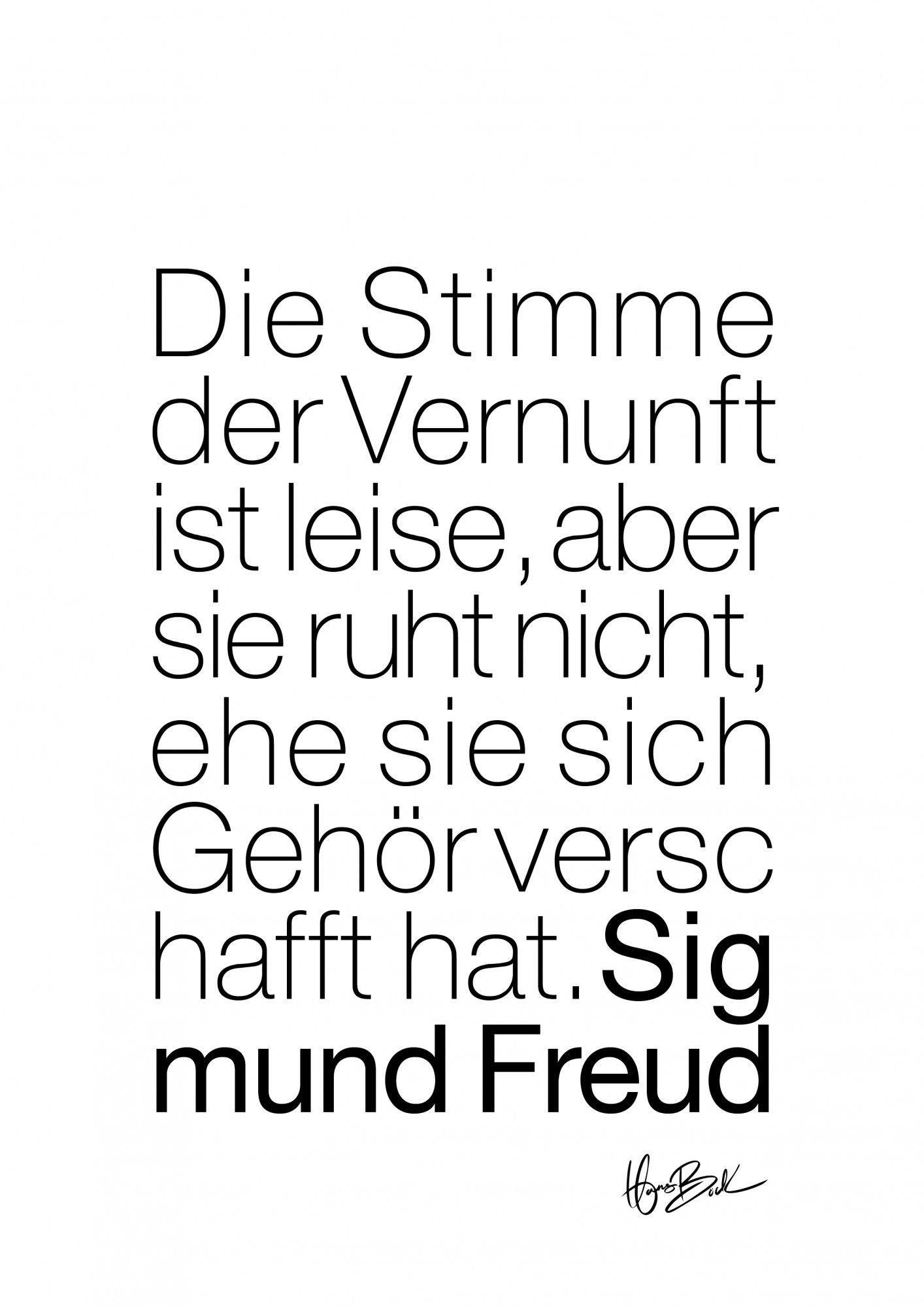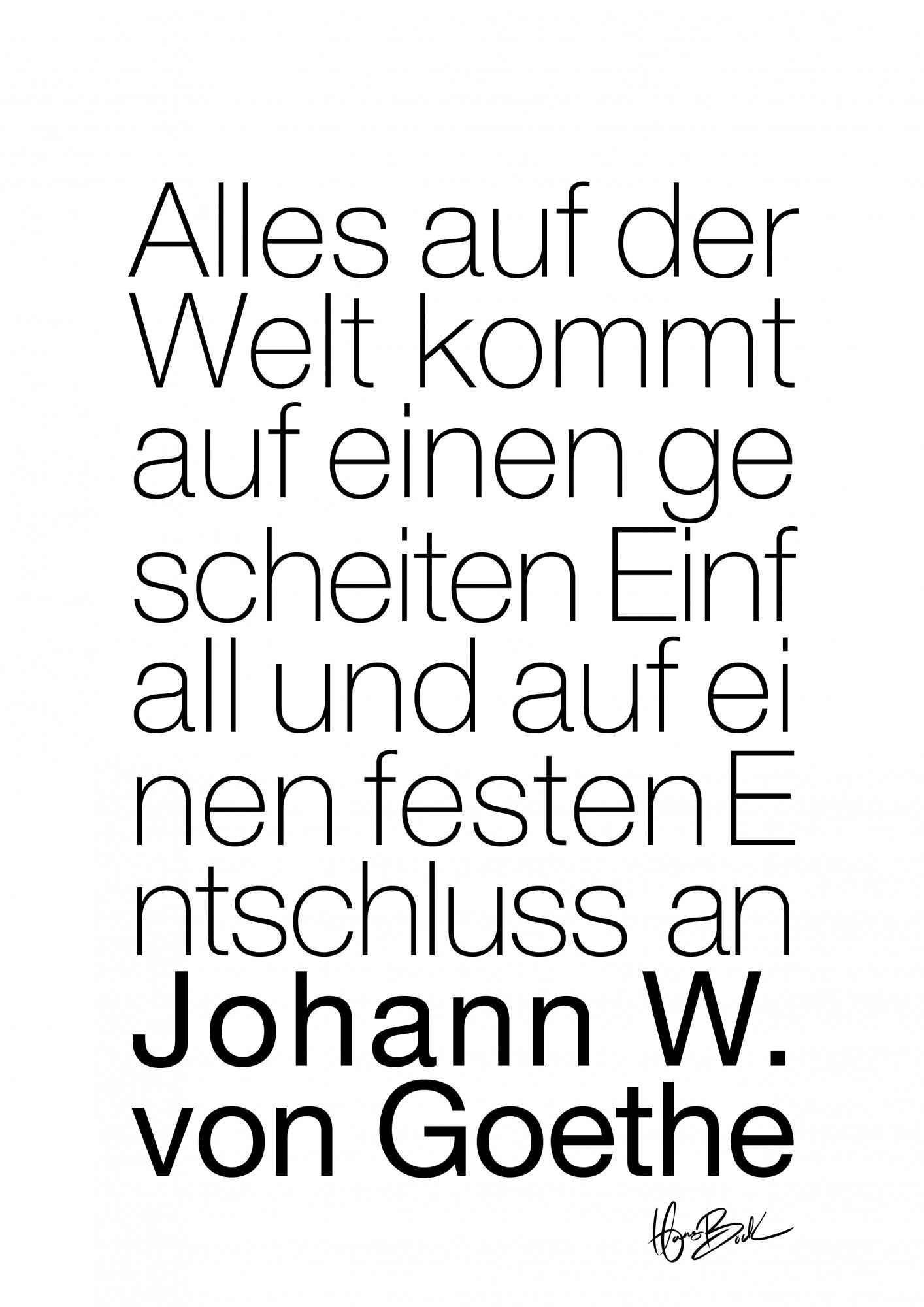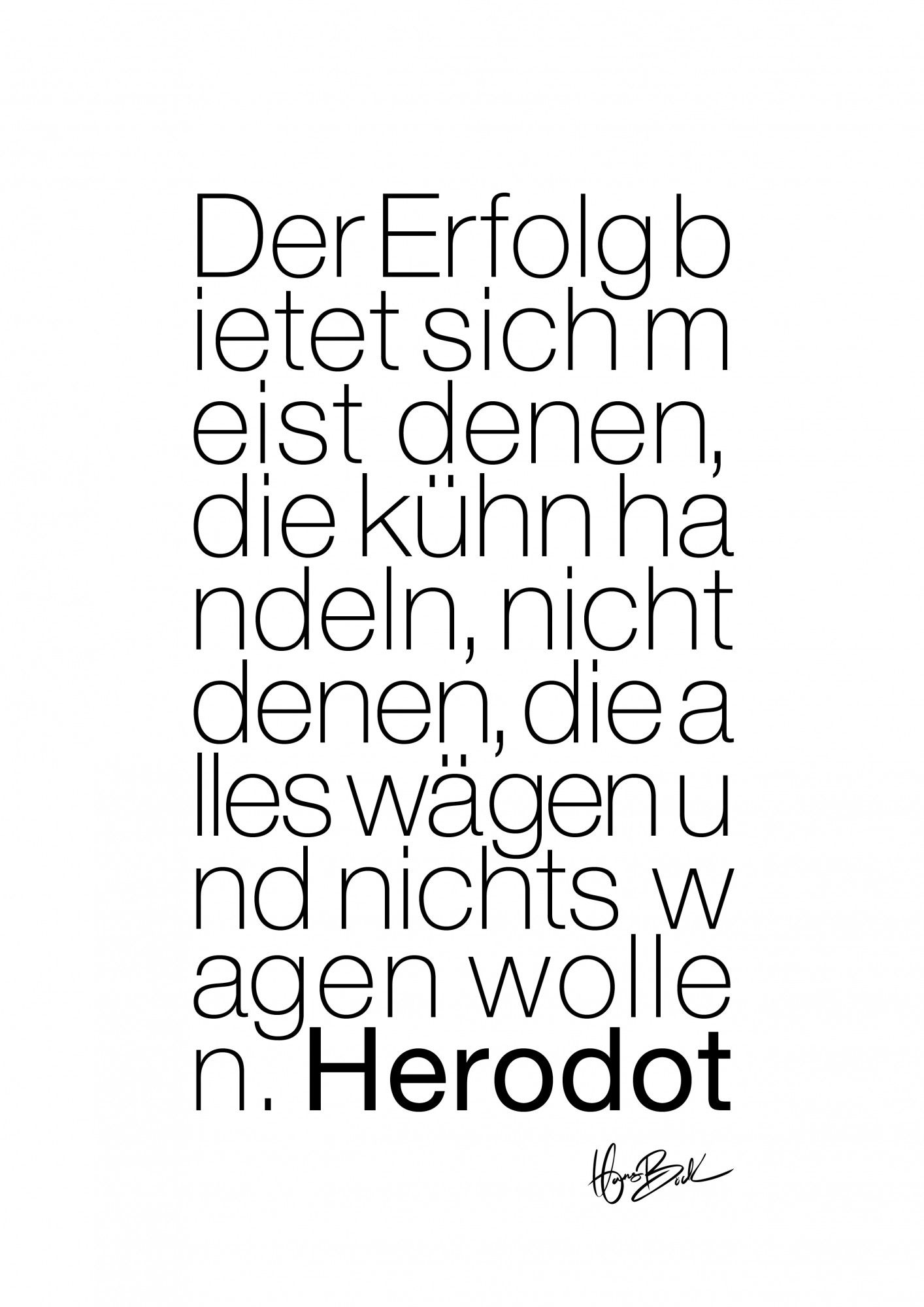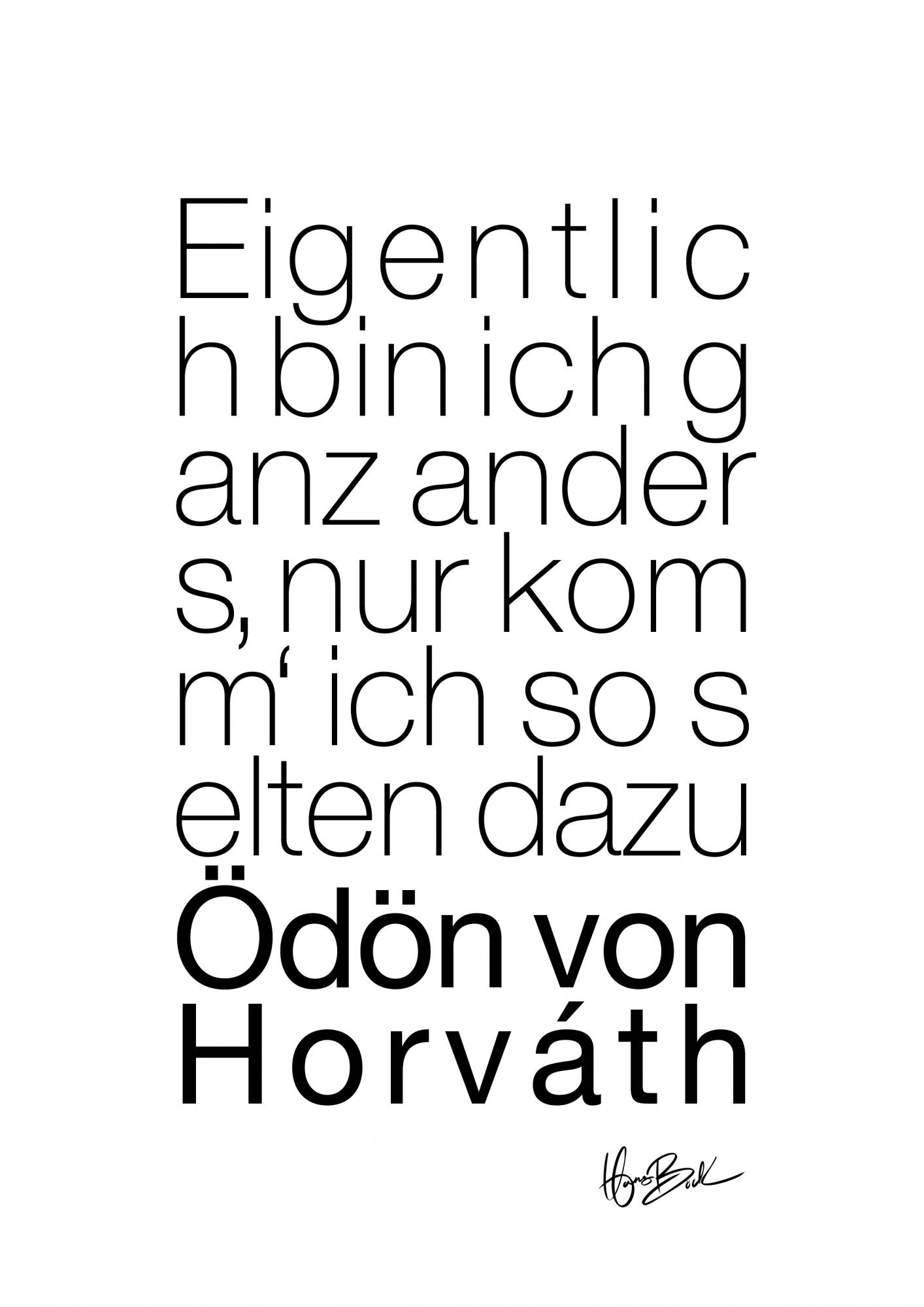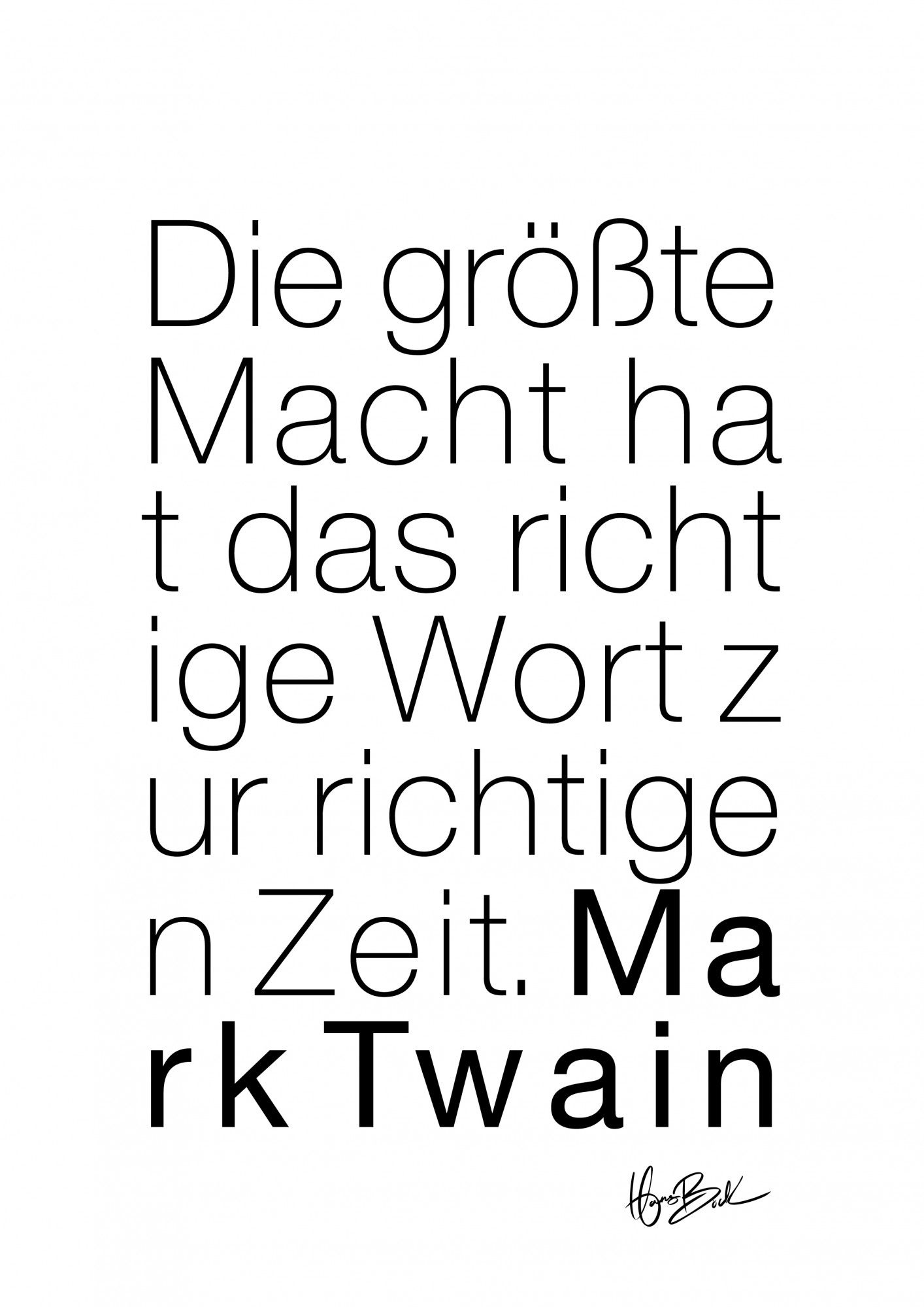Zitate von Joachim Gauck
Der Tag der Deutschen Einheit. Das ist für unser Land seit 25 Jahren ein Datum der starken Erinnerungen, ein Anlass für dankbaren Rückblick auf mutige Menschen. Auf Menschen, deren Freiheitswille Diktaturen ins Wanken brachte, in Danzig, Prag und Budapest. Auf Menschen auch in Leipzig, Plauen und so vielen anderen Orten der DDR, die mit der Friedlichen Revolution die Vereinigung beider deutscher Staaten überhaupt erst vorstellbar werden ließen. Ich begrüße mit besonderer Freude diejenigen unter uns, die damals dabei waren. Wir wären heute nicht hier, wenn Sie damals nicht aufgestanden wären! // Am 3. Oktober denken viele von uns an den Klang der Freiheitsglocke, an die Freudentränen nicht nur vor dem Reichstag, an die Aufbruchsstimmung, die uns beherrschte, ja: an großes Glück. // Aber in diesem Jahr ist doch manches anders. So mancher fragt: Warum zurückblicken? Hat die Bundesrepublik momentan nicht drängendere Probleme, drängendere Themen als dieses Jubiläum? Was können wir feiern in einer Zeit, in der hunderttausende Männer, Frauen und Kinder bei uns Zuflucht suchen? Einer Zeit, in der wir vor so immensen Aufgaben für unsere Gesellschaft stehen? // Meine Antwort darauf lautet, ganz einfach: Es gibt etwas zu feiern. Die Einheit ist aus der Friedlichen Revolution erwachsen. Damit haben die Ostdeutschen den Westdeutschen und der ganzen Nation ein großes Geschenk gemacht. Sie hatten ihre Ängste überwunden und in einer kraftvollen Volksbewegung ihre Unterdrücker besiegt. Sie hatten Freiheit errungen. Das erste Mal in der deutschen Nationalgeschichte war das Aufbegehren der Unterdrückten wirklich von Erfolg gekrönt. Die Friedliche Revolution zeigt: Wir Deutsche können Freiheit. // Und so feiern wir heute den Mut und das Selbstvertrauen von damals. Nutzen wir diese Erinnerung als Brücke. Sie verbindet uns mit einem Erfahrungsschatz, der uns gerade jetzt bestärken kann. Innere Einheit, so machen wir uns klar, innere Einheit entsteht, wo wir sie wirklich wollen und uns dann ganz bewusst darum bemühen. Innere Einheit entsteht, wenn wir uns auf das Machbare konzentrieren, statt uns von Zweifeln oder Phantastereien treiben zu lassen. Und innere Einheit lebt davon, dass wir im Gespräch darüber bleiben, was uns verbindet und was uns verbinden soll. // Auch 1990 gab es die berechtigte Frage: Sind wir der Herausforderung gewachsen? Auch damals gab es - wir haben es schon gehört - kein historisches Vorbild, an dem wir uns orientieren konnten. Und trotzdem haben Millionen Menschen die große nationale Aufgabe der Vereinigung angenommen und Deutschland zu einem Land gemacht, das mehr wurde als die Summe seiner Teile. // Für mich steht die positive Bilanz im 25. Jahr der Deutschen Einheit außer Frage. Auch wenn es zuweilen Enttäuschungen gab, wenn Wirtschaftskraft und Löhne nicht so schnell gewachsen sind, wie die meisten Menschen in Ostdeutschland hofften, und wenn die finanzielle Förderung länger währt, als die meisten Westdeutschen wünschen, so ist doch gewiss: Die große Mehrheit der Deutschen, gleichgültig woher sie stammen, fühlt sich in diesem vereinten Land angekommen und zuhause. Die Unterschiede sind kleiner geworden und besonders in der jungen Generation, da sind sie doch eigentlich gänzlich verschwunden. Deutschland hat in Freiheit zur Einheit gefunden - politisch, gesellschaftlich, langsamer auch wirtschaftlich und mit verständlicher Verzögerung auch mental. // Es ist wieder zusammengewachsen, was zusammengehörte - Willy Brandt hat Recht behalten. Allerdings war der Prozess der Vereinigung deutlich schwieriger, als die meisten in der Euphorie vor 1989/90 glaubten. Beide Seiten hatten sich ihre Eindrücke vom "Drüben" ja lange nur aus der Ferne gemacht. Als wir einander schließlich direkt in Augenschein nehmen konnten, da waren viele Menschen überrascht, einige auch erschrocken. "Alles marode", sagten die einen. "Alles Show", fanden die anderen. // Eins stimmt natürlich: Noch hat der Osten das wirtschaftliche Niveau des Westens nicht erreicht. Gleichwohl, das Bild vom maroden Osten ist inzwischen Vergangenheit. Der äußere Wandel ist überdeutlich in Vorher-Nachher-Bildern darstellbar: hunderttausende von Eigenheimen, sanierte Straßen, Dörfer, Städte, gerettete Baudenkmäler und Kulturstätten, saubere Flüsse und Seen. All die runderneuerten Landstriche, sie geben Anlass zur Freude. Sie sind Zeugnisse einer großen gemeinsamen Anstrengung und Belege dafür, dass auch die Westdeutschen die Einheit als gesamtdeutsche Aufgabe angenommen haben, zeigten sie sich doch von Anfang an solidarisch mit jenen, von denen sie über Jahrzehnte getrennt worden waren. // Ich kann und will dies am heutigen Festtag nicht für selbstverständlich nehmen, sondern ich will es würdigen, ausdrücklich und dankbar. // In diesem Zusammenhang sollten wir uns außerdem bewusst machen, dass auch die Westdeutschen den Ostdeutschen ein Geschenk gemacht haben: mit dem Grundgesetz, das die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Grundrechte sichert, mit einer funktionierenden Demokratie, einer unabhängigen Justiz und einem sozialen System, das die Schwachen auffängt. // Allerdings hat die Einheit den meisten Westdeutschen im täglichen Leben wenig abverlangt, den Ostdeutschen dagegen mit einem enormen Transformationsdruck sehr viel. Das neue Leben im Osten brachte ja nicht nur volle Einkaufsregale, schnelle Autos und bunte Reisekataloge. Es brachte auch die massenhafte "Abwicklung" sogenannter volkseigener Betriebe, brachte damit Massenarbeitslosigkeit und Massenabwanderung. Leere Werksgelände, leere Plattenbauten, leere Schulklassen - all das hinterließ seelische Spuren. Selbst für die Jüngsten von damals, die sich heute als "Wendekinder" bezeichnen, sind dies prägende Erinnerungen, sie sind in ihrem Gedächtnis geblieben. // Für 16 Millionen Menschen änderte sich in kürzester Zeit fast alles. Aber manches - gemessen an den großen Hoffnungen - eben nicht schnell genug. Erst allmählich wurde klar, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse und Mentalitäten in Ost und West eine Aufgabe, ein Prozess von Generationen - ja: Plural! - sein würde. // Schmerzlich mussten wir im Osten erfahren, dass wir Demokratie 1989/90 zwar über Nacht erkämpfen, nicht aber über Nacht auch erlernen konnten. Gestern Untertan, heute Citoyen: was für ein Irrtum! Ohnmacht hatte sich in vielen Köpfen eingenistet. Ohnmacht nach Jahrzehnten totalitärer Diktatur, in denen die Grundrechte der Menschen beschnitten und das eigenverantwortliche Tun gelähmt war, in denen freie Wahlen ein ferner Traum bleiben mussten. So erklärt sich die wohl größte Herausforderung der Ostdeutschen im vereinten Land. Es galt, jahrzehntelange Selbstentfremdung zu überwinden, möglichst im Zeitraffer. Es galt, genau das zu tun, was vorher alles andere als erwünscht war: selbständig zu denken, selbständig zu handeln. Von Freiheit nicht nur zu träumen, sondern Freiheit in der Freiheit tatsächlich zu gestalten. // Trotz aller Schwierigkeiten: Millionen Ostdeutsche haben den persönlichen Neuanfang gewagt und bewältigt, unter neuen Prämissen, in neuen Berufen oder an neuen Orten. Millionen haben die Brüche ihrer Biographien in Zukunft verwandeln können, haben Unternehmen gegründet und Verwaltungen demokratisiert, haben an Universitäten die freie Lehre und Forschung eingeführt, haben Vereine ins Leben gerufen, wo sich vorher der Staat für zuständig hielt. Millionen Menschen haben sich der fundamentalen Einsicht geöffnet: Neue Freiheit bietet neue Möglichkeiten, aber sie verlangt eben gleichzeitig die Übernahme neuer Verantwortung, auch Selbstverantwortung. Besonders diese Veränderungsleistung der Ostdeutschen war enorm. Sie wirkt bis heute nach. // Und genau an dieser Stelle möchte ich einmal Dank sagen all denen, die angepackt haben, die das gemacht haben, was sie vorher nie gelernt hatten: als ehren- oder hauptamtlicher Bürgermeister, als Abgeordneter, als Sekretär einer freien Gewerkschaft, als Verantwortlicher einer demokratischen Partei, als Minister, als Ministerpräsident, gar als Bundeskanzlerin - sie alle hatten niemals erwartet, zu tun, was sie dann taten. Wir schauen heute einmal auf sie alle - und sagen einfach "Danke". // Zu denen, die ich eben aufgezählt habe, gehört auch mancher unserer Gäste. Ich sehe in der dritten Reihe jemanden aus der polnischen Nachbarschaft, Bogdan Borusewicz, heute Senatspräsident der Republik Polen. Damals aber, in der Zeit, über die ich eben gesprochen habe, als wir alle ganz woanders waren, da war er ein unbekannter Mann aus der Mitte des Volkes, der mutiger und früher angefangen hat als wir und der uns zusammen mit seinen Landsleuten motiviert hat, auch etwas zu wagen. Danke! // Meine Damen und Herren, die innere Einheit Deutschlands konnte vor allem wachsen, weil wir uns als zusammengehörig empfanden und weil wir in Respekt vor denselben politischen Werten gemeinsam leben wollten. Doch nun, da viele Flüchtlinge angesichts von Kriegen, von autoritären Regimen und zerfallenden Staaten nach Europa, nach Deutschland getrieben werden, nun stellt sich doch die Aufgabe der inneren Einheit neu. Wir spüren: Wir müssen Zusammenhalt wahren zwischen denen, die hier sind, aber auch Zusammenhalt herstellen mit denen, die hinzukommen. Es gilt, wiederum und neu, die innere Einheit zu erringen. // Diese Entwicklung hat vor 25 Jahren niemand ahnen können. Damals, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime und dem Ende des Ost-West-Konflikts, sahen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Wir wähnten uns sogar am Beginn einer neuen Epoche. Die Überlegenheit der Demokratie schien schlagend bewiesen, ihr weltweiter Siegeszug nur noch eine Frage der Zeit. Wir erinnern uns an Francis Fukuyama, den amerikanischen Politologen, der das "Ende der Geschichte" verkündete. Mit ihm glaubten viele - auch ich - an eine gerechtere, friedliche und demokratische Zukunft. // Die Hoffnung auf eine solche Veränderung weltweit, sie ist jedoch zerstoben. Statt weiterer Siege von Freiheit und Demokratie erleben wir vielerorts das Vordringen autoritärer Regime und islamistischer Fundamentalisten. Statt mit größerer Friedfertigkeit sind wir konfrontiert mit Terrorismus, mit Bürgerkriegen, imperialen Landnahmen und einer Renaissance von Geopolitik. Und die Gemeinschaft der Europäer, die vor 25 Jahren begann, Ost- und Westeuropa zusammenzuführen, sie findet sich nun mit der Euro-Rettung, auch hier und da mit Austrittsdiskussionen und vor allem mit der Bewältigung der Fluchtbewegungen mitten in einer Zerreißprobe. // Aber was heißt es nun, die innere Einheit wieder und neu zu erringen, wenn sich die Zusammensetzung der Bevölkerungen in kurzer Zeit so erheblich verändert? Wie schaffen es Staaten, wie schaffen es Gesellschaften, ein inneres Band zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen herzustellen? Und wie kann die Europäische Union Einvernehmen erreichen, wenn die Haltungen gegenüber Flüchtlingen noch so unterschiedlich sind? // Noch führt der Druck die europäischen Staaten nicht völlig zusammen. Allerdings zeigen die jüngsten Entscheidungen der Europäischen Union, dass die Einsicht wächst: Es kann keine Lösung in der Flüchtlingsfrage geben - es sei denn, sie ist europäisch. Wir werden den Zustrom von Flüchtlingen nicht verringern können - es sein denn, wir erhöhen unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Unterstützung von Flüchtlingen in den Krisenregionen, sowie vor allem zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Und auch das müssen wir uns klar machen: Wir werden unsere heutige Offenheit nicht erhalten können - es sei denn, wir entschließen uns alle gemeinsam zu einer besseren Sicherung der europäischen Außengrenzen. // Die Gewissheit über diese gemeinsamen Aufgaben hebt jedoch die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten nicht automatisch auf. In den aktuellen Debatten offenbaren sich unterschiedliche Haltungen aufgrund unterschiedlicher historischer Erfahrungen. Wir erleben das ja schon bei uns, im wiedervereinigten Land, der Bundesrepublik Deutschland. Westdeutschland konnte sich über mehrere Jahrzehnte daran gewöhnen, ein Einwanderungsland zu werden - und das war mühsam genug: ein Land mit Gastarbeitern, die später Einwanderer wurden, mit politischen Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen und Spätaussiedlern. Für die Menschen im Osten war es doch ganz anders. Viele von ihnen hatten bis 1990 kaum Berührung mit Zuwanderern. Wir haben erlebt: Die Veränderung von Haltungen gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderern kann immer nur das Ergebnis von langwierigen - auch konfliktreichen - Lernprozessen sein. Diese Einsicht sollte uns nun auch Respekt vor den Erfahrungen anderer Nationen ermöglichen. // Wenn wir Deutsche uns an die "Das Boot ist voll"-Debatten vor zwanzig Jahren erinnern, dann erkennen wir, wie stark sich das Denken der meisten Bürger in diesem Land inzwischen verändert hat. Der Empfang der Flüchtlinge im Sommer dieses Jahres war und ist ein starkes Signal gegen Fremdenfeindlichkeit, Ressentiments, Hassreden und Gewalt. Und was mich besonders freut: Ein ist ein ganz neues, ganz wunderbares Netzwerk entstanden - zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Es haben sich auch jene engagiert, die selbst einmal fremd in Deutschland waren oder aus Einwandererfamilien stammen. Auf Kommunal-, Landes- wie Bundesebene wurde und wird Außerordentliches geleistet. Darauf kann dieses Land zu Recht stolz sein und sich freuen. Und ich sage heute: Danke Deutschland! // Und dennoch spürt wohl fast jeder, wie sich in diese Freude Sorge einschleicht, wie das menschliche Bedürfnis, Bedrängten zu helfen, von der Angst vor der Größe der Aufgabe begleitet wird. Das ist unser Dilemma: Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich. // Tatsache ist: Wir tun viel, sehr viel, um die augenblickliche Notlage zu überwinden. Aber wir werden weiter darüber diskutieren müssen: Was wird in Zukunft? Wie wollen wir den Zuzug von Flüchtlingen, wie weitere Formen der Einwanderung steuern - nächstes Jahr, in zwei, drei, in zehn Jahren? Wie wollen wir die Integration von Neuankömmlingen in unsere Gesellschaft verbessern? // Wie 1990 erwartet uns alle eine Herausforderung, die Generationen beschäftigen wird. Doch anders als damals soll nun zusammenwachsen, was bisher nicht zusammengehörte. Ost- und Westdeutsche hatten ja dieselbe Sprache, blickten auf dieselbe Kultur zurück, auf dieselbe Geschichte. Ost- und Westdeutsche standen selbst in Zeiten der Mauer durch Kirchengemeinden, Verwandte oder Freunde in direktem Kontakt miteinander und wussten über die Medien voneinander Bescheid. Wie viel größere Distanzen dagegen sind zu überwinden in einem Land, das zu einem Einwanderungsland geworden ist. Zu diesem Land gehören heute Menschen verschiedener Herkunftsländer, Religionen, Hautfarben, Kulturen - Menschen, die vor Jahrzehnten eingewandert sind, und zunehmend auch jene, die augenblicklich und in Zukunft kommen, hier leben wollen und hier eine Bleibeperspektive haben. // Ähnlich wie bei den Zuwanderern seit den 1960er Jahren, aber wohl in größerem Ausmaß werden wir erleben: Es braucht Zeit, bis Einheimische sich an ein Land gewöhnen, in dem Vertrautes zuweilen verloren geht. Es braucht Zeit, bis Neuankömmlinge sich an eine Gesellschaftsordnung gewöhnen, die sie nicht selten in Konflikt mit ihren traditionellen Normen bringt. Und es braucht Zeit, bis alte und neue Bürger Verantwortung in einem Staat übernehmen, den alle gemeinsam als ihren Staat begreifen. // Wir befinden uns aktuell in einem großen Verständigungsprozess über das Ziel und das Ausmaß dieser neuen Integrationsaufgabe. So etwas ist in Demokratien auch verbunden mit Kontroversen - das ist normal. Aber meine dringende Bitte an alle, die mitdebattieren, ist: Lassen Sie aus Kontroversen keine Feindschaften entstehen. Jeder soll merken, wir debattieren, weil es uns um Zusammenhalt geht, um ein Miteinander, auch in der Zukunft. // Und wir nehmen aus unserer jüngeren Geschichte etwas mit, das wir niemals aufgeben dürfen: den Geist der Zuversicht. Wir haben nicht nur davon geträumt, unser Leben selbstbestimmt gestalten zu können, nein, wir haben es getan! Wir sind die, die sich etwas zutrauen. // Und so gestimmt fragen wir uns jetzt: Was ist denn das innere Band, das ein Einwanderungsland zusammenhält? Was ist es, das uns verbindet und verbinden soll? // In einer offenen Gesellschaft kommt es nicht darauf an, ob diese Gesellschaft ethnisch homogen ist, sondern ob sie eine gemeinsame Wertegrundlage hat. Es kommt nicht darauf an, woher jemand stammt, sondern wohin er gehen will und mit welcher politischen Ordnung er sich identifiziert. // Gerade weil in Deutschland unterschiedliche Kulturen, Religionen und Lebensstile zuhause sind, gerade weil Deutschland immer mehr ein Land der Verschiedenen wird, braucht es eine Rückbindung aller an unumstößliche Werte - einen Kodex, der allgemein als gültig akzeptiert wird. // Ich erinnere mich noch gut, welche Ausstrahlung die westlichen Werte bei uns in der DDR und in anderen Staaten des ehemaligen Sowjetblocks besaßen. Wir sehnten uns nach Freiheit und Menschenrechten, nach Rechtsstaat und Demokratie. Diese Werte, obwohl im Westen entstanden, sind zur Hoffnung für Unterdrückte und Benachteiligte auf allen Kontinenten geworden. Die Demokratie hat zwar seit 1990 keinen weltweiten Siegeszug angetreten, aber ihre Werte sind weltweit präsent, werden zunehmend nicht mehr als westlich, sondern als universell bezeichnet und verstanden. Und das ist richtig so. // Doch nicht immer und nicht überall vermögen sie jeden zu überzeugen, übrigens auch nicht bei uns. Wir wissen, dass selbst im Westen die eigenen Werte verletzt wurden und gelegentlich auch werden. Aber damit sind doch nicht die Werte diskreditiert, sondern diejenigen, die sie verraten. // Und diese, unsere Werte, sie stehen nicht zur Disposition! Sie sind es, die uns verbinden und verbinden sollen, hier in unserem Land. Hier ist die Würde des Menschen unantastbar. Hier hindern religiöse Bindungen und Prägungen die Menschen nicht daran, die Gesetze des säkularen Staates zu befolgen. Hier werden Errungenschaften wie die Gleichberechtigung der Frau oder homosexueller Menschen nicht in Frage gestellt und die unveräußerlichen Rechte des Individuums nicht durch Kollektivnormen eingeschränkt - nicht der Familie, nicht der Volksgruppe, nicht der Religionsgemeinschaft. Und vor diesem Hintergrund gewinnt der Satz, den wir alle kennen - Toleranz für Intoleranz darf es nicht geben - seine humane Basis. Und noch etwas: Es gibt in unserem Land politische Grundentscheidungen, neben den eben angesprochenen, die ebenfalls unumstößlich sind. Dazu zählt unsere entschiedene Absage an jede Form von Antisemitismus und unser Bekenntnis zum Existenzrecht von Israel. // Wir kennen keine andere Gesellschaftsordnung, die dem Individuum so viel Freiheit, so viele Entfaltungsmöglichkeiten, so viele Rechte einräumt wie die Demokratie. Sie mag mangelhaft sein, aber wir kennen keine andere Gesellschaftsordnung, die im Widerstreit von Lebensstilen, Meinungen und Interessen zu so weitgehender Selbstkorrektur fähig ist. Wir kennen auch keine Gesellschaftsordnung, die sich so schnell neuen Bedingungen anzupassen und zu reformieren vermag, weil sie - wie Karl Popper einmal sagte - auf einen Menschen baut, "dem mehr daran liegt zu lernen, als recht zu behalten". // Für eben diese Werte und für diese Gesellschaftsordnung steht die Bundesrepublik Deutschland. Dafür wollen wir auch unter den Neuankömmlingen werben - nicht selbstgefällig, aber selbstbewusst, weil wir überzeugt sind: Dieses Verständnis, kodifiziert im Grundgesetz, ist und bleibt die beste Voraussetzung für das Leben, nach dem gerade auch Menschen auf der Flucht streben. Ein Leben - wie es in unserer Nationalhymne heißt - in Einigkeit und Recht und Freiheit.
Informationen über Joachim Gauck
11. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland vom 18.3.2012 - 19.3.2017, Theologe, evangelisch-lutherischer Pastor, Bürgerrechtler, Volkskammerabgeordneter für "Bündnis 90", Bundesbeauftragter für die STASI-Unterlagen der Ex-DDR (Deutschland, 1940).
Joachim Gauck · Geburtsdatum
Joachim Gauck ist heute 84 Jahre, 6 Monate, 3 Tage oder 30.866 Tage jung.
Geboren am 24.01.1940 in Rostock
Sternzeichen: ♒ Wassermann
Unbekannt
Weitere 48 Zitate von Joachim Gauck
-
"Alles bleibt in Bewegung." Diesen Satz habe ich in der Ankündigung zum diesjährigen Zeitungskongress gefunden und dachte mir: Ach, das passt! Besser kann man kaum auf das Thema Transformation der Medienwelt hinweisen. Wenn alles in Bewegung bleibt, dann darf vielleicht auch Ihr Abschlussredner ein wenig weiterdenken und weiterfragen, statt künstlich so etwas wie einen Endpunkt zu setzen. Offen für den Wandel zu sein, das heißt ja auch: Offenheit aushalten, keine fertigen Antworten erzwingen. Und deshalb bin ich dankbar, dass Sie mich eingeladen haben, hier bei Ihnen zu sprechen. // Um im Bild zu bleiben: Zeitungsverleger zu sein, das ist im Jahr 2013 tatsächlich für einige ein ergebnisoffenes Geschäft. Wenn ich ins Programm schaue, dann ahne ich, dass Sie gerade ausführlich eine Reihe von Schwierigkeiten, Problemen diskutiert haben: den scharfen Wettbewerb am Medienmarkt, die Einbrüche bei den Anzeigen, die Schließung von Redaktionen oder ganzen Zeitungen, die Klippen der Digitalisierung und vieles mehr. // Allerdings: Im aktuellen Jahresbericht Ihres Verbandes sind zugleich Fakten nachzulesen, die auch zuversichtlich stimmen können, die schwarze Zahlen und keine schwarze Zukunft verheißen. Welchen Überschriften darf ich also glauben? - allen, so habe ich es mir sagen lassen. Denn was die einen als existentielle Krise erleben, ist für die anderen eine hochrentable Phase. Hier schließt ein Hauptstadtbüro, dort wächst die "Landlust". Hier verliert eine Zeitung Papierliebhaber, dort geht ein anderes Blatt erfolgreich online. Parallelwelten, so empfinden wir es, tun sich auf. Das Wort Zeitungskrise beschreibt eben nur eine Realität. Deshalb bin ich gern gekommen zu Ihrem Kongress, der einen zweiten, einen genaueren Blick auf die viel zitierte Krise wirft und vor allem: der auch einen Blick nach vorn wagt. // Wie ich gehört habe, stand bislang trotz aller Schwierigkeiten öfter das halbvolle Glas als das halbleere Glas vor den Diskutanten. Das ist gut so, denn apokalyptische Debatten um das Zeitungssterben bringen weder die Verlage, noch die Redaktionen, noch die Leserschaft voran. Im Gegenteil: Wer vom Sterben spricht, der hat ja den Weg in die Zukunft aufgegeben. Stattdessen auf Transformation zu setzen, auf neue Geschäftsmodelle, das ist in meinen Augen nicht romantisch oder weltfremd, sondern eben realistisch. Allerdings werden Sie alle dazu sicherlich Mut brauchen. // Ich wage heute den Satz: Die Zeitung hat eine Zukunft. Ihre Form mag veränderlich sein, vielleicht auch in Frage stehen. Aber ihre wichtigste Rolle für ein tieferes Verständnis und die Weiterentwicklung unserer Demokratie kann und sollte konstant bleiben. Ich meine und ich spreche vom Qualitätsjournalismus. // Qualitätsjournalismus ist nicht an eine bestimmte Form gebunden - etwa an das Papier -, sondern natürlich an Inhalte, an eine Methode, die journalistische Methode. Der Journalismus der Zukunft mag ganz oder auch teilweise anders aussehen und anders funktionieren als heute. Das mag sein. Aber ich bin ganz zuversichtlich: Es wird ihn geben! Denn vieles verändert sich um uns herum, eines jedoch bleibt: Es gibt nicht nur das Bedürfnis nach Unterhaltung, sondern auch das Bedürfnis nach Information. Unser Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung, nach verlässlichen Fakten und verständlicher Deutung, das wird fortbestehen, auch weil mehr und mehr Nachrichten ungefiltert auf uns einströmen. // Eine gute Zeitung wird uns deshalb die Zeit, unsere Zeit, erklären. Qualitätsjournalismus ist etwas anderes als eine mit Fotos aufgehübschte Sammlung von Agenturmeldungen oder PR-Texten. Eine gute Zeitung wählt Nachrichten nach Kriterien der Relevanz aus, ordnet sie in Zusammenhänge ein, interpretiert und bewertet sodann das Geschehen. Eine gute Zeitung leistet also genau das, was wir angesichts der Informationsflut dringend brauchen: Sie zeichnet große Linien und vermittelt verschiedene Standpunkte. // Meine Damen und Herren, ich danke jedem Einzelnen von Ihnen, der sich für Qualitätsjournalismus in unserem Land stark macht! Bitte betrachten Sie diesen Dank - neben wenigen kritischen Anmerkungen, die ich Ihnen heute vielleicht zumute - als meine wichtigste Botschaft. Danke für alles, was Ihre Zeitungen unserer Demokratie an Erkenntnis, an Meinungsvielfalt und an Debattenreichtum schenken! // Sie merken, einem Zeitungspessimismus kann ich nicht das Wort reden. Allerdings möchte ich auch nicht in das Gegenteil verfallen, in einen naiven, schönfärberischen Blick auf die Lage. Es stellt sich durchaus die Frage: Ist die wichtige Funktion der Zeitungen für unsere Demokratie durch die Veränderungen am Markt gefährdet? // Ich habe den Eindruck: Die Risiken existieren, sind unübersehbar, weil die Transformation am Zeitungsmarkt die Rolle des Journalismus für unsere Demokratie im Kern berührt. Und mit diesem Kern meine ich genau den Teil von Qualität, der sich nicht in Papiermengen oder Pixeln messen lässt, sondern eine Konstante bei allem Wandel bleiben muss: die Glaubwürdigkeit einer Zeitung. Glaubwürdigkeit, das ist für mich genau das, was eine gute Zeitung ausmacht. Glaubwürdigkeit muss guten Journalismus auch künftig prägen, wenn wir einmal alle Äußerlichkeiten - alle Form- und Formatfragen - beiseitelassen. // Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs. Das Miteinander - oder sagen wir: Nebeneinander - von analogen und digitalen Zeitungen ist weit mehr als eine Formfrage, das habe ich jedenfalls so gelernt. Viele Stunden dieser Konferenz waren diesem Thema gewidmet. Gestern Abend habe ich noch überlegt, ob ich mich auf die Debatte um "Pixel versus Papier" als Laie überhaupt einlassen sollte. Kulturpessimismus gehört bekanntlich nicht zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung. Jetzt, wo ich in einem Saal voller Experten stehe, möchte ich am liebsten behelfsmäßig ein paar Vergleiche heranziehen, wie Sie es auch in Ihrem Konferenzprogramm getan haben. Unter dem Motto: Die totgesagte Musikindustrie? Es gibt sie noch! Der totgesagte Ladenhandel? Es gibt ihn noch! Was gilt also für die totgesagte Papierzeitung? - Ich gebe zu, mir gefällt der Gedanke, dass auch in vielen Jahren große Leserschaften eine Zeitung anfassen und darin blättern, vielleicht sogar einen klugen Kommentar ausschneiden, wie ich es öfter mache, aufbewahren und bei Gelegenheit daraus zitieren. // Allerdings wäre es töricht, die Technik von morgen mit dem Erfahrungshorizont von gestern zu begrüßen. Gerade das Internet, eine Kulturrevolution im Range des Buchdrucks oder der Dampfmaschine, wird unser Leben weiter verändern und vielleicht viel stärker, als wir es derzeit prognostizieren können. Und: Mit dem Siegeszug des Internets haben die klassischen Medien ihr Informations- und Deutungsmonopol ja offenkundig verloren. Schon jetzt ist die traditionelle Rollenaufteilung zwischen Absender und Empfänger einer Nachricht, zwischen Produzent und Konsument, wie wir sie von der Papierzeitung kennen, online aufgehoben. Schon jetzt werden Nachrichten aller Art in Windeseile verbreitet und zwar weltweit. Schon jetzt fühlen sich Millionen Menschen von der Informationsflut, die so entsteht, fast hinweggespült. Professionelle Kommunikatoren - auch Politiker - investieren viel Kraft, um ihre Botschaft trotzdem an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und schon jetzt gibt es Augenblicke, in denen kurze Tweets große Umwälzungen vorantreiben, denken wir nur an den Arabischen Frühling. // Freilich: Wie stark das Internet die Verbreitung und den Stellenwert von Nachrichten beeinflussen wird, können selbst die klügsten Zukunftsforscher nicht vorhersagen, jedenfalls nur bruchstückhaft erahnen. Das Ausmaß des Wandels ist für kaum jemanden absehbar. Manches unterschätzen, aber anderes überschätzen wir wohl auch. Umso mehr lohnt es sich, den Spielraum für Qualitätsjournalismus immer neu auszuloten. // Bei genauem Hinsehen ist ja manche neue Kommunikationsform auch nicht unbedingt eine Konkurrenz für die Zeitung. Es hat sich nämlich herumgesprochen, dass man mit 140 Zeichen keine Grundsatzdiskussion führen, aber gut auf Orte der Debatte - etwa auf Online-Zeitungen - verweisen kann. Außerdem setzt sich die Erkenntnis durch, dass anonyme Schwarmintelligenz zwar mitreißt, aber so manchen Blogger eben auch reinreißt, weil Quellen unklar bleiben und Fakten und Meinungen verschwimmen. Und der Verlust von Klarheit wird in aller Regel auch als Verlust von Wahrheit empfunden. Technisch gesehen kann heutzutage jeder mit wenig Aufwand Nachrichtenmacher sein. Aber was bedeutet das für den professionellen Journalismus? Und was bedeutet es darüber hinaus für unsere Demokratie? // Zumindest mittelfristig kann die ungefilterte, oft emotional getriebene Massenkommunikation im Netz die Zeitung als Quelle nicht ersetzen. Wir werden weiterhin angewiesen sein auf Kommunikation mit Spielregeln, auf Nachrichten, die mit professionellem Ethos gesammelt und erstellt und im Bewusstsein ihrer Qualität rezipiert werden. Eine funktionierende Demokratie braucht verlässliche Berichterstattung. Sie braucht seriöse Einordnung und sachkundige Interpretation des Geschehens. // Glaubwürdigkeit, das ist dabei für mich immer ein Schlüsselbegriff, weil sie unseren Blick von den vielen Veränderungen auf das Wesentliche lenkt. Glaubwürdigkeit, das ist freilich ein Prädikat, das in Sekunden verspielt, aber nur durch Beständigkeit erworben werden kann. Zeitungen, viele Zeitungen jedenfalls, haben es sich über Jahrzehnte, einige sogar über Jahrhunderte erarbeitet. Ich freue mich über jeden Teil dieser gewachsenen Kultur, der heute noch am Leben ist. Im August konnte ich der Hersfelder Zeitung zum 250. Jubiläum gratulieren. Das muss man sich einmal vorstellen. Das hat mich einmal mehr daran erinnert, wie eng die Geschichte der veröffentlichten Meinung mit der Geschichte unserer Demokratie verknüpft ist. Die Zeitungen sind Spiegel unseres Gemeinwesens, in guten wie in schlechten Zeiten. Für mich sind solche Jubiläen auch immer wieder ein Grund zur Freude, weil unser föderal geprägtes Land nicht zuletzt dank seiner traditionsreichen Lokalausgaben die größte Zeitungsvielfalt in Europa aufweist. Einigen Blättern ist es gelungen, ihr größtes Pfund - die Glaubwürdigkeit - erfolgreich auch in der digitalen Welt zu platzieren. Andere suchen noch nach neuen Vermarktungswegen. // Auch ich kann natürlich heute kein fertiges Modell anbieten, aber ich nenne gern einige Mindestanforderungen für die Bürgergesellschaft der Zukunft: "Wir müssen eine freie, unabhängige, vielfältige und qualitätsvolle Presse erhalten. Wir müssen sie uns leisten wollen." So habe ich es vor einem Jahr bei der Verleihung des Theodor-Wolff-Preises formuliert. Und ich glaube, bei diesem Ziel sind wir uns alle hier in diesem Saal einig. Allerdings hat wohl niemand eine Blaupause, wie genau aus dem Sich-Leisten-Wollen ein Sich-Leisten-Können, wie eins aus dem anderen wird. // An dieser Stelle will ich mir eine These erlauben, sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger: Wer glaubwürdig ist, der wird Anhänger und Mitstreiter finden auf seinem Weg. Zuerst fallen mir dabei diejenigen ein, die man früher Leserinnen und Leser nannte, die inzwischen User, Friends und Follower sind. Entscheidend ist: Die Mehrheit dieser Rezipienten verhält sich doch kritisch und anspruchsvoll. Darauf setze ich in einer aufgeklärten, bildungsbetonten Bürgergesellschaft. Präzise Informationen und Argumente werden dann immer ihr Publikum finden. // Allerdings will ich nicht verschweigen, dass ich auch heute schon ganz andere Stimmen höre. Wenn ich Menschen frage, warum sie sich für das Zeitunglesen nicht begeistern können, dann antworten viele, dass sie einfach nicht das darin finden, was sie gern lesen würden. Immer mehr junge Leute haben zum Beispiel den Eindruck, dass die Zeitungswelt eine ganz andere Realität beschreibt als die, in der sie leben. Wie könnten Zeitungen solche Gruppen für sich gewinnen? Eine einfache Antwort darauf erkenne ich nicht. Simplifizierung wäre für eine pluralistische Demokratie ohnehin keine oder eine äußerst schwache Lösung. Je vielfältiger die Lebensstile und damit die Erwartungen an den Journalismus werden, desto differenziertere Antworten brauchen wir auf die Kernfrage: Wann lohnt es für beide Seiten - Leserschaft wie Eigentümer - sich eine Zeitung zu halten? // Die Frage, wie genau sich guter, glaubwürdiger Journalismus lohnt und was er für wen wert sein kann, stellt sich gerade für Sie immer wieder neu. Ihre zweite große Gruppe von Verbündeten müssen deshalb auch künftig die Redakteurinnen und Redakteure sein. // Glaubwürdige Journalisten sind das größte Kapital einer Zeitung - mit ihrem Intellekt, mit ihrer Empathie, mit ihrer Neugier oder mit ihrer Diskussionsfreude, manchmal auch einfach nur mit ihrem Namen, der im Laufe der Jahre zu einer ganz eigenen Marke avanciert ist. Gute Journalisten fühlen sich nicht allein dem Eigentümer ihres Mediums verpflichtet, sondern auch dem Gemeinwohl. Sie beleuchten unsere Gegenwart, sie decken Missstände auf und riskieren ja in manchen Ländern der Welt dabei unter Umständen ihre Freiheit oder gar ihr Leben. Wenn sie einem Skandal nachjagen, suchen sie nicht bloß Erregung, sondern letztlich Wahrhaftigkeit. Deshalb prüfen sie die Fakten und hören die Gegenseite. Sie verstehen Erfolg nicht nur als flüchtigen, spektakulären Augenblick. Sie setzen auf langfristigen Erfolg durch Präsenz und Profil, durch Haltung und Hingabe. In diesem Sinne dienen sie der Demokratie. Das sage ich nicht nur als Bundespräsident. Ich sage es vor allem als Leser, der sich lange danach gesehnt hat, dass es diese Art von Journalismus nicht nur in Hamburg oder München, sondern auch in Rostock oder Dresden geben darf. // Deshalb gehört zur Debatte über die Zukunft des Qualitätsjournalismus für mich auch ein Wort über die Beschäftigungssituation von Journalisten. Überall lässt sich beobachten, wie feste Stellen in den Redaktionen mehr und mehr verschwinden, wie freie Mitarbeiter für Zeilenhonorare schuften, wie Volontäre als Redakteure arbeiten, aber dabei Azubilöhne verdienen. Prekäre Arbeit aber, das ist keine stabile Basis für verlässliche Inhalte. Selbst die Festangestellten haben offenbar Anlass, sich wehmütig an die gute alte Zeit zu erinnern. Viele von ihnen würden gern gründlicher recherchieren, öfter nachfragen und präziser texten. Sie sträuben sich dagegen, Masse statt Klasse zu produzieren. Der Zeit- und Kostendruck in den Redaktionen lässt immer weniger Spielraum für aufwendigen oder investigativen Journalismus. Die Streichung der Auslandskorrespondentenstellen ist ein Beispiel dafür. // Immerhin, nach und nach wächst die Erkenntnis: Google kann weder Geist noch Gespür eines Reporters vor Ort ersetzen. Und ich hoffe, dass mit dieser Einsicht ein Gegentrend greifen kann. Denn wo zu kräftig gespart wird, stellt sich oft heraus: Personelle Auszehrung schlägt früher oder später auf die Qualität durch. Und das merken dann die Leser. Es ist also kein Gutmenschengerede zu konstatieren: Langfristig ist eine solide Personalausstattung in den Redaktionen inhaltlich wie auch ökonomisch sinnvoll. // Qualitätsjournalismus und Gewinnorientierung, sie sollen doch bitte keine Gegensätze sein. Hier im Saal klingt das wie eine Selbstverständlichkeit, aber draußen muss man es manchmal erklären. Am besten gelingt das wohl durch Beispiele aus der Praxis, Beispiele, bei denen klar wird: Qualität setzt sich durch. Ein überzeugendes Medienprodukt - sei es eine klassische oder digitale Zeitung - findet auch eine Leserschaft. Ich denke an die vielen renommierten Blätter, die Sie herausgeben. Ich denke an die vielen Preise und Auszeichnungen für gelungenen Journalismus, die Ihre Häuser jedes Jahr als Bestätigung der Verlagsarbeit entgegennehmen können. Ob Hochkultur oder Mühen der Ebene: So vieles, was in Deutschland produziert wird, kann sich sehen, kann sich lesen lassen. // Ich denke auch an Erfolgsgeschichten, die ganz im Stillen wachsen. Regional und lokal passiert das tausendfach, wie wir wissen. Diese journalistische Arbeit an der Basis beobachte ich mit großem Interesse, weil sie all dem so ähnlich ist, was sich Demokraten von lokalen Politikern wünschen: nah bei den Menschen sein, zuhören ohne Überheblichkeit und ohne vorgefestigte Meinungen, dann weitertragen, was die Region bewegt und zum Mittun einladen und Missstände klar benennen. Dabei gilt gleichwohl die alte Journalistenweisheit: In der Kommune fällt es manchmal leichter, den Papst zu kritisieren als den eigenen Bürgermeister. // Es ist und bleibt die hohe Kunst, aus dem Alltag heraus die großen Lebensfragen zu stellen und zu beantworten - im Kleinen das Bedeutende für die Gesellschaft zu erkennen. Denken wir dabei nur an den oft zitierten Kaninchenzüchterverein, der meist despektierlich als Beispiel für erste Reportagen eines Volontärs genannt wird. Derlei Vereine und Initiativen sind es aber, in denen das Leben der Menschen und in denen zum Teil Basisdemokratie stattfindet. Auch dort wird ausgefochten, wer am Sonntag die Wahl gewinnt und ob es wohl hilfreich wäre, nicht nur dem eigenen Garten, sondern auch der Wahlkabine einen Besuch abzustatten. // Welches neue Bild könnte das Klischee vom Kaninchenzüchterverein ersetzen? Ist es vielleicht die multimediale, womöglich international vernetzte Lokalredaktion? Ich gebe zu, für einige Neuerungen fehlt mir noch die Vorstellungskraft. Neulich hörte ich von sogenannten News-Games, Spielen, mit denen zeitungsferne Menschen an Nachrichten herangeführt werden sollen. Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht werde ich im Laufe meiner Amtszeit für ein solches Novum sogar einmal einen Orden verleihen dürfen. // Was das Internet betrifft, so ist schwer vorherzusagen, welche Innovationen uns in zehn Jahren herausfordern werden. Werden wir mehr über die Gefahren und den Missbrauch reden oder über weitere Vertriebskanäle? Die intelligente Verknüpfung von Wort und Bild, von Animation und Moderation kann uns in eine Medienzukunft führen, in der noch mehr Menschen als bisher mit noch besseren Informationen erreicht werden. Das wäre gut für die Medienhäuser - und es wäre gut für die Demokratie." // "Alles bleibt in Bewegung." Zwischen Hoffnung und harter Arbeit ist dieser schöne Satz heute Analyse, Prognose und zugleich Appell: Wenn alles in Bewegung bleibt, dann bin auch ich, dann sind wir alle aufgefordert, uns mutig auf den Weg zu machen!
-
"Die Freiheit in der Freiheit gestalten". Vor 23 Jahren stand ich auf den Stufen des Reichstagsgebäudes in Berlin und ich erinnere mich noch heute an den Klang der Freiheitsglocke, als um Mitternacht die Fahne der Einheit aufgezogen wurde. Es war der Abschluss einer bewegenden Zeit, vom Aufbruch im Herbst 1989 bis zum Tag der Vereinigung - für mich war es die beglückendste Zeit meines Lebens. // Der Freiheitswille der Unterdrückten hatte die Unterdrücker tatsächlich entmachtet - in Danzig, in Prag, in Budapest und in Leipzig. Was niedergehalten war, stand auf. Und was auseinandergerissen war, das wuchs zusammen. Aus Deutschland wurde wieder eins. Europa überwand die Spaltung in Ost und West. // Ich denke auch zurück an die Monate der Einigung, und nicht wenige der Abgeordneten der ersten frei gewählten Volkskammer sind heute unter uns. Wie viel Bereitschaft zur Verantwortung war damals notwendig, um Deutschland zu vereinen, wie viel Entscheidungsmut, wie viel Improvisationsgabe. Wie vieles war zu regeln: diplomatische und Bündnisfragen, grundsätzliche Weichenstellungen, hochwichtige, aber manchmal auch banale Details. Alle, die damals mitwirkten, waren Lernende, manchmal auch Irrende - aber immer waren sie, waren wir Gestaltende! Der 3. Oktober erinnert uns also nicht nur an die überwundene Ohnmacht. Er zeugt auch von dem Willen, die Freiheit in der Freiheit zu gestalten. // All das klingt nach am heutigen Tag, dem Tag der Deutschen Einheit. // Wir blicken zurück auf das, was wir konnten - dankbar für das Vertrauen, das andere in uns setzten, und stolz auf das, was wir seitdem erreicht haben: Ostdeutsche, Westdeutsche und Neudeutsche, alle zusammen - wir alle hier im Lande, zusammen mit Freunden und Partnern in Europa und der ganzen Welt. Das vereinigte Deutschland, es ist heute wirtschaftlich stark, es ist weltweit geachtet und gefordert. Unsere Demokratie ist lebendig und stabil. Deutschland hat ein Gesellschaftsmodell entwickelt, das ein hohes Maß an Einverständnis der Bürger mit ihrem Land hervorgebracht hat. Für viele Länder in der Welt sind wir sogar Vorbild geworden - für Menschen meiner Generation fast unvorstellbar. All das ist Grund zur Dankbarkeit und Freude - einer Freude, die uns heute aber vor allem Ansporn sein soll! // Unser Land steht nun wieder vor einem neuen Anfang - so wie alle vier Jahre. Wir hatten eine Wahl. 44 289 652 Deutsche haben darüber abgestimmt, welche Bürgerinnen und Bürger künftig mitbestimmen werden über die Dinge des öffentlichen Lebens. Meine Damen und Herren Abgeordnete hier: Ich wünsche Ihnen Leidenschaft, Ehrgeiz und Achtsamkeit für all das, was Sie gestalten müssen - und was auf uns zukommt. // Denn vieles fordert uns heute heraus. Besonders auf drei große Herausforderungen möchte ich heute eingehen. Entwicklungen, die nicht jederzeit und nicht für jeden im Alltag spürbar sind, weil sie langfristig wirken. Entwicklungen auch, die nicht mehr allein innerhalb der Landesgrenzen zu regeln sind. // Erstens: In einer Welt voller Krisen und Umbrüche wächst Deutschland neue Verantwortung zu. Wie nehmen wir sie an? Zweitens: Die digitale Revolution wälzt unsere Gesellschaft so grundlegend um wie einst die Erfindung des Buchdrucks oder der Dampfmaschine. Wie gehen wir mit den Folgen um? Beginnen möchte ich allerdings - drittens - mit dem demographischen Wandel. Unsere Bevölkerung wird in beispielloser Weise altern und dabei schrumpfen. Wie bewahren wir Lebenschancen und Zusammenhalt? // Tatsächlich wird es immer weniger Jungen zufallen, für immer mehr Ältere zu sorgen. Das schafft eine schwierige Lage, die unsere Kinder und Enkel möglicherweise erheblich einschränken wird. Andererseits entsteht dadurch ein Druck, der manches in Bewegung bringt, ja einfordert, was ohnehin überfällig und richtig ist. Arbeitgeber etwa sind längst dabei, um Zuwanderer zu werben. Oder ältere Menschen erhalten neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zudem nutzen immer mehr Ältere die Zeitspanne nach der Berufstätigkeit für bürgerschaftliches Engagement. Immer mehr Frauen streben ins Arbeitsleben und in Führungspositionen. Dort dürfen es noch mehr werden. Die starren Rollenbilder brechen weiter auf. Neue Vereinbarungen zwischen Mann und Frau, zwischen Familie und Beruf werden möglich. // Wenn die Gesellschaft der Wenigeren nicht eine Gesellschaft des Weniger werden soll, dann dürfen keine Fähigkeiten brach liegen. Wir wissen doch, dass es so viele sind, die mehr können könnten, wenn ihnen mehr geholfen und auch mehr abverlangt würde. Ich meine die formal Geringqualifizierten, die zu fördern und einzubinden sind. Ich meine Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern, in denen Bildungsehrgeiz oder Bücher einfach fehlen. // Jeder Einzelne ist doch mit ganz eigenen Möglichkeiten geboren - und es ist ganz egal wo, in Thüringen oder Kalabrien, in Bayern oder in Anatolien. Diese Fähigkeiten gilt es zu entdecken, zu entwickeln und Menschen sogar aus niederdrückender Chancenlosigkeit herauszuholen. Bildung auch als Förderung von Urteilskraft, sozialer Verantwortung und Persönlichkeit, Bildung als Grundlage eines selbstbestimmten, erfüllten Lebens - das ist für mich ein Bürgerrecht und ein Gebot der Demokratie. // Unser Ziel muss lauten: Niemand wird zurückgelassen, nicht am Anfang und nicht am Ende eines langen Lebens. Angenommen und gestaltet, vermag der demographische Wandel unsere Gesellschaft fairer und solidarischer, aber auch vielfältiger und beweglicher und damit zukunftsfähig zu machen. // Die Bedingungen dafür zu schaffen, ist vor allem Aufgabe der Politik. Die Politik hat sich zwar auf den Weg gemacht, das sehen wir alle - aber oftmals haben wir den Eindruck, sie bewegt sich nicht immer schnell genug. Wie lange ringen wir nun schon um die frühkindliche Betreuung? Oder um die Verbesserung unserer Pflegesysteme? Oder um Modernisierung in der Einwanderungspolitik und des Staatsbürgerschaftsrechts? // Mir ist bewusst - ich müsste noch über viele innenpolitische Herausforderungen sprechen: über die Energiewende, die erst noch eine Erfolgsgeschichte werden muss. Auch über Staatsverschuldung etwa oder die niedrige Investitionsquote, die nicht ausreicht, um das zu erhalten, was vorige Generationen aufgebaut haben. Und darüber, dass noch nicht ehrlich genug diskutiert wird über die Kluft zwischen Wünschenswertem und dem Machbaren. // Viele können in den kommenden Jahren vieles noch besser machen, damit die Jahrzehnte danach gut werden. So wie wir heute davon profitieren, dass wir vor einem Jahrzehnt zu Reformen uns durchgerungen haben, so kann es uns übermorgen nutzen, wenn wir morgen - meine Damen und Herren Abgeordnete! - wiederum Mut zu weitsichtigen Reformen aufbringen. Denn wir wollen doch zeigen und wir wollen es erleben, dass eine freiheitliche Gesellschaft in jedem Wandel trotz aller Schwierigkeiten neue Entfaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen und für die Vielen erschließen kann. // Entfaltungsmöglichkeiten! Wie viele haben wir in den vergangenen Jahren hinzugewonnen, durch Internet und durch mobile Kommunikation - ein Umbruch, dessen Konsequenzen die meisten bislang weder richtig erfasst noch gar gestaltet haben. Wir befinden uns mitten in einem Epochenwechsel. Ähnlich wie einst die industrielle Revolution verändert heute die digitale Revolution unsere gesamte Lebens- und Arbeitswelt, das Verhältnis vom Bürger zum Staat, das Bild vom Ich und vom Anderen. Ja, wir können sagen: Unser Bild vom Menschen wird sich ändern. // Nie zuvor hatten so viele Menschen Zugang zu so viel Information, nie zuvor konnte man weltweit so leicht Gleichgesinnte finden, war es technisch einfacher, Widerstand gegen autoritäre Regime zu organisieren. Manchmal denke ich: Hätten wir doch 1989 damals in Mittel- und Osteuropa uns so miteinander vernetzen können! // Die digitalen Technologien sind Plattformen für gemeinschaftliches Handeln, Treiber von Innovation und Wohlstand, von Demokratie und Freiheit, und nicht zuletzt sind sie großartige Erleichterungsmaschinen für den Alltag. Sie navigieren uns zum Ziel, sie dienen uns als Lexikon, als Spielwiese, als Chatraum, und sie ersetzen den Gang zur Bank ebenso wie den ins Büro. // Wohin dieser tiefgreifende technische Wandel führen wird, darüber haben wir einfachen "User" bislang wenig nachgedacht. Erst die Berichte über die Datensammlung der Dienste befreundeter Länder haben uns mit einer Realität konfrontiert, die wir bis dahin für unvorstellbar hielten. Erst da wurde den meisten die Gefahr für die Privatsphäre bewusst. // Vor 30 Jahren, erinnern wir uns, wehrten sich Bundesbürger noch leidenschaftlich gegen die Volkszählung und setzten am Ende das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch. Dafür hat unser Bundesverfassungsgericht gesorgt. Und heute? Heute tragen Menschen freiwillig oder gedankenlos bei jedem Klick ins Netz Persönliches zu Markte. Viele der Jüngeren vertrauen sozialen Netzwerken sogar ihr ganzes Leben an. // Ausgeliefertsein und Selbstauslieferung sind kaum voneinander zu trennen. Es schwindet jene Privatsphäre, die unsere Vorfahren doch einst gegen den Staat erkämpften und die wir in totalitären Systemen gegen Gleichschaltung und Gesinnungsschnüffelei so hartnäckig zu verteidigen suchten. Öffentlichkeit erscheint heute vielen nicht mehr als Bedrohung, sondern als Verheißung, die Wahrnehmung und Anerkennung verspricht. // Sie verstehen nicht oder sie wollen nicht wissen, dass sie so mit bauen an einem digitalen Zwilling ihrer realen Person, der neben ihren Stärken eben auch ihre Schwächen enthüllt - oder enthüllen könnte. Der ihre Misserfolge und Verführbarkeiten aufdecken oder gar sensible Informationen über Krankheiten preisgeben könnte. Der den Einzelnen transparent, kalkulierbar und manipulierbar werden lässt für Dienste und Politik, Kommerz und Arbeitsmarkt. // Wie doppelgesichtig die digitale Revolution ist, zeigt sich besonders am Arbeitsplatz. Vielen Beschäftigten kommt die neue Technik entgegen, weil sie erlaubt, von Hause oder gar im Café zu arbeiten und die Arbeitszeit völlig frei zu wählen. Gleichzeitig wird aber die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit verwischt, was ständige Verfügbarkeit bedeuten kann - rund um die Uhr. // Historisch betrachtet, sind Entwicklungssprünge nichts Neues. Im ersten Moment erleben wir sie allerdings ratlos, vielleicht auch ohnmächtig. Naturgemäß hinken dann Gesetze, Konventionen und gesellschaftliche Verabredungen der technischen Entwicklung hinterher. Wie noch bei jeder Innovation gilt es auch jetzt, die Ängste nicht übermächtig werden zu lassen, sondern als aufgeklärte und ermächtigte Bürger zu handeln. So sollte der Datenschutz für den Erhalt der Privatsphäre so wichtig werden wie der Umweltschutz für den Erhalt der Lebensgrundlagen. Wir wollen und sollten die Vorteile der digitalen Welt nutzen, uns gegen ihre Nachteile aber bestmöglich schützen. // Es gilt also, Lösungen zu suchen, politische und gesellschaftliche, rechtliche, ethische und ganz praktische: Was darf, was muss ein freiheitlicher Staat im Geheimen tun, um seine Bürger durch Nachrichtendienste vor Gewalt und Terror zu schützen? Was aber darf er nicht tun, weil sonst die Freiheit der Sicherheit geopfert wird? Wie muss der Arbeitsmarkt aussehen, damit der allzeit verfügbare Mensch nicht zu so etwas wie einem digitalen Untertanen wird? Wie existieren Familie und Freundschaften neben den virtuellen Beziehungen? Wie können Kinder und Jugendliche das Netz nutzen, ohne darin gefangen zu werden? // Wir brauchen also Gesetze, Konventionen und gesellschaftliche Verabredungen, die diesem epochalen Wandel Rechnung tragen. // Gerade in Demokratien muss Politik schon reagieren, wenn ein Problem erst am Horizont auftaucht. Und sie muss ständig nachjustieren, sobald die Konturen klarer hervortreten. Das ist übrigens eine ihrer Stärken. // Diese Stärke ist es auch, die wir für eine weitere Herausforderung unserer Zeit brauchen: die europäische Integration. Ohne Zweifel ist das Europa in der Krise nicht mehr das Europa vor der Krise. Risse sind sichtbar geworden. // Die Krise hat Ansichten und Institutionen verändert, sie hat Kräfte und Mehrheiten verschoben. Die Zustimmung zu mehr Vergemeinschaftung nimmt ab. Nicht die europäischen Institutionen, sondern nationale Regierungen bestimmen wesentlich die Agenda. Zudem tauchen in Ländern, denen die Rezession vieles abverlangt, alte Zerrbilder eines dominanten Deutschlands auf. // Dies alles will diskutiert und abgewogen sein. Die gute Nachricht lautet: Ein starkes Band aus Mentalität, Kultur und Geschichte, es hält Europa zusammen. Entscheidend ist aber unser unbedingter Wille zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft. Europa, so spüren wir jetzt, kennt nicht nur eine Gestalt, auch nicht nur eine politische Organisationsform seiner Gemeinschaft. Da haben wir zu streiten und zu diskutieren über die beste Form der Zusammenarbeit, nicht aber über den Zusammenhalt Europas! Und unsere Einigungen haben wir so zu kommunizieren, dass die europäischen Völker die Lösungen akzeptieren und mittragen können. Es bleibt die Aufgabe der Politik - und als Bundespräsident nehme ich mich da überhaupt nicht aus - das Europa Verbindende zu stärken. // Was ist nun die Aufgabe Deutschlands in Europa und in der Welt? Manche Nachbarländer fürchten ja eine starke Rolle Deutschlands, aber andere wünschen sie sich. Auch wir selbst schwanken: Weniger Verantwortung, das geht eigentlich nicht länger, aber an mehr Verantwortung müssen wir uns erst noch gewöhnen. // Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb die politische Denkerin Hannah Arendt: "Es sieht so aus, als ob sich die Deutschen nun, nachdem man ihnen die Weltherrschaft verwehrt hat, in die Ohnmacht verliebt hätten." Deutschland hatte, wir wissen es alle, Europa in Trümmer gelegt und Millionen Menschenleben vernichtet. Was Arendt als Ohnmacht beschrieb, hatte damals eine politische Ratio. Das besiegte Deutschland musste sich erst ein neues Vertrauen erwerben und seine Souveränität wiedererlangen. // Vor wenigen Wochen, bei meinem Besuch in Frankreich, da wurde ich allerdings mit der Frage konfrontiert: Erinnern wir Deutsche auch deshalb so intensiv an unsere Vergangenheit, weil wir eine Entschuldigung dafür suchen, den heutigen Problemen und Konflikten in der Welt auszuweichen? Lassen wir andere unsere Versicherungspolice zahlen? // Es gibt natürlich Gründe, diese Auffassung zu widerlegen oder ihr zu widersprechen. Die Bundeswehr hilft, in Afghanistan und im Kosovo den Frieden zu sichern. Deutschland stützt den Internationalen Strafgerichtshof, es fördert ein Weltklimaabkommen und engagiert sich stark in der Entwicklungszusammenarbeit. Deutschlands Beiträge und Bürgschaften helfen, die Eurozone zu stabilisieren. // Trotzdem, es mehren sich die Stimmen innerhalb und außerhalb unseres Landes, die von Deutschland mehr Engagement in der internationalen Politik fordern. In dieser Liste findet sich ein polnischer Außenminister ebenso wie Professoren aus Oxford oder Princeton. Ihnen gilt Deutschland als schlafwandelnder Riese oder als Zuschauer des Weltgeschehens. Einer meiner Vorgänger, Richard von Weizsäcker, ermuntert Deutschland, sich stärker einzubringen für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. // Es stellt sich tatsächlich die Frage: Entspricht unser Engagement der Bedeutung unseres Landes? Deutschland ist bevölkerungsreich, in der Mitte des Kontinents gelegen und die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Zur Stärke unseres Landes gehört, dass wir alle Nachbarn als Freunde gewannen und in internationalen Allianzen zu einem verlässlichen Partner geworden sind. So eingebunden und akzeptiert, konnte Deutschland Freiheit, Frieden und Wohlstand sichern. Diese politische Ordnung und unser Sicherheitssystem gerade in unübersichtlichen Zeiten zu erhalten und zukunftsfähig zu machen - das ist unser wichtigstes Interesse. // Deshalb ist es richtig, wenn andere ebenso wie wir selbst fragen: Nimmt Deutschland seine Verantwortung ausreichend wahr etwa gegenüber den Nachbarn im Osten, im Nahen Osten oder am südlichen Mittelmeer? Welchen Beitrag leistet Deutschland, um die aufstrebenden Schwellenländer als Partner der internationalen Ordnung zu gewinnen? // Und wenn wir einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anstreben: Welche Rolle sind wir dann bereit, bei Krisen in ferneren Weltregionen zu spielen? // Unser Land ist keine Insel. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, wir könnten verschont bleiben von den politischen und ökonomischen, den ökologischen und militärischen Konflikten, wenn wir uns an deren Lösung nicht beteiligen. // Ich mag mir nicht vorstellen, dass Deutschland sich groß macht, um andere zu bevormunden. Aber ich mag mir genauso wenig vorstellen, dass Deutschland sich klein macht, um Risiken und Solidarität zu umgehen. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Land, das sich so als Teil eines Ganzen versteht, muss weder bei uns Deutschen auf Abwehr noch bei unseren Nachbarn auf Misstrauen stoßen. // Nun habe ich Ihnen an diesem Tag der Deutschen Einheit einiges vorgetragen zur Rolle Deutschlands in der Welt, zur digitalen Revolution und zum demographischen Wandel. Was aber ist die Grundmelodie? Ich sehe unser Land als Nation, die nach Jahrzehnten demokratischer Entwicklung "Ja" sagt zu sich selbst. Als Nation, die das ihr Mögliche und ihr Zugewachsene tut, solidarisch im Inneren wie nach außen. Als Nation, die in die Zukunft schaut und dort nicht Bedrohung sieht, sondern Chancen und Gewinn. // Wir hatten eine Wahl - und wir haben sie weiterhin! Der 3. Oktober zeigt: Wir sind nicht ohnmächtig. Und handlungsfähig, das sind wir nicht erst dann, wenn wir das Ende einer Entwicklung kennen. Wir sind es bereits, wenn wir Verantwortung annehmen, mit dem, was wir jetzt wissen, jetzt können, gestaltend eingreifen. // Wir, zusammen einzigartig, schauen uns an diesem Festtag um. Wir sehen, was uns in schwierigen Zeiten gelungen ist. Und wir sind dankbar für all das, was gewachsen ist. Und eine Verheißung kann uns zur Gewissheit werden: Wir müssen glauben, was wir konnten. Dann werden wir können, woran wir glauben.
-
"Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt / schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." Wenn je auf einen politisch wirkenden Deutschen dieses Schiller'sche Wort aus dem Prolog zu "Wallenstein" zutrifft, dann auf ihn: Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, kurz: Fürst von Bismarck - preußischer Ministerpräsident, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, Reichskanzler des deutschen Kaiserreiches; kurz: eiserner Kanzler. // Bismarck: Preußen, Junkertum, Kaiserreich, Friedrichsruh, Spiegelsaal, Emser Depesche, Kanzelparagraph, Sozialistengesetz - sind das nicht alles Stichworte einer längst versunkenen Epoche? Stoff höchstens für Denkmäler und Museen? Sind das nicht Geschichten aus grauer Vorzeit? // Dazu eine kleine Zeitrechnung: Otto von Bismarck war noch für 22 Jahre Zeitgenosse Konrad Adenauers. Und wir - zumindest viele von uns - waren noch Zeitgenossen Konrad Adenauers, eines anderen großen Kanzlers der Deutschen. Für mich jedenfalls trifft das zu. So gesehen ist Bismarck also doch noch gar nicht so lange her. // Bismarck hat sich, wie andere geschichtliche Persönlichkeiten, die aus den Zeitläuften besonders herausragen, den zentralen Fragen und Herausforderungen seiner Epoche gewidmet. // "Deutschland? aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus." // In diesen beiden Versen, die Goethe und Schiller gemeinsam verfasst haben, ohne dass man sagen könnte, wer von den beiden welchen Anteil daran hatte, in diesen sogenannten Xenien drückt sich die ganze deutsche Frage aus, die spätestens seit der französischen Revolution und dann stärker noch seit den Befreiungskriegen die meisten Länder deutscher Zunge beschäftigt: Deutschland - aber wo liegt es, aber was ist es, aber wie kommt es zusammen? // Deutschland: Das ist da zwar längst ein Begriff, aber zu diesem Begriff gibt es keine politische Entsprechung. Die Nation: Eine tiefe, seltsam dringliche Sehnsucht nach Einheit erfasst die deutschen Menschen um 1800, obwohl doch, wie ja die Schiller-Goethe'schen Verse es sagen, Kultur und Geist, Bildung und Humanität blühen und gedeihen - und obwohl die Kultur doch eine Einheit bereits darstellt. Später wird man von Deutschland als einer Kulturnation sprechen, zu der die Königreiche, die Fürsten- und Herzogtümer, Grafschaften und geistlichen Territorien verbunden durch die deutsche Sprache längst geworden waren, obwohl oder gerade weil es eine politische Einheit nicht gab. // Eine Nation sein - diese Idee greift, wir wissen es, auch anderswo um sich im Europa des 19. Jahrhunderts. Geboren ist sie im revolutionären Frankreich, davon ist sie so sehr geprägt, dass man geradezu sagen kann, "Nation" sei der "Eigenname Frankreichs". Nation - das hört sich für die Völker Europas auch sofort nach "Freiheit" an. Denn das gehört nach 1792 doch zusammen: Die eine und unteilbare Nation und die Menschen- und Freiheitsrechte, die in ihr gelten sollen. Dass und wie diese Ideen dann mit Gewalt exportiert werden sollten, worunter gerade Deutschland zu leiden hatte, steht auf einem anderen Blatt. // Nach den Befreiungskriegen, nach der Phase der Restauration und nach der letztlich gescheiterten Revolution von 1848 war in Deutschland die Enttäuschung groß. Nationale Einheit und demokratische Freiheit schienen in weite Ferne gerückt. Dazu kamen die umstürzenden neuen technischen und industriellen Entwicklungen, die eine historisch unerhörte Akzeleration bedeuteten. Städte wuchsen plötzlich, eine Massengesellschaft entstand, der Fortschritt brachte fast jährlich neue Segnungen, und gleichzeitig musste man mit seinen unerwünschten Folgen umgehen. // Die Welt, in der Otto von Bismarck politisch zu wirken begann, war also in jeder Hinsicht in Bewegung. "Das ruhelose Reich" hat Michael Stürmer seine Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überschrieben. Dort heißt es: "Nationale Leitbilder wurden [ ] Ersatzformen des Glaubens, gestiftet durch Verlust der Tradition, provoziert durch das Ende aller Sicherheit und erwachsen aus einem Wandel, über dessen Ziele es so wenig Gewissheit gab wie über die Frage, ob er überhaupt ein Ziel habe. Seit 1848 wurde die Nationalisierung der Massen' Grundzug der Epoche " // Wenn wir heute Bismarcks gedenken, der zu den wirkmächtigsten, natürlich auch umstrittensten Gestalten und Gestaltern der deutschen Geschichte gehört, dann müssen wir vor allem die Fragen anschauen, auf die er mit seinem Wirken eine Antwort zu geben versucht hat. // Es ist erstens die nationale Frage, das heißt, in welcher Form kann und soll Deutschland geeint sein? // Es ist zweitens die internationale Frage: Welchen Platz soll Deutschland in der Welt einnehmen, im europäischen Gleichgewicht der Mächte? // Es ist drittens die innenpolitische Frage: Wie soll das Land aussehen, wie kann innerer Frieden hergestellt werden, wie soll seine kulturelle und besonders seine soziale Verfassung aussehen? // Diese Fragen - wir spüren es - sind nicht einfach historisch überholt. Wir erkennen darin - natürlich verwandelt und mit anderen Vorzeichen - Konturen unserer heutigen Fragen wieder. // So wie immer wieder über die Gestaltung von Einheit in Vielfalt nachgedacht wird - Stichwort Föderalismusreform -, so wie wir über Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt immer wieder neu nachdenken, so beschäftigt uns auch die innere Gestaltung unseres Gemeinwesens, das heute durch Einwanderung und demographischen Wandel vor neuen kulturellen und sozialen Herausforderungen steht. // Beispielhaft ist Bismarcks Energie, sein politischer Wille und seine Leidenschaft, sich so wesentlichen Fragen seiner Zeit zu stellen. Beispielhaft seine Fähigkeit, den richtigen Moment abwarten zu können, beispielhaft auch seine Entschlusskraft und seine Standhaftigkeit. // Wir werden natürlich den Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, anders begegnen, ja anders begegnen müssen als Bismarck. Aber nicht deshalb, weil er das Land auf einen abschüssigen Weg geführt hätte. Nein: Es führt eben kein gerader Weg von Bismarck zu Hitler, wie gelegentlich behauptet worden ist. Das ist nicht nur eine unhistorische Spekulation, sondern auch eine ungerechte Beurteilung oder besser: Verurteilung eines Strategen, dem es doch nie um schlichtes Vormachtstreben oder gar so etwas wie ein "Großdeutsches Reich" ging. // Aber was für ihn noch quasi legitime politische Manöver waren, wie etwa Kriege zu führen, um innenpolitische Ziele zu verfolgen oder außenpolitische Interessen zu wahren, das kommt für uns selbstverständlich nicht mehr in Frage - und wo das heute noch anderenorts geschieht, da müssen wir Protest einlegen und nötigenfalls auch Hilfe oder Widerstand leisten. // Die Einheit des Reiches so zu gestalten, dass sich auch die Kleinen nicht übervorteilt fühlen, und dass ein gerechter Ausgleich geschaffen wird, darauf hat Bismarck immer geachtet - und manch einer sieht das als vorbildlich für Europa und dessen Einigungsprozess an, der im gerechten Ausgleich der Einzelinteressen und unter Wahrung der Interessen auch der kleineren Partner gestaltet werden soll. // Eine besondere List der Geschichte ist wohlbekannt, sozusagen die Dialektik des Paternalismus: Um seine sozialistischen Gegner zu bekämpfen, schuf Bismarck die damals weltweit fortschrittlichste Sozialgesetzgebung. Das hat Deutschland nachhaltig geprägt. Gerade die Bismarckzeit zeigt, dass sich soziale Sicherheit und dynamische wirtschaftliche Entwicklung nicht ausschließen, sondern dass sie im Gegenteil einander stärken können und sollten. Inzwischen haben wir allerdings auch gelernt, ohne Bevormundung von oben eine partnerschaftlich strukturierte, soziale Marktwirtschaft zu gestalten. // Ein bleibender Schatten auf Bismarcks Wirken ist sein hartnäckiger, auch unbelehrbarer Drang, Reichsfeinde zu identifizieren und möglichst auszuschließen, namentlich natürlich Katholiken und dann Sozialisten. Zeitgenossen mit Rang und Namen haben ihn dabei unterstützt. Das war er nicht allein. Das war nicht nur kontraproduktiv, es hat auch lange nachwirkende Wunden geschlagen und Vorurteile auf Jahrzehnte befestigt. // Wie lange mussten sich zum Beispiel auch Sozialdemokraten, bis hin zu Willy Brandt, noch als "vaterlandslose Gesellen" oder die katholische Kirche in Deutschland sich als Vertreterin einer "auswärtigen Macht" bezeichnen lassen! Das war Bismarck'sches Denken in Feindbildern. Wir dürfen es durchaus so formulieren, auch wenn Bismarck selbst die eben genannten Frontlinien später nivellierte, wenn er etwa mit dem Zentrum einen Modus Vivendi fand, der sich auf lange Sicht positiv auf das Miteinander in Deutschland auswirken sollte. // Der Blick auf die Bismarck-Ära zeigt uns, wie wichtig es war, dass die frühe Bundesrepublik eine Gesellschaft zu errichten vermochte, in der die Gräben zwischen den Kulturen und Religionen und - sagen wir es mit einem Wort von damals - den Klassen nicht vertieft, sondern überbrückt oder gar überwunden worden ist. // Bismarcks "Revolution von oben", wie man sein Werk genannt hat, hat damals eine historisch lang wirkende und tiefgreifende Antwort gegeben auf die große Frage der Epoche nach dem Ort und der Gestalt Deutschlands. // Wir stehen heute vor ähnlichen großen Fragen. Unsere Antworten werden andere sein. Aber den Mut, sich mit Tatkraft und Optimismus diesen Herausforderungen zu stellen, den können wir von ihm lernen.
-
Als ich vor fast fünf Jahren das Amt des Bundespräsidenten übernahm, habe ich mich und meine Landsleute gefragt, wie es denn aussehen sollte, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel einmal "unser Land" sagen werden. Und ich fand vieles, auf das wir aufbauen können und das mich dankbar und zuversichtlich für die Zukunft stimmt. In tausenden von Begegnungen habe ich in den Folgejahren auch die Kraft gespürt, die Energie, die Initiative, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes füreinander, für Demokratie, Freiheit und Fortschritt entwickeln. Und ich habe das Privileg gehabt, Deutschland mit den Augen von anderen zu sehen. Bei den zahlreichen Reisen ins Ausland habe ich den Respekt, manchmal sogar die Bewunderung erlebt, die unserem freien und stabilen Land entgegengebracht werden. // Ja: Wir leben in einer Republik, die persönliches Glück und Fortkommen ermöglicht und die Freiheit mit Chancengerechtigkeit und sozialem Ausgleich zu verbinden sucht. Das Recht ist nicht in der Hand der Macht. Verwaltungs- und Verfassungsgerichte garantieren, dass die Bürger ihre Rechte gegenüber dem Staat geltend machen können. Freie Gewerkschaften gestalten die Arbeitswelt mit, ebenso eine Unternehmerschaft, die weitestgehend eine gesellschaftliche Mitverantwortung akzeptiert und übernimmt. Soziale Marktwirtschaft, Kultur und die Künste können sich entfalten, freie Medien in großer Vielfalt beflügeln die Diskurse und fördern die Meinungsbildung. Und dann, besonders erfreulich: Eine starke Bürgergesellschaft aus Initiativen, Vereinen, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen und Ad-hoc-Gruppen nimmt Einfluss auf die Gestaltung der öffentlichen Dinge. Es ist, das glaubte ich damals und das glaube ich heute, das beste, das demokratischste Deutschland, das wir jemals hatten. Aber wenn ich an die nachfolgenden Generationen denke, dann wünsche ich mir den Mut, aktuellen Herausforderungen so zu begegnen, dass dieses Land so lebenswert bleibt - am besten noch ohne einige der uns bekannten Mängel. // Nun, nach fast fünf Jahren bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen. Und dass große Anstrengungen notwendig sein werden, um es für die Zukunft stark zu machen. Deshalb möchte ich heute nicht nur fragen: Wie soll es aussehen, unser Land? Ich möchte auch fragen: Was können wir unseren Kindern und Enkeln mitgeben, damit dieses friedliebende, freie und soziale Deutschland erhalten und entwickelt werden kann? Vor allem, mit welcher Haltung kann das gelingen? // Allein schon die kleine Auswahl von Schlagzeilen aus den vergangenen zwei Jahren, die wir soeben gesehen haben, erinnert uns daran: Die Welt steckt nicht nur voller Widersprüche. Es ist auch vieles anders gelaufen, als wir uns das vor einem guten Vierteljahrhundert vorgestellt hatten - damals, als die Berliner Mauer fiel und wir den Traum von einem Europa der freien und liberalen Demokratien hegten. Ich erinnere mich noch gut an die allgemeine Euphorie, auch an meine eigene. Der Siegeszug des westlichen Gesellschaftsmodells galt als vorgezeichnet. Ein "neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit", wie es die Charta von Paris zeichnete, erschien auch mir ein Selbstläufer zu sein, fast naturnotwendig. // Stattdessen sind wir uns in Europa heute weder alle einig, noch leben wir überall in Frieden. Die Bindekraft der Europäischen Union hat deutlich nachgelassen, Zweifel im Inneren werden auch von außen geschürt. Erstmals will sogar ein Staat die Union verlassen. Die Kriege im Nahen Osten und in der Ostukraine sowie die russische Besetzung der Krim haben die begrenzten Handlungsmöglichkeiten deutscher und europäischer Außenpolitik offenbart. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror ist gewachsen. Mit dem Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten stehen wir vor Herausforderungen für die völkerrechtsbasierte internationale Ordnung und die transatlantischen Beziehungen, besonders die Nato. // Die Erwartungen vom Ende der Geschichte haben sich also längst zerschlagen - überall, auch in Europa und Deutschland. // Das Ziel war die Freiheit - nun fühlen sich einige in Freiheit bedroht oder gar verloren. // Das Ziel war ein Europa ohne Grenzen - nun erscheint einigen Offenheit als Bedrohung. // Das Ziel war ein vereinter Kontinent - nun fürchten einige den Verlust von zu viel Souveränität. // In unseren Gesellschaften wachsen Bewegungen heran, die Gegenentwürfe präsentieren, aber keine kohärenten Programme. Doch ihre Denkrichtung offenbaren sie deutlich: Sie propagieren die Rückkehr ins Nationale, die Abwehr von Fremden und Freihandel. Sie ziehen kulturelle Geschlossenheit der Vielfalt vor und präsentieren Konkurrenzmodelle zur repräsentativen Demokratie. Sie erklären sich zum alleinigen Sprecher des Volkes und attackieren das sogenannte System. Sie stellen das europäische Projekt in Frage. Einige mischen antiamerikanische und antiwestliche Reflexe mit Sympathien für die autoritäre Herrschaft in Moskau. // Wir kommen nicht umhin, uns dieser Herausforderung zu stellen: Die liberale Demokratie und das politische und normative Projekt des Westens, sie stehen unter Beschuss. // Sehr geehrte Damen und Herren, es ist, als befänden wir uns in einer Übergangssituation: das Maß - so empfinden es viele -, in dem wir mit Unwägbarkeiten konfrontiert sind, übersteigt bislang das Maß, in dem wir fähig sind, unsere Demokratie den neuen Herausforderungen anzupassen. // Jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Ein Blick in die Geschichte kann jedoch hilfreich sein. Dann sehen wir nämlich, dass sehr häufig machtvolle Ängste markante historische Umbrüche begleitet haben: die "Furcht vor der Freiheit", die Furcht vor dem Risiko, auch die Furcht vor dem Verlust identitätsstiftender Bindungen in Religion, Kultur und vertrauter Umgebung. Doch die Menschen haben es immer wieder vermocht, eine zunächst als bedrohlich empfundene Entwicklung zu ihrem Guten zu nutzen. Sie haben sich mit dem Unvertrauten vertraut gemacht, sich erweiterte Erkenntnis- und Handlungsräume erschlossen und schließlich im Neuen beheimatet. // Denken wir nur an die industrielle Revolution: Erst pflügte sie die Gesellschaft mit einer Plötzlichkeit ohnegleichen um und schuf gewaltigen Reichtum ebenso wie schreiendes Elend. Dann aber führte der Widerstand gegen den Manchester-Kapitalismus zu Revolutionen oder Sozialreformen, später zu Sozialer Marktwirtschaft und zu einem relativen Wohlstand auch für Arbeiter. Warum sollten wir historische Erfahrungen wie diese nicht ernst nehmen? // Wir wollen weiter darauf vertrauen, dass große Veränderungen sich keineswegs als unentrinnbares, überwältigendes Verhängnis erweisen müssen. Wir sind weiter überzeugt, effektive Antworten finden zu können - auf die politischen Entwicklungen genauso wie etwa auf Klimawandel, Umweltverschmutzung, Bevölkerungswachstum, selbst auf die digitale Revolution, die in nächster Zeit nahezu alle Bereiche unseres Lebens durchdringen wird und unser Bild vom Menschen stark verändern dürfte. Lassen Sie uns also Kraft schöpfen aus der bisherigen Erfahrung, dass vernunftgeleitete Wahrnehmung zu Erkenntnis und zu entschlossenem und weitsichtigem Handeln führen kann. // Entschlossenes Handeln kann schwer sein in Zeiten des Wandels, in denen das, was erst wächst, nur begrenzt erkannt werden kann und wir Unsicherheit zeitweilig aushalten müssen. Es ist auch schwer, entschlossen zu handeln, wenn sich eine Gesellschaft, die seit Jahrzehnten in Frieden und Wohlstand lebt, bequem eingerichtet hat und das Risiko scheut. // Denn es gibt ja nicht nur die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten, die unserem Land eine innere Verfasstheit von Zusammenhalt und Solidarität geben. In Teilen der Gesellschaft ist ein Anspruchsdenken gewachsen, das den Staat allein als Dienstleister sieht, von dem sie wie Kunden erwarten, dass er ihre Erwartungen und Wünsche möglichst umfassend befriedigt. Doch Demokratie ist kein politisches Versandhaus. Demokratie ist Mitgestaltung am eigenen Schicksal - in der Gemeinde, Stadt, Region, Nation. Die Demokratie baut auf den freien Bürger, der Phantasie und Verantwortung nicht abgibt an einen starken Mann oder eine starke Frau, die sagen, wo es langgeht. Demokratie erfordert, ja sie ist Selbstermächtigung: Wir, die Bürger, sind es, die über die Gestalt unseres Gemeinwesens entscheiden. Und wir, die Bürger, tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. // Schritt zu halten mit der Realität ist in Zeiten rasanter Veränderungen natürlich auch eine besondere Herausforderung für Regierungen. Wir erleben vielfältige Bemühungen, die Kontrolle zu behalten oder wiederzugewinnen und in Jetztzeit Ideen und Strategien für den Wandel zu entwickeln. Generell gilt: Wer sich in solchen Phasen versitzt in Entscheidungsschwäche und Risikoscheu, oder wer auf halbem Weg stehen bleibt, der muss unter Umständen einen hohen Preis zahlen, finanziell und, wichtiger noch, politisch, und zwar im weitesten Sinn: außenpolitisch, gesellschaftspolitisch, rechts- und sicherheitspolitisch. Nur an zwei wichtige aktuelle Problemfelder sei erinnert: // Es ist gelungen, die Zahl der Flüchtlinge und illegalen Einwanderer nach Europa und nach Deutschland deutlich zu reduzieren. Aber wir alle wissen: Ohne eine effiziente Sicherung der europäischen Außengrenzen, ohne eine geregelte europäische Einwanderungspolitik und letztlich ohne Verbesserung der Lebenssituation in Herkunftsländern werden krisenhafte Zuspitzungen auch in Zukunft zu erwarten sein. Und manche europäische Gesellschaften könnten mit Aufnahme und Integration einer großen Anzahl von Flüchtlingen und Migranten überfordert sein. // Auch ist es unter enormer Anstrengung gelungen, für die Stabilisierung des Euro Instrumente zu entwickeln, um die Gemeinschaftswährung nicht preiszugeben. Aber wir alle wissen, dass die Zukunft der gemeinsamen Währung wohl auf längere Sicht am besten mit einer gemeinsamen Haushalts- und Finanzpolitik zu sichern wäre. // Entschlossenes und weitsichtiges Handeln generiert Vertrauen. Wenn aber für Teile der Bevölkerung die Regierenden nicht mehr Herr der Lage sind, haben Populisten einen Grund mehr, Zweifel an der liberalen Demokratie zu säen. // Keinesfalls sollte allerdings geschehen, wovor der amerikanische Politologe Francis Fukuyama warnt: dass der Begriff Populismus zu einem Etikett wird, "mit dem politische Eliten die bei ihnen unbeliebten politischen Ansichten einfacher Bürger versehen" und pauschal aus dem Diskurs ausgrenzen. // Ja, die Einbeziehung von Positionen und Themen, die von der politischen Mitte kritisch beäugt werden, verschärft die Debattenlage - aber sie kann hilfreich sein, denn sie erhöht mittelfristig die Akzeptanz demokratischen Regierens. Dies ist es doch, was wir wollen: Eine repräsentative Demokratie soll möglichst viele Bürger repräsentieren. Was natürlich nicht bedeutet, Ressentiments zu adeln und Vorurteilen den Rang von Argumenten einzuräumen. // Ich denke: Wir müssen eine Kommunikation wagen, die deutlich stärker als bisher die Vielen einbezieht und nicht nur die, die regelmäßig am politischen Diskurs teilnehmen. Austausch und Diskussion sind der Sauerstoff der offenen Gesellschaft, Streit ihr belebendes Element. Das mag so manchem nicht gefallen, aber daran zu erinnern, erscheint mir gerade jetzt als angemessen. // Die Vielzahl von Lebensentwürfen hat in unserer Gesellschaft eine Vielzahl von Milieus mit jeweils eigenen Kommunikationswegen hervorgebracht. Pluralität existiert oft nicht mehr in einem Miteinander, sondern einem unverbundenen Neben- oder sogar Gegeneinander. Umso wichtiger ist es, der Zersplitterung entgegenzuwirken, und zwar möglichst in Begegnungen mit Menschen, die anders denken als man selbst. Eine substanzielle Auseinandersetzung ist oft die Vorstufe eines Kompromisses und der Ausgangspunkt von Veränderung - und damit der Entwicklung der Demokratie. // Darum schließe ich mich dem fast paradoxen Vorschlag des britischen Historikers Timothy Garton Ash an, der für die Diskussionskultur eine "robuste Zivilität" fordert. Was meint: Heftig streiten, aber mit Respekt und mit dickem Fell. Heftig streiten auch, füge ich hinzu, aber wie im Sport unter Anerkennung von Regeln. // Die Demokratie ist ein großes Zelt. Für mich endet das Miteinander in ihm erst dort, wo Parteien, Bewegungen oder Individuen die Normen und Gesetze der Demokratie übertreten. Wo sie Hass predigen und Gewalt ausüben - egal, ob aus rechts- oder linksextremistischer, aus islamistischer oder sonst irgendeiner Motivation heraus. // Wir leben in rauen Zeiten: Oft ist nicht mehr erkennbar, was wahr ist und was falsch. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird fast grenzenlos gelogen, beschimpft, verletzt. Ausländische Mächte betreiben zudem gezielt Informationskriege zur Destabilisierung anderer Staaten. Das fällt umso leichter, als Emotionen für die Meinungsbildung oftmals entscheidender geworden sind als Fakten. Wir sollten uns aber vor Augen führen: Wenn wir nur noch das als Tatsache akzeptieren, was wir ohnehin glauben, wenn Halbwahrheiten, Interpretationen, Verschwörungstheorien, Gerüchte genauso viel zählen wie Wahrheit, dann ist der Raum freigegeben für Demagogen und Autokraten. // Nur wenn wir an Tatsachen, wenn wir an der Wahrheit festhalten, lässt sich Macht bewerten und - wo erforderlich - kritisieren. Lassen wir es nicht dazu kommen, dass sich Macht wieder ohne das wahrheitsgestützte Argument durchsetzt. Verteidigen wir stattdessen die Demokratie als eine Macht, die sich dem Argument anvertraut und sich von ihm leiten lässt. // Sehr geehrte Damen und Herren, kürzlich gestand mir eine Bekannte, dass sie an einem ruhigen Abend das Grundgesetz aus dem Bücherregal gezogen und es gelesen habe - noch einmal, ganz bewusst. Und zu ihrer eigenen Überraschung habe die Lektüre nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz erreicht. Sie habe plötzlich Stolz auf die Vorfahren verspürt, die Deutschland nach so vielen Jahren der Kriege und der Diktatur auf eine demokratische Grundlage gestellt haben. Und sie habe sich innerlich gestärkt gefühlt, weil ihr bewusst geworden sei, wie modern das Grundgesetz nach wie vor ist und warum seine Normen und sein Geist weiterhin als Richtschnur für Denken und Handeln dienen können. // Diese Frau hat sich an jenem Abend neu als politisch zugehörig empfunden. Zugehörig zu einer Bürgergesellschaft, die jene Werte und Institutionen schätzt, die unserem Land Freiheit, Wohlstand, Rechtssicherheit, soziale Absicherung und Frieden gebracht haben. Zugehörig zu Bürgern, die bereit sind zu vertreten und zu verteidigen, was sie nicht verlieren wollen, weil es ihnen lieb und wert ist. // Ich erwähne dieses Beispiel, weil es ein kleiner Beleg dafür ist, dass das in der akademischen Welt geborene Wort Verfassungspatriotismus nicht nur ein Theorem ist, sondern Lebenswirklichkeit sein kann - überall dort, wo Menschen diese Form der Geneigtheit gegenüber der Demokratie empfinden. Sie widerlegt all jene, die den Verfassungspatriotismus für ein blasses, ein blutleeres Konstrukt halten, einen Notbehelf aus den Zeiten der geteilten und moralisch diskreditierten Nation. // Auch meine eigene Bindung an die Verfassung, mein eigener Verfassungspatriotismus resultiert nicht nur aus intellektueller Einsicht, sondern ebenso aus emotionaler Berührtheit. Dieses Land ist die Heimat meiner Werte - es ist es geworden. Besonders deswegen fühle ich mich hier zugehörig, zuhause. // Wie viele meiner Generation habe ich Vertrauen und Zugehörigkeit zu Deutschland entwickeln können, als es nicht mehr vor der eigenen Schuld weglief, sondern eine existenzielle Selbstbefragung wagte. Letztlich sind es das Demokratiewunder im westlichen Nachkriegsdeutschland und das spätere Ja der Ostdeutschen zur Demokratie mit der Friedlichen Revolution, die mich als Verfassungspatrioten in diesem so gewordenen Deutschland beheimateten, mit meinem Herzen wie mit meinem Verstand. Teilte ich doch mit unzähligen anderen Menschen die Erfahrung, dass die Ziele unserer Sehnsucht, dass Freiheit und Selbstbestimmung tatsächlich politische Wirklichkeit wurden. // Als Verfassungspatriot bleibe ich allerdings auch Deutscher. Ich lebe mit unserer Sprache, mit unseren Liedern und mit unserer Literatur. Ich lebe mit unseren wunderschönen Landschaften und mit unserer wechselvollen Geschichte. Eine demokratische Verfassung mit universellen Werten zu schätzen heißt ja nicht, die eigene Kultur abzustreifen oder historisch gewachsene Eigenheiten zu ignorieren. // Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nur an die Herausbildung unseres auch verfassungsmäßig verankerten Sozialstaates erinnern - eine Errungenschaft, um die uns manch ein anderer Staat in der Welt beneidet. Sozialistische und sozialdemokratische Vorstellungen haben sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mit konservativen Ideen eines christlichen Menschenbildes verbunden: Durch staatliche Umverteilung sollte jenen geholfen werden, die in Not gerieten. Bismarcks Kranken- und Unfallversicherung, so unzureichend sie auch sein mochte, machte Deutschland weltweit zum Vorreiter eines staatlichen Sozialsystems, das sich historisch stetig weiter entwickelte. // Vor 45 Jahren sagte Willy Brandt: "Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land!" Das gilt ganz besonders für den inneren Frieden, den wir nicht zuletzt aufgrund unseres Sozialstaates, aber auch durch wachsende Chancengerechtigkeit geschaffen haben. Unser Land kann nicht jedem Bürger einen gefüllten Tresor schenken, aber es ist unerlässlich, den vielen Verschiedenen unterschiedslos die gewünschte Bildung zu ermöglichen. Das ist leider heute noch nicht überall der Fall. Aber wir sind auf dem Weg zu mehr Chancengerechtigkeit schon ein gutes Stück vorangekommen. Diese und andere kostbare Errungenschaften dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir müssen erhebliche Phantasie und großen Willen aufwenden, um sie für nachkommende Generationen zukunftsfest zu gestalten. // Von unseren historischen Erfahrungen geprägt sind auch andere Kernbereiche des Grundgesetzes. Unter dem Eindruck der Weimarer Republik, die sich als wehrlos gegenüber dem Aufstieg des Nationalsozialismus erwies, haben die Schöpfer des Grundgesetzes eine eindeutige Richtungsentscheidung getroffen. Die neue deutsche Demokratie sollte nicht schwach, sondern wehrhaft sein. Sie sollte - so sagte es Carlo Schmid, einer der großen Politiker der Nachkriegszeit - "auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen." // Unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, der jede Opposition verfolgte und das Individuum einem diktatorischen Regime unterwarf, hat sich bei vielen aber auch die Furcht vor einem starken Staat gehalten. Liberale Grundrechtsverteidiger etwa befürchten, verstärkte Sicherheitsbestimmungen könnten die individuellen Freiheitsrechte zu stark einschränken. Wir stehen vor einem Dilemma: Ja, die Freiheit schränkt ein, wer der Sicherheit unverhältnismäßig viel Raum einräumt. Aber der Rechtsstaat verliert, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweist. Nicht zuletzt verliert er seine Vertrauenswürdigkeit. Lassen Sie mich daran erinnern: In Deutschland existiert ein kostbares, keineswegs selbstverständliches Gut - die weit verbreitete Rechtstreue der Bevölkerung. Diese Haltung ist entstanden, weil sich die Menschen auf die ordnende und schützende Hand des Staates verlassen konnten. Es gehört zu den herausragenden Aufgaben des demokratischen Staates, dieses wertvolle Gut zu erhalten. Insofern ist es doch gegenwärtig so, dass mehr Sicherheit keine Gefahr für die Demokratie bedeutet, als vielmehr ein Erfordernis zu ihrem Schutz. // Wir brauchen eine engere internationale Zusammenarbeit und eine effektivere Gefahrenabwehr im Innern. Was wir allerdings ganz besonders brauchen, ist wirksame Prävention durch politische, kulturelle und religiöse Bildung, so dass Menschen gar nicht erst in den Bann von Extremisten gleich welcher Couleur geraten. Wir brauchen Demokratieerziehung, weiterhin und noch intensiver als bisher - beginnend in den Familien, dann aber auch in den Kindergärten, Schulen, Integrationskursen, Universitäten bis hinein in die Medien, auch und gerade im Internet. // Demokratie lernen und leben - als Respekt vor dem Anderen. // Demokratie lernen und leben - als Verantwortung für das Gemeinwesen. // Demokratie lernen und leben - als ständige Selbstermächtigung zur politischen Teilhabe. // Demokratie ist nicht einfach nur, Demokratie wird. Sie lebt, und sie ist lernfähig. Neue Themen, neue Generationen und neue Kommunikationswelten erfordern immer wieder neue, der Zeit und den Erfordernissen angepasste Antworten. So hat der Staat etwa den Schutz von ethnischen, religiösen und sexuellen Minderheiten in das demokratische Gefüge eingebaut. Er hat neue Gebiete des Rechts erschlossen mit dem Datenschutzrecht, dem Umweltrecht, und steht jetzt vor der großen Herausforderung zur Regelung der digitalen Technologie. Die Mühlen der Demokratie mahlen vielleicht langsam, aber die Geschichte zeigt, dass trotz mancher Rückschläge kein anderes System politisch und ökonomisch so anpassungsfähig, so effektiv und damit so erfolgreich ist wie eben die Demokratie. // Meine Damen und Herren, die Mütter und Väter unserer Verfassung wollten nicht nur eine wehrhafte und eine streitbare Demokratie, sie wollten auch eine wertebasierte Demokratie. Sie setzten sich Frieden und Gerechtigkeit zum Ziel und stellten den Schutz der Menschenwürde unter eine Ewigkeitsklausel, die jede Veränderung ausschließt. So haben wir nun beides: eine unverbrüchliche, geschützte Grundlage für unsere Demokratie und einen offenen Raum, in dem Pluralität leben soll. Dieses dialektische Miteinander von Bindung und Freiheit hat im Laufe der Jahrzehnte noch an Bedeutung gewonnen. Denn die Gesellschaft ist sehr viel heterogener geworden - politisch, kulturell, religiös, ethnisch und auch in Hinsicht auf die Anerkennung sexueller Orientierung. // Im jungen Einwanderungsland Deutschland ist dieses Wechselspiel von Bindung und Freiheit immer noch und immer wieder eine Herausforderung. So sind Einheimische und Eingewanderte einerseits verpflichtet, in gleicher Weise die Verfassung und die Gesetze zu achten. Andererseits ist es Einheimischen und Eingewanderten überlassen, nach eigenen kulturellen oder religiösen Überzeugungen zu leben - so, wie sie es individuell für richtig halten und solange sie nicht die Freiheit des Anderen einschränken. // Für ein gedeihliches Zusammenleben ist aber die Bereitschaft zur Offenheit erforderlich: von den Einen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, von den Anderen gegenüber den Minderheiten. Die Einen müssen Teilhabe wollen, die Anderen Teilhabe ermöglichen. Was keinen Platz hat in diesem Miteinander, das sind Verunglimpfung, Hetze, Ausgrenzung, Hass, und erst recht keine Gewalt gegenüber den Eingewanderten. Andererseits darf die Angst vor dem Vorwurf des Rassismus nicht dazu führen, dass wir Intoleranz und Normenverletzungen unter Einwanderern verschweigen oder die Diskussion darüber unterlassen, welches Islamverständnis zu einer säkularen, demokratischen Gesellschaft passt. // Lassen Sie es mich so sagen: Die entscheidende Trennlinie in unserer Demokratie verläuft nicht zwischen Alteingesessenen und Neubürgern, auch nicht zwischen Christen, Muslimen, Juden oder Atheisten. Die entscheidende Trennlinie verläuft zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten. Es zählt nicht die Herkunft, sondern die Haltung. Gerade unter den Einwanderern finden sich viele, die unser Land hoch zu schätzen wissen, weil sie hier zu Wohlstand gekommen sind und hier in Frieden, Freiheit und Rechtssicherheit leben können, fern ihrer Heimat und doch am Ziel so mancher Sehnsucht. // Sehr geehrte Damen und Herren, wer die Demokratie liebt, wird sie schützen, nicht allein gegen die Feinde der offenen Gesellschaft im Inneren. Wer die Achtung der Menschenwürde zu einem Wesenskern der eigenen Verfassung macht, wird Mitverantwortung übernehmen auch für den Fortbestand einer internationalen Ordnung, deren Kern gemeinsame Normen und Werte und deren Ziel die Aufrechterhaltung von Frieden und Recht sind. // Wir wissen längst: Deutschland kann sich nicht zur Insel machen, kann sich nicht abschotten von der Welt, kann sich nicht zurückziehen ins Nationale. Frieden und Wohlergehen im eigenen Land sind untrennbar verwoben mit Frieden und Wohlergehen andernorts, verwoben mit internationalen Organisationen und militärischen Bündnissen, deren Mitglied Deutschland ist. Was etwa in China geschieht, hat Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland. Es träfe uns auch unmittelbar, wenn die Vereinigten Staaten ihre Haltung zur Europäischen Union oder dem westlichen Sicherheitsbündnis tatsächlich verändern sollten. // Jeder Tag konfrontiert uns zudem aufs Neue mit der Tatsache, dass das, was sich etwa in Syrien zuträgt, Einfluss hat auf Fluchtbewegungen nach Deutschland. Und dass das, was etwa in Maghreb-Staaten geschieht, die Terrorgefahr in Deutschland erhöhen kann. // Jeder Tag stellt uns zudem vor die Frage, ob wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir uns nicht wenigstens den dramatischsten Fällen von Inhumanität und brutaler Verfolgung sowie der Vernichtung von Menschenleben auf der Welt entgegenstellen. Wir müssen uns fragen, ob wir moralisch abstumpfen, in Fatalismus oder Zynismus verfallen und damit den Anspruch auf die universelle Geltung der Menschenrechte untergraben. // Auch auf internationaler Bühne gilt: Wer entschlossenes und reflektiertes Handeln durch Zuwarten ersetzt, überlässt anderen das Gesetz des Handelns. Nicht zuletzt durch amerikanische Selbstbeschränkung entstehen Zonen, in denen sich Mächte neu gruppieren oder neue Ansprüche anmelden. Sich autoritär gebende Staatenlenker sind längst dabei, eigene Regeln zu diktieren, anerkannte Normen internationaler Zusammenarbeit ihrer Machtpolitik unterzuordnen und eigene Ordnungen zu schaffen. // Deutschland - und doch eigentlich die ganze Europäische Union - kann zusehen und Schadensbegrenzung betreiben. Oder Deutschland, als starker und verantwortungsvoller Partner in der Union, kann mehr Gestaltungswillen als bisher für das größere Ganze aufbringen. Wir können? Nein, wir müssen! Wir müssen mehr tun, um gemeinsam mit anderen Ordnung zu erhalten, Konflikten vorzubeugen, Krisen zu entschärfen und Gegner abzuschrecken. Das heißt auch: Wir müssen mehr tun, um die Europäische Union zu stabilisieren und den inneren und äußeren Versuchen, sie zu spalten, entgegenzuwirken. // Trotz mancher Selbstzweifel und interner Krisen: Mit der Europäischen Union ist ein einzigartiges Friedens- und Wohlstandsprojekt entstanden. Deutschland und die meisten anderen europäischen Staaten sind überzeugte Mitglieder der Nato, deren Bedeutung angesichts der augenblicklichen Entwicklung nicht ab-, sondern wieder zunimmt! Deutschland und die Europäische Union sind gewichtige Stimmen in der Welt. Und sie haben allen Grund, sich selbstbewusst für den Schutz einer internationalen Ordnung einzusetzen, die auf der Idee von Frieden, Demokratie und Menschenrechten gründet. Angesichts der vor uns liegenden gewaltigen Herausforderungen können und dürfen wir Europäer, wir Deutschen uns dieser Verantwortung nicht entziehen. // In den vergangenen Jahren ist schon einiges geschehen. Ein Mentalitätswandel hat eingesetzt. Der politische Wille zu wirksamem und effektivem Engagement ist gewachsen. Die Bundesregierung hat verschiedenste Instrumente entwickelt, um auf Krisen zu reagieren, und sie gibt dafür auch mehr Geld aus. // Trotzdem kommt Deutschland gegenwärtig bei weitem noch nicht allen Verpflichtungen nach. Ich unterstütze deshalb, dass wir einhalten, was wir unseren Partnern und Freunden zugesagt haben. Gemessen an den Herausforderungen unserer Zeit und an unseren Möglichkeiten, könnten und sollten wir deutlich mehr tun: für Krisenprävention und Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit und Missionen der Vereinten Nationen, auch für eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit im westlichen Bündnis. Denn die Aussage, es könne niemals eine militärische Lösung geben, klingt gut und ist gut, allerdings nur, solange sich alle Seiten an diese Maxime halten. Ich unterstütze daher verstärkte europäische Verteidigungsbemühungen, was weitere diplomatische Bemühungen um Deeskalation keineswegs ausschließt. Und ich trete ein für eine unzweideutige Klarstellung gegenüber unseren osteuropäischen Verbündeten: Die Beistandspflicht der Nato gilt ohne Abstriche. // Niemand muss sich sorgen, dass Deutschland seinen Charakter als friedliebendes und dialogbereites Mitglied der internationalen Gemeinschaft verliert. Im Gegenteil: Es geht darum, die Bedingungen für Friedfertigkeit und Dialogbereitschaft zu erhalten. Dafür muss sich Deutschland engagieren, wenn das eigene Land und andere europäische Staaten nicht zum Spielball der Interessen jener werden sollen, die ganz andere Ziele verfolgen. Das ist der Kern der wehrhaften Demokratie, das ist republikanische Verteidigungsbereitschaft. // Meine Damen und Herren, nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht absehbar, dass Deutschland wieder integraler Bestandteil der abendländischen Zivilität werden könnte. Und mussten die Baumeister der frühen Bundesrepublik noch daran zweifeln, ob die tief gefallenen Deutschen jemals wahre Demokraten werden könnten, so haben die Nachgeborenen aus dem Wissen um die Schuld ihrer Vorfahren eine besondere Verantwortung, ja, Verpflichtung verspürt, ein glaubwürdiges, verlässliches und damit gegen Verführung immunes Ja zur neu erstandenen Demokratie zu leben. Es sollte nie wieder ein nationalistisches, sondern ein europäisches Deutschland sein, das sie gemeinsam erbauten und in dem auch die Ostdeutschen ihren Platz erstrebten und später fanden. // Selbstvertrauen haben wir lange nicht leben wollen. Zu nah schien es uns an einem Gefühl unaufgeklärten Stolzes. Und so entstand die dominierende Kultur von Zurückhaltung und Selbstbeschränkung. Aber wann, wenn nicht mit dem Aufbau der Demokratie in Westdeutschland und der Friedlichen Revolution im Osten, mit der Vereinigung Deutschlands und Europas hätte es bessere Gründe für ein gesundes Selbstvertrauen gegeben? // Wenn wir übersehen, welche Potenziale in uns stecken, werden wir verharren in einer ewigen politischen Warteschleife - in einer unheilvollen Kultur von Ängstlichkeit, Indifferenz und Selbstzweifel. Bis andere, mit anderen Werten und ganz ohne Selbstzweifel, Hand an unsere Lebenswelt, an unsere Freiheit legen. // Wenn ich mich nun frage, was das Wichtigste ist, das wir unseren Kindern und Kindeskindern mit auf den Weg geben, so ist es für mich vor allem eine Haltung: Es ist das Vertrauen zu uns selbst, das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Wir bleiben gelassenen Mutes. // Mögen die Ängste uns auch begleiten: Wir lassen uns das Vertrauen zu uns selbst und zu unserer Demokratie nicht nehmen. // Mögen die Verführer auch den Talmiglanz eines abgelebten Nationalismus preisen: Wir bleiben Deutsche als Europäer. // Mögen die Unwägbarkeiten der Zeit auch erschrecken: Wir fliehen nicht vor der Verantwortung. // So entschieden wie wertetreu geben wir eine tiefe, in uns gewachsene Überzeugung weiter: Das, was wir geschaffen haben und was uns am Herzen liegt, werden wir bewahren, entwickeln und verteidigen.
-
Angesichts dieses in jeder Hinsicht herausragenden Gästekreises möchte ich Sie alle - gewissermaßen praemissis praemittendis - als Freunde und Wegbegleiter des Jubilars ganz herzlich willkommen heißen. // Wenn der Bundespräsident eine Tischrede zu Ehren von Helmut Schmidt hält, dann sieht er sich vor eine doppelte Herausforderung gestellt. Zum einen ist schon so viel über den Staatsmann und politischen Publizisten, den Menschen Helmut Schmidt gesagt worden, dass der Jubilar, der Redner und die Zuhörer die Wiederholung fürchten müssen. Zudem ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, alle Verdienste Helmut Schmidts in einer menschenfreundlichen und dazu noch protokollarisch vorgegebenen Zeit zu würdigen und dabei dann auch noch seiner Persönlichkeit nur annähernd gerecht zu werden. // Ich möchte Ihnen deshalb an diesem heutigen Abend nur das mitteilen und sagen, was mich persönlich an Helmut Schmidt beeindruckt hat, in all den Jahren, in denen ich sein Wirken aus der Ferne und Nähe nun verfolge. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich mit dem Weg zur deutschen Einheit beginne. // Das erste Mal bin ich Ihnen, lieber Herr Schmidt, in Rostock begegnet, meiner Heimatstadt, das war auf dem Kirchentag im Juni 1988, wie auch Ihnen, liebe Frau Hamm-Brücher, Sie waren auch dort. Damals, als Deutschland und Europa noch geteilt waren, die Zeit der Perestroika aber bereits angebrochen war, damals hielten Sie eine Rede in der Rostocker Marienkirche, allem Widerstreben der SED zum Trotz. Denn erst nach hartnäckigen und zähen Verhandlungen und Zurückweisung der Forderung der SED, wir, Kirche und Kirchentag, sollten Sie wieder ausladen, was wir nicht taten, sind Sie dann doch nach Rostock gekommen. Weit mehr als 2.500 Menschen waren damals in die Marienkirche gekommen, um Ihnen zuzuhören, und man empfing Sie so, wie man eben ein Idol empfängt. Ein Offizier der Stasi fasste das, was sich bei Ihrer Begrüßung abspielte, laut Stasi-Akten in fünf Wörtern zusammen: "Jubelrufe, lang anhaltender stürmischer Beifall." // Ihre Rede damals gab der Christen- und Bürgergemeinde Kraft. Es war vor allem ein Satz, der vielen, die dabei waren, in Erinnerung geblieben ist. Sie sagten damals: "Jeder von uns weiß, dass wir eine Aufhebung der Teilung nicht erzwingen können. ( ) Und trotzdem darf jeder von uns an seiner Hoffnung auf ein gemeinsames Dach über der deutschen Nation festhalten." Was wir damals noch nicht wussten: Genau in dieser Kirche versammelten sich dann ein Jahr später, 1989, die Rostocker, um jeden Donnerstag mit dem Wort Gottes und den neuen politischen Programmen gegen die kommunistische Diktatur zu protestieren. Und während sie das taten, verwandelten sie sich von Untertanen in Bürger. // Damals hat sich eine Hoffnung erfüllt, zu der wir 1988 noch gar kein rechtes Zutrauen hatten. Seitdem hat sich unendlich viel verändert. Eines aber, lieber Helmut Schmidt, ist unverändert geblieben: Auch heute hören Ihnen die Menschen zu, auch heute bringen sie Ihnen großen Respekt entgegen. Einer Umfrage zufolge sind Sie sogar "das größte lebende Vorbild der Deutschen". // Schon viele haben versucht, das Phänomen Helmut Schmidt zu ergründen. Ich will mich da lieber nicht einreihen. Was ich aber tun möchte, ist, Ihnen zu sagen, warum ich mich freue, Sie heute hier in Schloss Bellevue zu Gast zu haben. Ich freue mich, weil ich Ihre Erfahrung schätze, Ihre politische Urteilskraft und Ihre geistige Unabhängigkeit. Und weil viele Stationen Ihres Lebens auch für mich bedeutsam waren, als Bewohner der DDR und später als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, die fast ein ganzes Jahrhundert erlebt und reflektiert hat."Unser Jahrhundert" - so nannten Sie Ihre Rückschau, die Sie zusammen mit Fritz Stern 2010 veröffentlicht haben. Uns begegnet ein Mann mit republikanischen Werten - zuvörderst aber mit einem deutlichen Ja zu politischer Verantwortung und ausgestattet mit einer im politischen Raum nicht eben häufigen Tugend, dem Mut. // Besonders beeindruckend finde ich, wie offen Sie im Rückblick auch über schwierige Gewissensentscheidungen gesprochen haben. Noch im Zweiten Weltkrieg, in dem Sie als Offizier der Wehrmacht kämpften, standen Sie vor der quälenden Frage: Wann endet die Pflicht zum Gehorsam gegenüber dem Staat, wann beginnt die individuelle Verantwortung und wo die Schuld? // Die Erfahrungen von nationalistischer Hybris, von Krieg und Massenmord haben Sie, wie viele Zeitgenossen, zu einem überzeugten Europäer gemacht. Bei Ihrem Geburtstagsfest im Hamburger Thalia Theater sagten Sie Anfang des Jahres: "Ich wünsche mir, dass die Deutschen begreifen, dass die Europäische Union vervollständigt werden muss - und nicht, dass wir uns über sie erheben." Dass Sie dies sagten, gerade Sie, das hat Gewicht. Ich bin mir sicher: Ihre Denkanstöße leisten einen wichtigen Beitrag, im Vorfeld der Europawahlen im Mai und hoffentlich weit darüber hinaus. // Lassen Sie mich noch einmal zurückschauen in eine schwierige Phase Ihres Lebens. // Als Bundeskanzler sahen Sie sich, vor allem im "Deutschen Herbst" des Jahres 1977, mit dem Terrorismus der Roten Armee Fraktion konfrontiert und vor die Frage gestellt: Darf sich ein demokratischer Staat erpressen lassen, darf er Gefangene gegen Geiseln austauschen? Was soll man tun, wenn die Staatsräson in Konflikt gerät mit dem Leben von Einzelnen? Sie haben damals mit Ihrem Gewissen gerungen, und ich bewundere Sie für einen Satz, der so einfach klingt und einem doch so schwer über die Lippen kommt: Er lautet: "Ich bin verstrickt in Schuld." // Dies sehr klar zu erkennen und zu benennen und gleichwohl die beständige Pflicht zum Handeln zu akzeptieren, zeichnet einen großen Politiker aus. // Lieber Herr Schmidt, Sie haben immer wieder Mut und Pflichtbewusstsein, Führungskraft und Standfestigkeit bewiesen, auch in Situationen, die Sie persönlich und politisch an Ihre Grenzen brachten. Der NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel war im ganzen Land, auch in Ihrer Partei, der SPD, heftig umstritten - aber die Geschichte hat Ihnen Recht gegeben. Sie haben erlebt, wie es ist, wenn man in der Politik nicht wegen eines Versagens, sondern wegen einer politischen Entscheidung plötzlich den Rückhalt verliert, wenn es einsam wird auf dem Gipfel der Macht. Sie haben auch erlebt, was es ausmacht, die Gestaltungsmacht zu verlieren und die Regierungsverantwortung dann dem politischen Gegner zu überlassen. Sie kennen den bitteren Geschmack der politischen Niederlage. Sie wissen besser als ich, dass solche Lebensphasen auch eine Einladung enthalten. Eine dunkle Einladung zu Fatalismus, Pessimismus oder gar zu Zynismus. // Sollte Ihre Psyche jemals solche Einladungen erhalten haben, so haben Sie es vermocht, sie auszuschlagen. // Später, außer Dienst, als politischer Publizist und Herausgeber der ZEIT, haben Sie sich immer wieder in die öffentlichen Debatten eingemischt, und das tun Sie bis heute. Ihre Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Moral, orientiert an Ihren vier"Hausapothekern" Marc Aurel, Immanuel Kant, Max Weber und Karl Popper, haben das politische Denken dieses Landes beeinflusst. Sie sind ein Verteidiger unseres parlamentarischen Systems, der nicht müde wird, den friedlichen Meinungsstreit und den Kompromiss als demokratische Tugenden zu würdigen und für pragmatische, verantwortungsvolle Politik zu werben. // Wer Ihr publizistisches und politisches Lebenswerk in der Gesamtschau betrachtet, der ist überwältigt von der thematischen Vielfalt. Einer Ihrer"Hausapotheker", Marc Aurel, dessen "Selbstbetrachtungen" Sie als Soldat stets im Tornister trugen, hat einmal geschrieben: "Tue nichts widerwillig, nichts ohne Rücksicht aufs allgemeine Beste, nichts übereilt, nichts im Getriebe der Leidenschaft." Das klingt in meinen Ohren - verzeihen Sie - stark nach Helmut Schmidt - nach einem Mann, der sich ganz der Sache hingibt, sorgfältig arbeitet, auch viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Ein Arbeitsethos übrigens, das auch geeignet ist, einem gefährlichen Vorurteil zu begegnen: dem Vorurteil nämlich, Politik sei ein dubioses Geschäft, das vor allen Dingen von Leichtgewichten betrieben werde. // Fleiß, Pflicht und Vernunft, Weber und Kant, das alles klingt erst mal kühl, rational, streng. Ich glaube, zu Ihrer Beliebtheit heute hat ebenso eine andere Seite Ihrer Persönlichkeit beigetragen, die es seit langem gibt. Ich meine den Mut, die eigene Meinung deutlich und ohne andauernde Rückversicherung zu sagen. Manchmal durchaus eigensinnig, dann wieder hinreißend sozialdemokratisch. Ein Weltbürger mit universellen Interessen - und zugleich immer in Hamburg-Langenhorn -, bodenständig und beständig brahmseeverbunden. Ich schweige von Sturheit, möglicherweise norddeutsch, denn ich möchte nicht vom Rauchen sprechen. // Lieber Herr Schmidt, nun zum Schluss muss dann aber der Satz kommen, auf den ich mich schon lange gefreut habe und den ich als Präsident der Bundesrepublik Deutschland mit großer Dankbarkeit ausspreche: Sie haben sich verdient gemacht um unser Land. Ihr tätiges Leben für unsere Republik, Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - all das macht Sie zu einem Vorbild für aktuelle und künftige Politikergenerationen. Die Demokratie braucht Menschen wie Sie. // Bitte erheben Sie Ihr Glas auf Helmut Schmidt und Frau Ruth Loah. Auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohl!
-
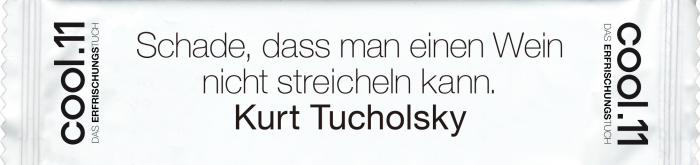
-
Auch wenn Martin Buber nicht in Heidelberg studiert und gelehrt hat, so sind wir doch an einem passenden Ort, um seiner zu gedenken, der so intensiv mit dem Geistesleben in Deutschland verbunden war. // Wir sind hier in dieser altehrwürdigen Universität, deren philosophische und theologische Tradition Weltruhm genießt. Und dann sind wir auch in der Stadt, die seit mehr als 30 Jahren Sitz einer Hochschule für jüdische Studien ist, die ich heute auch noch besuchen werde. // In Martin Bubers Leben und Werk finden wir beides: auf der einen Seite die große europäische, akademische Tradition des philosophischen und theologischen Denkens, gepaart mit der sprachlichen Kraft des gelehrten Übersetzers, und auf der anderen Seite die gelebte Tradition des Judentums, gerade mit dem östlichen, dem chassidischen Erbe. // Martin Buber, der schon äußerlich mit seinem weisen, aber unbestechlichen Blick und seinem bedeutenden Bart wie ein von Michelangelo oder Dürer gemalter Prophet erschien: Er scheint aus der Tiefe längst vergangener Zeiten zu kommen - und dennoch hat er eine Botschaft, die für die Gegenwart wichtig ist. // Aus längst vergangenen Zeiten: Martin Buber war zu Hause in der Welt der hebräischen Bibel, der er, zusammen mit Franz Rosenzweig, eine deutsche Gestalt gab, wie es sie vorher noch nicht gegeben hatte. // Ich denke jetzt auch an meine eigene Begegnung mit dieser Übersetzung. In der Zeit, als ich in meiner Heimatstadt Rostock Theologie studierte, gab mir ein literatur- und sprachkundiger Assistent diese Übersetzung und ich staunte. Ich kannte die Texte eigentlich doch alle! Aber in seiner Sprache fasste mich die Botschaft des Alten Testaments noch einmal völlig neu und ganz anders an. Es war eine unglaublich bewegende Begegnung mit einem Text, von dem man meinte, er hätte schon alles zu einem gesagt. Das ist meine persönliche Erinnerung an diesen Ausschnitt seines Wirkens. // Die Kraft des Hebräischen, die Bildhaftigkeit und die grammatische Fremdheit jener Sprache, in der zum ersten Mal die Lehre vom einen Gott Ausdruck fand, die hat er auf eine unerhörte Weise ins Deutsche gebracht. Immer neu muss man das lesend begreifen, diese Verwandlung von Fremdheit in Nähe - und begreift so, dass das Heilige eben beides zugleich ist: vertraut und verstörend, erschreckend und faszinierend. // Aus längst vergangenen Zeiten: Welch eine Generation jüdischer Gelehrter ist, wie Buber, um die Wende zum 20. Jahrhundert geboren worden. Die Muttersprache ihres weltverändernden Denkens war deutsch, und doch sind sie von Deutschland vertrieben worden oder vor Verfolgung ins Exil geflohen. Wir denken an Franz Rosenzweig aus Kassel, Gershom Scholem aus Berlin, Hannah Arendt aus Linden bei Hannover, Walter Benjamin aus Berlin, Erich Fromm aus Frankfurt, Ernst Bloch aus Ludwigshafen, Max Horkheimer aus Zuffenhausen, Hans Jonas aus Mönchengladbach, und wer nicht noch alles: Karl Popper, Ernst Fraenkel, darunter manch einer, der, wie Adorno sagte, erst durch Hitler sein Judentum entdeckt hatte. // Der jüdische Geist, dem wir alle so viel verdanken, er sollte vertrieben und vernichtet werden, jener jüdische Geist, den auf so besondere Weise Martin Buber studierte, lehrte und geradezu verkörperte. Das Judentum mit zwei seiner wichtigsten Wurzeln, der Bibel und der chassidischen Tradition, das war sein Lebensthema - und dann natürlich seine entscheidende philosophische Erkenntnis, dass alles Leben Begegnung sei. // Vielleicht war gerade er dafür besonders berufen, als zentrales Geheimnis des menschlichen Lebens die Beziehung, die Begegnung zwischen Ich und Du zu begreifen. // Denn einerseits war er ein Kosmopolit, im alten Habsburgerreich geboren, in Lemberg in der heutigen Ukraine erzogen, hat dort auf dem polnischen Gymnasium das Abitur abgelegt, danach studiert und gelehrt in München und Berlin und schließlich in Frankfurt, bevor er sich nach Palästina retten konnte, wo er dann als Gelehrter half, den Staat Israel mit aufzubauen. Übrigens sah er von Anfang an, ja sogar lange bevor er selbst den Boden des Heiligen Landes betrat, die Aufgabe, einen gerechten Ausgleich zwischen Arabern und Juden zu schaffen. // Dieser weltgewandte Gelehrte war einerseits ganz fest in jener religiösen Tradition verwurzelt und zu Hause, die mit den Psalmen immer wieder neu versucht, den Unaussprechlichen anzusprechen, den Absoluten mit Lob und Dank und Bitte zu bestürmen, dem Ewigen als einem Du zu begegnen. // Das Prinzip Dialog, das Prinzip wirklicher Begegnung zwischen Ich und Du, das Gegenüber als gleichwertigen, gleich guten, gleich offenen, gleich wahrheitssuchenden Anderen anzunehmen: Könnte es eigentlich heute etwas Wichtigeres geben? // Dieses Denken der Beziehung als Begegnung zwischen Ich und Du, einer Begegnung, die das Du nicht zu einem Es macht, die den anderen Menschen nicht verdinglicht, das ist ein Denken, dass ein kostbares, immer wieder neu zu entdeckendes, widerständiges Erbe ist. // Ein Denken, für das die Begegnung von Ich und Du im Zentrum steht, ist schlechthin antitotalitäres und antiideologisches Denken. Wo der Einzelne "nichts", die Gemeinschaft, das Volk, die Religion, die Klasse oder was auch immer sonst "alles" sein soll, da leistet das dialogische Prinzip Widerstand. Jede Gesellschaft, die eine menschliche sein will, muss der Begegnung freier Individuen Raum geben. // Martin Buber, jener "Erzjude", als der er sich in seiner Friedenspreisrede im Jahr 1953 bezeichnete, hat uns gezeigt, zu welch zutiefst humaner Haltung religiöser Glaube befähigen und ermutigen kann. Das ist in unseren Zeiten vielleicht aktueller, als er sich das hat vorstellen können. Wir können alle - und gerade in Deutschland - noch immer von Martin Buber lernen. Sein Denken kann uns auch heute Orientierung geben. // Auch in unserer heutigen Welt der beschleunigten Kommunikation ist der Weg vom Ich zum Du noch immer genau so weit wie in allen Zeiten. Auf diesem Weg der wahrhaftigen Begegnung gibt es keine Abkürzung. Uns auf diesen Weg zu begeben, dazu ermutigt uns die Erinnerung an jenen großen jüdischen Gelehrten, der vor 50 Jahren, wie wir hoffen dürfen, dem ewigen Du seines Schöpfers begegnet ist. // Ich bin all denen dankbar, die Martin Bubers Glauben, Denken, Suchen und Bekennen in Deutschland wachhalten.
-
Auf einem Historikertag darf man doch sicher mit einem Kaiser beginnen. Ich beginne mit dem letzten deutschen Kaiser, Franz Beckenbauer. Er erzählt gelegentlich von einem Ereignis, bei dem er selber ausnahmsweise einmal Verlierer war. Es handelt sich um das Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 1974, genauer gesagt in der Bundesrepublik Deutschland, bei dem die Auswahl der DDR gegen die der Bundesrepublik 1:0 gewann. // Franz Beckenbauer soll dann, wie auch andere Akteure damals, immer sinngemäß gesagt haben: "Ohne die Niederlage gegen die DDR wären wir '74 nie Weltmeister geworden. Denn nur dadurch wurden wir radikal mit unseren Schwächen konfrontiert, die wir dann in der Folge abstellen konnten". Also: Eine schmähliche Niederlage, ausgerechnet gegen die DDR, bereitete für die Mannschaft der Bundesrepublik den großen Triumph, die Weltmeisterschaft vor. // Ich erzähle diese deutsch-deutsche Sportanekdote natürlich, weil sie auf direkte und einschlägige Weise zum Thema passt, das Sie sich gegeben haben, wenn Sie hier auf dem 50. Deutschen Historikertag über Gewinner und Verlierer sprechen wollen. Ich gestehe, dass mich dieses Thema naturgemäß sehr fasziniert, und mich interessiert daran besonders der immer wieder - nicht nur im Sport - zu beobachtende dialektische Umschlag zwischen Sieg und Niederlage. // Bevor ich näher darauf zu sprechen komme, zunächst ein Wort zum heutigen Anlass und zum heutigen Ort: Göttingen. // "In Göttingen schien die Sonne." So beginnt Walter Kempowski in seinem Roman "Herzlich Willkommen" die Kapitel, die von der Studentenzeit des Erzählers handeln. // "In Göttingen schien die Sonne": Dieser oberflächlich so schlichte Satz ist die Überschrift über ein ganz neues Leben für jenen nicht mehr so ganz jungen Erzähler. Als Kind hatte er den Krieg und die Nazizeit erlebt und die Zerstörung seiner - und übrigens auch meiner - Heimatstadt Rostock, er hatte den Verlust allen Familienbesitzes erlitten, und war dann selber von der sowjetischen Besatzungsmacht aus politischen Gründen gefangen und gequält worden, hatte acht Jahre Zuchthaus in Bautzen erlebt, mit Einzelhaft. All das hatte er hinter sich. Und zudem musste er mit der Schuld leben, dass durch ihn auch seine Mutter und sein Bruder in Haft gekommen waren. Kurz: Er hatte selber schon genügend Geschichte, ja, sogar Weltgeschichte am eigenen Leib erlebt und erlitten. // Der kommt nun, Mitte der 1950er Jahre, hierher ins sonnenbeschienene Göttingen, in die bemüht heile Welt der westlich-westdeutschen Nachkriegszeit, um an der Pädagogischen Hochschule zu studieren, unter anderem Geschichte - dort ausgerechnet, wo die Geschichte nicht nur stillzustehen, sondern, wie er findet, gar nicht stattgefunden zu haben scheint: "Göttingen, das war eine Stadt, als wenn nichts gewesen wäre, eine Stadt, so wie man sie in älteren Fotobänden abgebildet sieht, in Brauntönen, Fachwerkgassen im Gegenlicht." // Nun wissen wir heute, dass auch in Göttingen die Zeit nie stehen geblieben ist. Auch das ehemals so beschauliche Städtchen beherbergt heute eine Universität mit bald 30.000 Studentinnen und Studenten. Das wollen wir in diesem Zusammenhang gern erwähnen, und die Universität und die Stadt sind stolz darauf, diesen Historikertag hier mit all den Gästen zu begehen. Ein fast unüberschaubares Programm wartet auf Sie, die rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dass auch die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft gigantische Fabrikationsstätten historischen Wissens und historischer Publikation geworden sind, wird uns bei einem solchen Anlass recht deutlich bewusst. Das alles ist beeindruckend, und ich freue mich, bei Ihnen zu sein und wünsche Ihnen viel Erfolg. // Alles auf Erden ist Geschichte, alles hat Geschichte. Aber was gewinnen wir eigentlich, wenn wir uns damit befassen? Ist es nicht belastend oder gar kränkend, wenn wir uns vor Augen führen, dass nichts denkbar ist ohne ein Vorher, und dieses Vorher, das haben nicht wir, sondern andere gemacht? Lange vor uns sind Entscheidungen getroffen worden, die auch uns binden, obwohl wir nicht dazu gehört wurden. Dazu zählt auch Schuld, die wir nicht selber auf uns geladen haben, an der wir aber heute noch zu tragen haben. // Aber was vor uns geschah, ist oft ja auch Wohltat und Gewinn: Lange vor uns sind die Kämpfe ausgetragen worden, die uns auch heute noch Freiheiten schenken, für die wir selber nicht streiten mussten. Lange vor uns sind die Leistungen erbracht worden, aufgrund derer wir heute Wohlstand, Frieden und Sicherheit genießen. // Es gibt also, auch in den Zeiten der scheinbar generellen Machbarkeit und des Anspruchs auf unbedingte individuelle Autonomie, so etwas wie ein Schicksal, etwas Unverfügbares, von dem sich niemand voll und ganz emanzipieren kann. // Aber genau hier erscheint dann die wirkliche Aufgabe. Zwar sind wir für unsere Vergangenheit nicht verantwortlich, für den Umgang mit ihr aber allemal. Und ist es nicht dieser Umgang, der oftmals darüber entscheidet, wie wir unsere Gegenwart und Zukunft zu gestalten vermögen? // Wir haben zwar unsere Vorgeschichte nicht gemacht, wir können nichts dafür, wie sie verlaufen ist, dafür glauben wir aber, dass wir besser als unsere Vorfahren wissen, was zum Beispiel an ihren Entscheidungen falsch und was richtig gewesen ist. Wir haben - wie wir denken, und sicher oft zu recht - bessere und tiefere Einsichten. Und wir können oft nur den Kopf schütteln über die Einstellungen, Urteile und eben auch über die Entscheidungen von früher. Wir sind sozusagen kognitive Geschichtsgewinner oder vielmehr: Wir könnten es sein, wenn wir bereit sind zu lernen und genau hinzuschauen. // Nehmen wir nur die Beispiele, die die großen Gedenktage des laufenden Jahres bieten, allen voran der 100 Jahre zurückliegende Beginn des Ersten Weltkrieges. In aller Deutlichkeit sehen wir heute, dass damals auf allen Seiten weitgehende Wahrnehmungsverweigerungen geherrscht haben müssen, die bis zu partieller Blindheit gingen. // Heute sehen wir eine Unfähigkeit, Folgen bestimmter Entscheidungen in den Blick zu nehmen. Oder wir erkennen auch heute eine zynische Einstellung der Herrschenden oder Befehlenden gegenüber dem Leid der Untertanen. // Auch erblicken wir eine maßlose Selbstüberschätzung und eine unbedachte Bereitwilligkeit, die Katastrophe in Kauf zu nehmen und das alte Europa eine "Welt von gestern" werden, also untergehen zu lassen. // Extrem unverständlich erscheint es uns heute, dass die Eliten von 1914 den Krieg als reinigendes Feuer empfinden konnten, dass ihr Unbehagen oder ihr Überdruss gegenüber der Moderne positive Untergangsphantasien hervorbringen konnte, ohne dass Einigkeit auch nur über die Konturen einer "neuen" Welt geherrscht hätte. // Ebenso sehen wir heute, um nur ein Beispiel aus einem anderen Zeitabschnitt zu nennen, welche Fehler zum Beispiel die Westmächte vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges gemacht haben: Genannt wird dann oft das Münchner Abkommen mit Hitler. // Aber wissen wir es wirklich besser als die Akteure von damals? Oder wissen wir lediglich mehr, nämlich wie die Geschichte weiterging? Im Augenblick des Geschehens kann niemand die Geschichte des Geschehens selber erzählen. Robert Musil, der im Ersten Weltkrieg Teilnehmer an den so absurden wie barbarischen Dolomitenschlachten war, hielt sarkastisch fest: "So also sieht Weltgeschichte in der Nähe aus; man sieht nichts." // Nur weil wir später dran sind, können wir heute die Geschichte erzählen. Und erzählen heißt ja, einen sinnvollen, plausiblen Zusammenhang zwischen den Fakten und den Ereignissen herzustellen. // Beides ist übrigens wichtig: Wenn die Historiker einerseits penibel und klar Fakten ermitteln und erforschen, Quellen aufsuchen und präsentieren, und wenn sie andererseits Geschichte in Geschichten zu erzählen wissen, die uns Sinn erschließen können durch eine bestimmte Perspektive der Erzählung. Gerade dieses Erzählen kann die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und auf diese Weise auch ethische und politische Fragen an uns heute stellen. // Dass wir heute vieles genauer sehen können, weil wir später dran sind, das darf uns nicht zu Besserwisserei und Hochmut verleiten. Im Gegenteil: Als kognitive Geschichtsgewinner lernen wir Skepsis und gewinnen die ständige Bereitschaft zur Überprüfung unseres eigenen gegenwärtigen Handelns. Wenn zum Beispiel, wie wir immer wieder feststellen, unsere Vorfahren von Vorurteilen geleitet wurden oder intellektuellen Moden folgten: Mit welchem Recht und mit welcher Sicherheit können wir eigentlich glauben, dass wir nicht selber zeitgeistigen Plausibilitäten oder schlichten Fehlurteilen aufsitzen? Es besteht aber genauso die Gefahr, dass Geschichte ideologisch missbraucht oder instrumentalisiert wird. // Mir ist zum Beispiel in Erinnerung, dass nicht nur Teile der Medien, sondern auch Lehre und Forschung im Westen die Erfahrungen mit der konkreten kommunistischen Herrschaft, die Konstruktion von der Ohnmacht der Vielen und der Übermacht der Wenigen nur unzureichend darzustellen vermochten. // Das gewinnen wir in der Beschäftigung mit der Geschichte: Skepsis und kritisches Bewusstsein. Wenn die Geschichte auch nur selten eindeutige Handlungsoptionen für die Gegenwart bereitstellen kann, die sich aus historischer Erfahrung gleichsam von selber ergeben, so kann sie uns doch vor Selbstgefälligkeit und Unbelehrbarkeit warnen. // Historisch gebildet zu sein, das heißt doch eigentlich: seiner Endlichkeit, seiner Fehlbarkeit und der Offenheit der Geschichte eingedenk zu sein. Wer so historisch reflektiert lebt, der denkt zweimal nach, bevor er handelt, und er bemüht sich, mit Einsicht in das Notwendige zu handeln, mit Rücksicht auf die anderen und mit Hinsicht auf die denkbaren Folgen, auch die sogenannten unwahrscheinlichen. // Eines lernen wir aus der Geschichte auf jeden Fall: Es gibt, und damit sind wir wieder hier, bei Ihrem Thema, es gibt meistens Gewinner und Verlierer. Wir sollten uns nicht lange mit Klagen darüber aufhalten, dass das so ist, sondern fragen: Wie geht der Verlierer mit dem Verlieren, der Gewinner mit dem Gewinnen um? Und auch: Wie verhält sich der Verlierer zum Gewinner und der Gewinner zum Verlierer? // Kommen wir zunächst auf den jungen Mann zurück, der, ohne Zweifel ein Verlierer, schwer geprüft nach Göttingen kommt, wo für ihn, nach all der erlebten Lebensfinsternis, die Sonne scheint. Was macht er hier? Hadert er endlos mit dem unverdienten Schicksal? Sinnt er auf Rache? Reicht es ihm aus, alle Welt seine Verletzungen spüren zu lassen? Nein, so ist es nicht. Er lässt sich ganz auf Neues ein, er ist sehnsüchtig nach neuer Erfahrung, nach Leben, nach Lernen, nach Liebe. Er - und man darf und soll in dem Erzähler Kempowski selber erkennen - er bleibt nicht der Gefangene seiner Vergangenheit. Indem er sie gestaltet, wird er zum Gewinner: Er schreibt die Erinnerungen an seine Gefangenschaft auf, er führt Interviews mit seiner Mutter und mit Verwandten, er sammelt die verlorenen Bücher seiner Kindheit. Er, der schuldlos acht Jahre seines Lebens im Zuchthaus verloren hat, wird später zu einem unermüdlichen Sammler, zum Historiker und Erzähler, zuerst seiner selbst, dann seiner Familiengeschichte, dann der Geschichte der Deutschen in diesem Jahrhundert. // Aus dem Verlierer, aus dem Opfer wird aus eigener innerer Kraft der Schriftsteller Walter Kempowski, der mit dem "Echolot" und der "Deutschen Chronik" ein Werk schafft, das auch international seinesgleichen sucht. Der unter die Räder der Geschichte geraten war, zum Objekt der Mächtigen, hat sich selber zum Schöpfer und zum Subjekt seiner Geschichte und der seines Volkes geschrieben. Sieht so ein Verlierer aus oder - ob zwar gezeichnet und unter die "gebrannten Kinder" zu rechnen - nicht eben doch ein Gewinner? // Was am Beispiel dieses Einzelnen zu zeigen ist, das gilt auch für Nationen, für Völker oder Völkergruppen. Wo steht denn geschrieben, dass Verlierer Verlierer bleiben müssen? Und kommt es nicht tatsächlich alles darauf an, wie im Nachhinein mit der Niederlage umgegangen wird - wie im Übrigen auch mit dem Sieg? // Achten wir beim Nachdenken darüber nicht nur auf bewaffnete Konflikte, sondern auch auf andere Entwicklungen, die von Siegern und Verlierern sprechen lassen. // Da ist zum Beispiel die Geschichte der Industrialisierung. Uns steht einerseits die Rasanz des Fortschritts vor Augen, mit den Eisenbahnen, den großen Fabriken, die allüberall entstehen, den Erfindungen des Funks zum Beispiel, dem Verlegen der ersten Seekabel, und so weiter - und andererseits wissen wir doch alle um die Berichte über das erbärmliche soziale Elend, ob sie nun geschrieben waren von Friedrich Engels über "die Lage der arbeitenden Klasse in England" oder ob es die Protokolle des evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern sind, der über die himmelschreiende Not der Ärmsten in Hamburg berichtete. // Da gab es ohne jeden Zweifel echte Verlierer, und es gab Verlorene und Mühselige und Beladene, Erniedrigte und Beleidigte. Und doch war diese Entwicklungsphase auf lange Sicht ein wichtiger Ausgangspunkt für eine unglaubliche Verbesserung der Lebensumstände für alle, an der viele mitwirkten und die weltgeschichtlich ohne Beispiel ist. Zugespitzt gefragt: Hat ein König um 1800 so leben können wie der durchschnittliche Europäer im Jahre 2014? Nie hat es sich - in diesem Teil der Erde, in dem wir leben dürfen - leichter und angenehmer leben lassen, nie konnten vor allem Krankheit und Armut besser bekämpft werden als heute. Und - schauen wir wieder zurück - durch die sozialistische Arbeiterbewegung, durch christliche Gesellschaftslehre, durch demokratische Parteien und Gewerkschaften haben der Arbeiter und der sogenannte "kleine Mann" Recht, Würde und Stimme bekommen. Ob das Wissen darum, dass das passieren würde, ein Trost gewesen wäre für die damaligen Verlierer der Geschichte, das steht auf einem anderen Blatt, einem Blatt, das ich etwas später gesondert aufschlagen werde. // Gewinner und Verlierer: Manchmal changiert das Bild, der Verlierer sieht wie der Sieger aus oder umgekehrt. // Wir sprechen zum Beispiel in Westeuropa vom Ersten Weltkrieg als der "Urkatastrophe" des Jahrhunderts - und zwar unabhängig davon, ob wir in England oder Frankreich zu den Siegern oder ob wir in Deutschland zu den Verlierern des Krieges gehören. Bei anderen Kriegsteilnehmern aber denkt man ganz anders. // Ich hatte vor kurzem acht Historiker aus acht europäischen Ländern zu einer Diskussionsveranstaltung ins Schloss Bellevue eingeladen. Es ging um die Frage, wie in den verschiedenen Ländern heute an den Ersten Weltkrieg erinnert wird. Dabei wurde vollkommen klar, dass die Polen oder die Tschechen und Slowaken oder auch Serben oder Kroaten, Esten, Letten und Litauer keineswegs von einer Urkatastrophe sprechen, da doch ihre Staaten oder Staatenbünde erst durch den Ersten Weltkrieg und nach dem Zerfall der Großreiche gegründet oder wiedergegründet werden konnten. Die neuen Nationen sind also Gewinner, obwohl die aus ihnen stammenden Soldaten zum Teil oft auf Seiten der Verlierer-Imperien gekämpft hatten. // Und wie geht man mit dem Verlieren um? Nehmen wir unser Land, Deutschland. Der erste Blick nach 1918: Auf der einen Seite spüren die Deutschen damals so etwas wie ein Aufatmen, als mit der Niederlage im November endlich die Republik und die Demokratie kommen. Aber nicht alle haben dieselben Gefühle. Alle aber drücken schwer die Reparationen, die der Versailler Vertrag, der auch von Ressentiment und Rache geprägt war, dem Land auferlegt hat. Und es drückt schwer die als ungerecht empfundene Behauptung, der Alleinschuldige am Krieg gewesen zu sein. Und man glaubt nicht an die Realität der militärischen Niederlage. Man lügt sich das Gegenteil vor und behauptet und tröstet sich mit der Legende: der vom Dolchstoß. // Diese Hypothek, so wissen wir es alle, lastet schwer auf der jungen Republik, bei allem guten Willen und aller aufrichtigen Anstrengung besonnener und überzeugter Demokraten. Zu viele bleiben damals abseits. Trotz "roaring twenties" und großer Aufschwünge in den goldenen Zeiten vergraben sich viele in Gram und hadern verstockt mit dem Schicksal. Andere sind einfach nur verelendet. Die soziale Not der Wirtschaftskrise tut ein Übriges. Rachephantasien wachsen, andere Schuldige werden gesucht und gefunden: mal sind es Juden oder Bolschewisten, für manchen schlicht die Demokratie, die einige Verächter schlicht "das System" schimpfen. Eine Selbstvergewisserung mit klarem Blick für die tatsächlichen Gegebenheiten bleibt größtenteils aus. Von rechts und links wird die schwache Republik angegriffen und verraten. So erobern Hitler und die Nazis ein Land, das nicht mit sich ins Reine gekommen war. // Wie anders geht das Land nach 1945 mit der Niederlage um! Da blieb kein Raum für Lebenslügen wie 1918. Und die, die es versucht haben, sind mit diesem Versuch gescheitert. Militärisch war Deutschland eindeutig besiegt und moralisch, auch nach eigener schmerzhafter Einsicht einiger, später dann vieler seiner Bürger, zutiefst diskreditiert. Weder der Verlust von Gebieten noch Reparationszahlungen führten zu so bedeutenden revanchistischen Kräften, dass sie dauerhaft politisch durchsetzungsfähig gewesen wären. Aber das Land konnte mit der Niederlage auch deshalb anders umgehen, weil es von den Siegern anders behandelt wurde, also schon bald wieder in den Kreis der möglichen, dann der tatsächlichen Partner aufgenommen wurde. Zwar stellen der beginnende Kalte Krieg und die Aufteilung des Landes in zwei Blöcke eine besondere Situation dar, aber zumindest im Westen wurden Chancen geboten, gesehen und ergriffen. // Eine entschiedene Haltung der ausgestreckten Hand seitens der Sieger hat - zunächst für einen Teil unseres Landes - zu einer glücklichen neuen Geschichte geführt. Schon 1944 hatte das Britische Foreign Office für die britischen Soldaten, die nach Deutschland gehen sollten, in diesem Geist einen Leitfaden geschrieben, der noch heute lesenswert ist. Die Haltung lässt sich zusammenfassen in der Aufforderung: Be smart, be firm, be fair. Oder ausführlicher: "Es ist gut für die Deutschen, wenn sie sehen, dass Soldaten der britischen Demokratie gelassen und selbstbewusst sind, dass sie im Umgang mit einer besiegten Nation streng, aber zugleich auch fair und anständig sein können. Die Deutschen müssen selber fair und anständig werden, wenn wir später mit ihnen in Frieden leben wollen." // Ich versage mir an dieser Stelle einen Exkurs darüber, dass die Besiegten der sowjetischen Besatzungszone weder freundliche Sieger noch eine erfreuliche Zukunftsperspektive hatten. Das muss ich auslassen, denn in diesem Falle würde ja der größte Gegner der Historikerzunft, nämlich der Zeitzeuge, auf der Bühne stehen. // Umso größer ist mein Respekt für eine Haltung, die den gegenwärtigen Feind schon als künftigen Partner sieht. Sie verhindert die Perpetuierung von Sieg und Niederlage, von Rache und Vergeltung, und sie wird so einem neuem Krieg oder der Bereitschaft, ihn zu führen, vorbeugen. // Von ähnlicher Art waren im Übrigen die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück, die 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendeten und auch die Friedensordnung des Wiener Kongresses 1815, also vor bald genau 200 Jahren. Man ersparte sich das Aufrechnen, auch die moralische Verurteilung des Feindes. So schuf man, im Gegensatz zu Versailles, eine Friedensordnung, die fast 100 Jahre hielt. Allerdings gab es auch hier neue Verlierer, nun waren sie im Innern der Staaten. Denn die neue Internationale der Fürstenhäuser, die in weiten Teilen die alte geblieben war, sicherte ihren Frieden auch gegen die freiheitlichen Bestrebungen ihrer eigenen Bürger. Ich bin dankbar, dass vorhin die Göttinger Sieben erwähnt wurden - anderer Zeitzusammenhang, aber dasselbe Problem. // Ein anderes Beispiel: Nach 1945 konnte eine Gruppe aus unserer Bevölkerung, die sich nach dem jüngsten Krieg ganz besonders als Verlierer fühlen musste, die Chance ergreifen, zu Gewinnern zu werden. Ich spreche von den Flüchtlingen und Vertriebenen, die zu Millionen ihre Heimat, Haus und Hof, also praktisch alles verloren hatten. Sie hatten eine fundamentale Erfahrung gemacht: Was ihnen blieb, war nur ihr Können, ihre handwerklichen Fähigkeiten, ihr Fleiß, ihr Glaube, ihre Bildung. "Was du gelernt hast, kann dir keiner nehmen!" Diese Erfahrung wurde damals in vielen Familien weitergegeben. Und überdurchschnittlich viele von ihnen haben in der Nachkriegszeit weit überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse erzielt. Vieltausendfach sind hier Aufstiegsgeschichten zu erzählen, führte die persönliche Entfaltung sozusagen auf die Gewinnerstraße. // Dennoch, wir wissen es, konnten oder wollten manche den unwiederbringlichen Verlust ihrer Heimat und das erlittene Unrecht nicht akzeptieren. Andere, viele aber, fühlten sich einer besseren Zukunft in neuer Heimat verpflichtet und wurden so zu Wegbereitern der Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn - und so noch einmal zu Gewinnern für unser Land. // Von Gewinnern und Verlierern hat man auch im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gesprochen. Ich kann das nur sehr bedingt nachvollziehen. Wo für alle Freiheit anbricht, wo für alle Freizügigkeit, Recht und demokratische Mitwirkung ermöglicht werden, wo für alle die Chancen eröffnet werden, sich frei zu entfalten, da kann doch vom Verlieren eigentlich nur reden, wer Privilegien eines Unrechtsstaates genossen hat. // Aber schauen wir genauer hin: Es existieren zweierlei Verlusterfahrungen. Neben der politisch gewollten Ablösung der politischen Eliten und ihres sehr kleinen Herrschaftszentrums musste eine sehr große Zahl Beschäftigter in Funktionseliten der öffentlichen Verwaltungen, des Parteiapparates, von Polizei, Militär und Geheimpolizei in eine unsichere Zukunft überwechseln. Dabei ist weniger der Verlust an materieller Sicherheit als der Verlust einer sich über zwei Generationen herausgebildeten Rollensicherheit von Bedeutung für die Lebensgefühle der Betroffenen. // Und auch wer sich als unpolitischer Zeitgenosse an die Defizite mit der Zeit gewöhnt hatte - und es gab eine ganze Sammlung von Defiziten -, wer sich privat in den berühmten "Nischen" ein lebbares Leben errichtet hatte, war dann, als sich alles änderte, häufig überfordert vom neuen System, reagierte also, wenn nicht mit Ablehnung des Neuen, so doch mit starken Fremdheitsgefühlen - und das besonders natürlich, wenn man seine Arbeit verloren hatte und das Gefühl hatte, nicht mehr wirklich gebraucht zu werden. Aber alles in allem sind die Deutschen und insbesondere die Ostdeutschen insgesamt Gewinner der Vereinigung. // In der Dialektik der Gewinner- und Verlierergeschichte werden immer wieder, wenn wir genauer hinschauen und etwas tiefer blicken, zwei Muster offenbar, die zu den grundlegenden abendländischen Erlebnis- und Erzählmustern gehören und die bis heute prägend sind. Sie haben beide eine religiöse, genauer, eine christliche Wurzel. // Da ist einmal die Geschichte des absoluten Verlierers, der, selber gewaltlos und friedlich, unschuldig verhaftet und sogar hingerichtet wird. Von den religiösen und staatlichen Autoritäten vernichtet. Seine Anhänger verzagt, verstreut, verloren. Doch wenig später entsteht in ihrem Kreis die Botschaft, er sei von den Toten auferweckt worden, also von Gott selber gerechtfertigt, von der höchsten Instanz. In dieser mythosgleichen Geschichte des Jesus aus Nazareth findet der denkbar größte Umschlag von Niederlage in Sieg statt. // Und diese Geschichte, sie trat nun selber einen Siegeszug an: erzählt zunächst von einer kleinen, verfolgten Verlierersekte, erobert sie Schritt für Schritt das römische Weltreich. Es war diese Geschichte und die mit ihr begründete Praxis der Nächstenliebe zu den Verlierern und Verlorenen, die ohne Gewalt, ohne politische Tricks, ohne strategische Planung plötzlich gegen alle anderen Geschichten gewann. Dass das unschuldige Leiden nicht vergeblich erlitten wurde, dass es einen Sinn hat und Rechtfertigung erfährt, das war eine Hoffnung, der sich Menschen seither gerne hingaben und hingeben. // Das andere, korrespondierende Muster der Geschichte vom Verlieren und doch Gewinnen, handelt vom selbst verschuldeten Leid. Diese individuelle Schuld- und Leidenserfahrung kann zu Einsicht, Reifung, dann zu Versöhnung und zu neuem Anfang führen - auch für sie gibt es eine Geschichte in der Bibel, etwa die, die vom verlorenen Sohn handelt. // Ob selbstverschuldet oder schuldlos erlitten: Leid muss nicht sinnlos sein, es kann zu Läuterung, Besinnung, neuem Selbstvertrauen führen. Bis heute lieben wir deshalb Geschichten, ob in Büchern oder Filmen, ob in der Oper oder im Theater, in denen die Helden ein schweres Schicksal erleiden, daran fast endgültig zu zerbrechen drohen und zu scheitern drohen, dann aber, vielleicht geläutert, vielleicht mit neuer Kraft und Stärke, alle Widrigkeiten besiegen und gleichsam wieder auferstehen, aufstehen. // An diese Erzähl- und Erlebnismuster muss ich denken, wenn ich mir und uns die Frage stelle: Was ist nun mit den Opfern, die keine neue Zukunft mehr hatten, was ist mit den wirklichen und endgültigen Verlierern, den Verlierern der Geschichte, die nicht erhöht wurden, die keine Chance zu einer Läuterung bekamen und denen jeder Triumph versagt blieb? Mit den Opfern von Völkermord und Holocaust, von Krieg, was ist mit den Opfern von Naturkatastrophen, Hungersnöten, Epidemien? Mit den unschuldig leidenden Kindern? Was ist mit denen, die ein metaphysischer Trost nicht erreicht, denen die gerade zitierten Geschichten von Tod und Auferstehung fremd oder unglaubwürdig, jedenfalls nicht zugänglich sind? // Hierauf, das weiß ich, können Historiker, aus ihrem Beruf heraus jedenfalls, keine Antwort geben. Die Frage nach dem Sinn von Leid, nach dem Sinn oder der Rechtfertigung von jedem einzelnen Leidenden, jedem einzelnen Opfer, sie kann nicht historisch beantwortet werden. // Aber diese Frage könnte nach meinem Verständnis doch die Geschichtsschreibung durchaus begleiten. Auch wenn die Geschichte, wie man sagt, von den Siegern geschrieben wird, ist doch immer auch die Geschichte der Marginalisierten zu erzählen, der Unterdrückten, der Geschlagenen. Und das geschieht doch auch schon. Es gibt doch schon einen erprobten Perspektivenwechsel. // Geschichtsschreibung kann ihnen keinen Sinn zusprechen, aber Geschichtsschreibung kann ihnen ihre Würde lassen, diesen Opfern, über die wir eben gesprochen haben. Sie kann ihnen ihre Würde lassen oder wiedergeben, wenn sie ihre Stimmen zu Wort kommen lässt oder wenn sie die zum Schweigen Gebrachten in Forschung und Lehre in die Erinnerung einbringt - und in der Schule. // Hier, im Gedächtnis des Leids, liegt jene "gefährliche Erinnerung", wie der Theologe Johann Baptist Metz es nannte und von der er oft so eindringlich gesprochen hat, die wir wieder brauchen, damit sie uns immer wieder beunruhigt und aus jeder Selbstgenügsamkeit aufrüttelt. Er, Metz, formulierte vor nun 40 Jahren für die Synode der deutschen Katholiken die folgenden bewegenden Sätze: "Die vergangenen Leiden zu vergessen und zu verdrängen, hieße uns der Sinnlosigkeit dieser Leiden widerspruchslos zu ergeben. Schließlich macht auch kein Glück der Enkel das Leid der Väter wieder gut, und kein sozialer Fortschritt versöhnt die Ungerechtigkeit, die den Toten widerfahren ist. Wenn wir uns zu lange der Sinnlosigkeit des Todes und der Gleichgültigkeit gegenüber den Toten unterwerfen, werden wir am Ende auch für die Lebenden nur noch banale Versprechen parat haben." // Erinnerung in diesem starken Sinne ist die Erinnerung daran, dass auch unsere Existenz sich dem Opfer anderer, vor uns Lebender verdankt, das nicht vergeblich gewesen sein soll und nicht vergeblich gewesen sein darf. Und dass wir in unserem Leben dazu aufgerufen sind, Leid nach Möglichkeit zu verhindern, Menschen, so es an uns liegt, nicht zu Opfern werden zu lassen. Das kann durch Unterlassen des Bösen geschehen oder durch Tun des Guten. // Etwas liegt mir zum Schluss noch am Herzen, es hat auch mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Manchmal frage ich mich, ob die Geschichte nicht dabei ist, über die Gegenwart und über die Zukunft zu siegen. Hat man noch vor nicht allzu langer Zeit anklagend von der" Geschichtslosigkeit" und "Geschichtsvergessenheit" der Gegenwart gesprochen, so scheint mir heute geradezu das Gegenteil zuzutreffen. Unaufhörlich, so sieht es aus, sind wir mit der Geschichte, mit Jubiläen, Gedenktagen, Erinnerungen, Denkmälern oder Denkmalplanungen konfrontiert. Wo ist nur die Zukunft hin? // Oft haben wir den Eindruck, die Zukunft, sie käme sozusagen von allein, und zwar mit rasender Geschwindigkeit, sie sei im Grunde das Werk einiger weniger Ingenieure, Softwarefirmen, Investoren und vielleicht auch noch von Politikern. Dazu kommt das Gefühl: Die Welt ist heute so komplex geworden, dass die Folgen vieler Entscheidungen nicht mehr abzusehen sind. Die gegenwärtigen Krisen tun ein Übriges, um uns ratlos zu machen und viele von uns zu lähmen. // Aber die Zukunft, sie kommt nicht von selbst, früher nicht und heute nicht. Wenn wir uns auch daraufhin einmal die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass - jenseits aller Zufälle und unbeabsichtigten Wechselwirkungen - das meiste bewusst von Menschen gemacht, von Menschen bewirkt worden ist - oder auch von Menschen verhindert. Wer die Hand in den Schoß legt und glaubt, die Zukunft würden schon andere für ihn gestalten, der macht sich selber schnell zum Opfer und wird sehr schnell auf eine ungute Verliererstraße geraten. // Alles, was wir heute so intensiv genießen, Frieden, Freiheit, unseren Wohlstand - was Menschen in so vielen Teilen der Welt so bitter fehlt - ist das mühsam genug erreichte Werk von Menschen. Und es ist zerbrechlich und endlich, wie alles Menschenwerk. Es muss verteidigt, erneuert, wo nötig, neu errungen werden. Es gibt kein Ende der Geschichte. // Wenn die Geschichte keinen Schluss kennt, dann gilt aber auch, dass es nie zu spät ist, gegenwärtiges Leid und Unglück zu wenden. Dann ist Hoffnung sinnvoll, dann kann uns Hoffnung zu entschiedenem Handeln motivieren. // Wir haben es zu einem großen Teil selber in der Hand, ob wir uns im Spiel dieser Welt als Gewinner oder als Verlierer beschreiben können. Wenn die Geschichte auch oft als Lehrmeisterin wenig brauchbar ist: Gute und ermutigende Beispiele, wie aus vermeintlichen Verlierern durch eigenen Mut und eigene Tatkraft, aber auch durch solidarisches Handeln, Gewinner werden können, die gibt es in Fülle. // Meine eigene Lebenserfahrung - und nun meldet sich doch der Zeitzeuge - sie lehrt mich, dass es nicht umsonst ist, sich stark zu machen für eine andere, bessere Zukunft, für eine Veränderung der Verhältnisse. Sicher, so etwas wie die Friedliche Revolution 1989 in Mittelosteuropa und der DDR - so etwas geschieht nicht alle Tage. Aber was wir dort erlebt haben, das bleibt ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Geschichte selbst in Situationen, die unabänderlich erscheinen, beeinflussbar und gestaltbar ist. // Wir haben es, zu einem Teil wenigstens, auch in der Hand, dass das Spiel dieser Welt weniger Verlierer und mehr Gewinner haben kann. Es liegt auch an uns, ob wir auf Kosten anderer siegen wollen oder ob wir dafür sorgen, dass möglichst viele zu Gewinnern werden. Es liegt auch an uns, dass Verlierer eine neue und gerechte Chance bekommen. Es gehört zu der Verantwortung, zu der unser Land sich in Wort und Tat bekennen muss und bekannt hat, dass Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, in welch mühsamen und kleinen Schritten auch immer, auch und gerade durch unseren Beitrag wachsen mögen. // Die Geschichte gibt uns kein unfehlbares Wissen darüber, was in einer gegebenen Situation richtig ist. Aber wir können aus der historischen Erfahrung ganz gewiss eine Überzeugung gewinnen: Wer sich für Freiheit und Menschenwürde eingesetzt hat, für das Recht und die Gerechtigkeit, für Anstand, für Menschlichkeit, der mag vielleicht eine Zeit lang auf der verlorenen Seite gewesen sein - auf der falschen war er nicht.
-
Das sind wichtige Tage, die wir miteinander in unserem Land erleben. Wir zeigen uns hilfsbereit und wir zeigen uns zur Hilfe fähig! Ich bin glücklich und dankbar, dies zu erleben. // Dankbar bin ich all den Menschen, die als Freiwillige in den Notunterkünften da sind, um Menschen zu begleiten bei Behördengängen, bei der Nahrungsverteilung, bei der Kinderbetreuung. // Ich bin denen dankbar, die spenden. Wir brauchen diese Spenden. // Und ich bin denen dankbar, die sogar bereit sind, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen und für sie zu sorgen. Und natürlich bin ich all den Menschen dankbar, die in den Behörden oder in den sozialen Diensten arbeiten. Die sind an den Grenzen ihrer Möglichkeiten und arbeiten trotzdem für dieses wichtige Werk. // Klar bin ich auch denen dankbar, die selber vor ein paar Jahren erst zugewandert sind und heute helfen bei Übersetzungen, bei Behördengängen und so Brücken bauen. // Ja, wir alle wissen, wir stehen vor großen Herausforderungen. Es werden auch Probleme auf uns zukommen, klar. Wir helfen jetzt spontan und das ist gut so. Wir können das, weil wir ein starkes Land sind und weil wir solidarisch sind. // Wir werden aber nicht nur heute helfen, sondern es wird auch morgen nötig sein, dass wir Geduld und Kraft aufbringen. Und dass Menschen da sind, die auch morgen den Ankommenden helfen, unsere Gesetze, unsere Kultur, unsere Ordnung zu begreifen. Und wenn wir das alles erleben werden, werden wir dieser großen Herausforderung gerecht werden. // Ich bin dankbar, dass es heute so ausschaut, als könnten wir das packen. Und Ihnen bin ich dankbar, all jenen, die helfen und spenden und die sich einsetzen. Das macht unser Land schön. Wir stehen zu unserem Land und wir fürchten uns nicht vor den Herausforderungen.
-
Der Tag der Deutschen Einheit. Das ist für unser Land seit 25 Jahren ein Datum der starken Erinnerungen, ein Anlass für dankbaren Rückblick auf mutige Menschen. Auf Menschen, deren Freiheitswille Diktaturen ins Wanken brachte, in Danzig, Prag und Budapest. Auf Menschen auch in Leipzig, Plauen und so vielen anderen Orten der DDR, die mit der Friedlichen Revolution die Vereinigung beider deutscher Staaten überhaupt erst vorstellbar werden ließen. Ich begrüße mit besonderer Freude diejenigen unter uns, die damals dabei waren. Wir wären heute nicht hier, wenn Sie damals nicht aufgestanden wären! // Am 3. Oktober denken viele von uns an den Klang der Freiheitsglocke, an die Freudentränen nicht nur vor dem Reichstag, an die Aufbruchsstimmung, die uns beherrschte, ja: an großes Glück. // Aber in diesem Jahr ist doch manches anders. So mancher fragt: Warum zurückblicken? Hat die Bundesrepublik momentan nicht drängendere Probleme, drängendere Themen als dieses Jubiläum? Was können wir feiern in einer Zeit, in der hunderttausende Männer, Frauen und Kinder bei uns Zuflucht suchen? Einer Zeit, in der wir vor so immensen Aufgaben für unsere Gesellschaft stehen? // Meine Antwort darauf lautet, ganz einfach: Es gibt etwas zu feiern. Die Einheit ist aus der Friedlichen Revolution erwachsen. Damit haben die Ostdeutschen den Westdeutschen und der ganzen Nation ein großes Geschenk gemacht. Sie hatten ihre Ängste überwunden und in einer kraftvollen Volksbewegung ihre Unterdrücker besiegt. Sie hatten Freiheit errungen. Das erste Mal in der deutschen Nationalgeschichte war das Aufbegehren der Unterdrückten wirklich von Erfolg gekrönt. Die Friedliche Revolution zeigt: Wir Deutsche können Freiheit. // Und so feiern wir heute den Mut und das Selbstvertrauen von damals. Nutzen wir diese Erinnerung als Brücke. Sie verbindet uns mit einem Erfahrungsschatz, der uns gerade jetzt bestärken kann. Innere Einheit, so machen wir uns klar, innere Einheit entsteht, wo wir sie wirklich wollen und uns dann ganz bewusst darum bemühen. Innere Einheit entsteht, wenn wir uns auf das Machbare konzentrieren, statt uns von Zweifeln oder Phantastereien treiben zu lassen. Und innere Einheit lebt davon, dass wir im Gespräch darüber bleiben, was uns verbindet und was uns verbinden soll. // Auch 1990 gab es die berechtigte Frage: Sind wir der Herausforderung gewachsen? Auch damals gab es - wir haben es schon gehört - kein historisches Vorbild, an dem wir uns orientieren konnten. Und trotzdem haben Millionen Menschen die große nationale Aufgabe der Vereinigung angenommen und Deutschland zu einem Land gemacht, das mehr wurde als die Summe seiner Teile. // Für mich steht die positive Bilanz im 25. Jahr der Deutschen Einheit außer Frage. Auch wenn es zuweilen Enttäuschungen gab, wenn Wirtschaftskraft und Löhne nicht so schnell gewachsen sind, wie die meisten Menschen in Ostdeutschland hofften, und wenn die finanzielle Förderung länger währt, als die meisten Westdeutschen wünschen, so ist doch gewiss: Die große Mehrheit der Deutschen, gleichgültig woher sie stammen, fühlt sich in diesem vereinten Land angekommen und zuhause. Die Unterschiede sind kleiner geworden und besonders in der jungen Generation, da sind sie doch eigentlich gänzlich verschwunden. Deutschland hat in Freiheit zur Einheit gefunden - politisch, gesellschaftlich, langsamer auch wirtschaftlich und mit verständlicher Verzögerung auch mental. // Es ist wieder zusammengewachsen, was zusammengehörte - Willy Brandt hat Recht behalten. Allerdings war der Prozess der Vereinigung deutlich schwieriger, als die meisten in der Euphorie vor 1989/90 glaubten. Beide Seiten hatten sich ihre Eindrücke vom "Drüben" ja lange nur aus der Ferne gemacht. Als wir einander schließlich direkt in Augenschein nehmen konnten, da waren viele Menschen überrascht, einige auch erschrocken. "Alles marode", sagten die einen. "Alles Show", fanden die anderen. // Eins stimmt natürlich: Noch hat der Osten das wirtschaftliche Niveau des Westens nicht erreicht. Gleichwohl, das Bild vom maroden Osten ist inzwischen Vergangenheit. Der äußere Wandel ist überdeutlich in Vorher-Nachher-Bildern darstellbar: hunderttausende von Eigenheimen, sanierte Straßen, Dörfer, Städte, gerettete Baudenkmäler und Kulturstätten, saubere Flüsse und Seen. All die runderneuerten Landstriche, sie geben Anlass zur Freude. Sie sind Zeugnisse einer großen gemeinsamen Anstrengung und Belege dafür, dass auch die Westdeutschen die Einheit als gesamtdeutsche Aufgabe angenommen haben, zeigten sie sich doch von Anfang an solidarisch mit jenen, von denen sie über Jahrzehnte getrennt worden waren. // Ich kann und will dies am heutigen Festtag nicht für selbstverständlich nehmen, sondern ich will es würdigen, ausdrücklich und dankbar. // In diesem Zusammenhang sollten wir uns außerdem bewusst machen, dass auch die Westdeutschen den Ostdeutschen ein Geschenk gemacht haben: mit dem Grundgesetz, das die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Grundrechte sichert, mit einer funktionierenden Demokratie, einer unabhängigen Justiz und einem sozialen System, das die Schwachen auffängt. // Allerdings hat die Einheit den meisten Westdeutschen im täglichen Leben wenig abverlangt, den Ostdeutschen dagegen mit einem enormen Transformationsdruck sehr viel. Das neue Leben im Osten brachte ja nicht nur volle Einkaufsregale, schnelle Autos und bunte Reisekataloge. Es brachte auch die massenhafte "Abwicklung" sogenannter volkseigener Betriebe, brachte damit Massenarbeitslosigkeit und Massenabwanderung. Leere Werksgelände, leere Plattenbauten, leere Schulklassen - all das hinterließ seelische Spuren. Selbst für die Jüngsten von damals, die sich heute als "Wendekinder" bezeichnen, sind dies prägende Erinnerungen, sie sind in ihrem Gedächtnis geblieben. // Für 16 Millionen Menschen änderte sich in kürzester Zeit fast alles. Aber manches - gemessen an den großen Hoffnungen - eben nicht schnell genug. Erst allmählich wurde klar, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse und Mentalitäten in Ost und West eine Aufgabe, ein Prozess von Generationen - ja: Plural! - sein würde. // Schmerzlich mussten wir im Osten erfahren, dass wir Demokratie 1989/90 zwar über Nacht erkämpfen, nicht aber über Nacht auch erlernen konnten. Gestern Untertan, heute Citoyen: was für ein Irrtum! Ohnmacht hatte sich in vielen Köpfen eingenistet. Ohnmacht nach Jahrzehnten totalitärer Diktatur, in denen die Grundrechte der Menschen beschnitten und das eigenverantwortliche Tun gelähmt war, in denen freie Wahlen ein ferner Traum bleiben mussten. So erklärt sich die wohl größte Herausforderung der Ostdeutschen im vereinten Land. Es galt, jahrzehntelange Selbstentfremdung zu überwinden, möglichst im Zeitraffer. Es galt, genau das zu tun, was vorher alles andere als erwünscht war: selbständig zu denken, selbständig zu handeln. Von Freiheit nicht nur zu träumen, sondern Freiheit in der Freiheit tatsächlich zu gestalten. // Trotz aller Schwierigkeiten: Millionen Ostdeutsche haben den persönlichen Neuanfang gewagt und bewältigt, unter neuen Prämissen, in neuen Berufen oder an neuen Orten. Millionen haben die Brüche ihrer Biographien in Zukunft verwandeln können, haben Unternehmen gegründet und Verwaltungen demokratisiert, haben an Universitäten die freie Lehre und Forschung eingeführt, haben Vereine ins Leben gerufen, wo sich vorher der Staat für zuständig hielt. Millionen Menschen haben sich der fundamentalen Einsicht geöffnet: Neue Freiheit bietet neue Möglichkeiten, aber sie verlangt eben gleichzeitig die Übernahme neuer Verantwortung, auch Selbstverantwortung. Besonders diese Veränderungsleistung der Ostdeutschen war enorm. Sie wirkt bis heute nach. // Und genau an dieser Stelle möchte ich einmal Dank sagen all denen, die angepackt haben, die das gemacht haben, was sie vorher nie gelernt hatten: als ehren- oder hauptamtlicher Bürgermeister, als Abgeordneter, als Sekretär einer freien Gewerkschaft, als Verantwortlicher einer demokratischen Partei, als Minister, als Ministerpräsident, gar als Bundeskanzlerin - sie alle hatten niemals erwartet, zu tun, was sie dann taten. Wir schauen heute einmal auf sie alle - und sagen einfach "Danke". // Zu denen, die ich eben aufgezählt habe, gehört auch mancher unserer Gäste. Ich sehe in der dritten Reihe jemanden aus der polnischen Nachbarschaft, Bogdan Borusewicz, heute Senatspräsident der Republik Polen. Damals aber, in der Zeit, über die ich eben gesprochen habe, als wir alle ganz woanders waren, da war er ein unbekannter Mann aus der Mitte des Volkes, der mutiger und früher angefangen hat als wir und der uns zusammen mit seinen Landsleuten motiviert hat, auch etwas zu wagen. Danke! // Meine Damen und Herren, die innere Einheit Deutschlands konnte vor allem wachsen, weil wir uns als zusammengehörig empfanden und weil wir in Respekt vor denselben politischen Werten gemeinsam leben wollten. Doch nun, da viele Flüchtlinge angesichts von Kriegen, von autoritären Regimen und zerfallenden Staaten nach Europa, nach Deutschland getrieben werden, nun stellt sich doch die Aufgabe der inneren Einheit neu. Wir spüren: Wir müssen Zusammenhalt wahren zwischen denen, die hier sind, aber auch Zusammenhalt herstellen mit denen, die hinzukommen. Es gilt, wiederum und neu, die innere Einheit zu erringen. // Diese Entwicklung hat vor 25 Jahren niemand ahnen können. Damals, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime und dem Ende des Ost-West-Konflikts, sahen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Wir wähnten uns sogar am Beginn einer neuen Epoche. Die Überlegenheit der Demokratie schien schlagend bewiesen, ihr weltweiter Siegeszug nur noch eine Frage der Zeit. Wir erinnern uns an Francis Fukuyama, den amerikanischen Politologen, der das "Ende der Geschichte" verkündete. Mit ihm glaubten viele - auch ich - an eine gerechtere, friedliche und demokratische Zukunft. // Die Hoffnung auf eine solche Veränderung weltweit, sie ist jedoch zerstoben. Statt weiterer Siege von Freiheit und Demokratie erleben wir vielerorts das Vordringen autoritärer Regime und islamistischer Fundamentalisten. Statt mit größerer Friedfertigkeit sind wir konfrontiert mit Terrorismus, mit Bürgerkriegen, imperialen Landnahmen und einer Renaissance von Geopolitik. Und die Gemeinschaft der Europäer, die vor 25 Jahren begann, Ost- und Westeuropa zusammenzuführen, sie findet sich nun mit der Euro-Rettung, auch hier und da mit Austrittsdiskussionen und vor allem mit der Bewältigung der Fluchtbewegungen mitten in einer Zerreißprobe. // Aber was heißt es nun, die innere Einheit wieder und neu zu erringen, wenn sich die Zusammensetzung der Bevölkerungen in kurzer Zeit so erheblich verändert? Wie schaffen es Staaten, wie schaffen es Gesellschaften, ein inneres Band zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen herzustellen? Und wie kann die Europäische Union Einvernehmen erreichen, wenn die Haltungen gegenüber Flüchtlingen noch so unterschiedlich sind? // Noch führt der Druck die europäischen Staaten nicht völlig zusammen. Allerdings zeigen die jüngsten Entscheidungen der Europäischen Union, dass die Einsicht wächst: Es kann keine Lösung in der Flüchtlingsfrage geben - es sei denn, sie ist europäisch. Wir werden den Zustrom von Flüchtlingen nicht verringern können - es sein denn, wir erhöhen unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Unterstützung von Flüchtlingen in den Krisenregionen, sowie vor allem zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Und auch das müssen wir uns klar machen: Wir werden unsere heutige Offenheit nicht erhalten können - es sei denn, wir entschließen uns alle gemeinsam zu einer besseren Sicherung der europäischen Außengrenzen. // Die Gewissheit über diese gemeinsamen Aufgaben hebt jedoch die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten nicht automatisch auf. In den aktuellen Debatten offenbaren sich unterschiedliche Haltungen aufgrund unterschiedlicher historischer Erfahrungen. Wir erleben das ja schon bei uns, im wiedervereinigten Land, der Bundesrepublik Deutschland. Westdeutschland konnte sich über mehrere Jahrzehnte daran gewöhnen, ein Einwanderungsland zu werden - und das war mühsam genug: ein Land mit Gastarbeitern, die später Einwanderer wurden, mit politischen Flüchtlingen, Bürgerkriegsflüchtlingen und Spätaussiedlern. Für die Menschen im Osten war es doch ganz anders. Viele von ihnen hatten bis 1990 kaum Berührung mit Zuwanderern. Wir haben erlebt: Die Veränderung von Haltungen gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderern kann immer nur das Ergebnis von langwierigen - auch konfliktreichen - Lernprozessen sein. Diese Einsicht sollte uns nun auch Respekt vor den Erfahrungen anderer Nationen ermöglichen. // Wenn wir Deutsche uns an die "Das Boot ist voll"-Debatten vor zwanzig Jahren erinnern, dann erkennen wir, wie stark sich das Denken der meisten Bürger in diesem Land inzwischen verändert hat. Der Empfang der Flüchtlinge im Sommer dieses Jahres war und ist ein starkes Signal gegen Fremdenfeindlichkeit, Ressentiments, Hassreden und Gewalt. Und was mich besonders freut: Ein ist ein ganz neues, ganz wunderbares Netzwerk entstanden - zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Es haben sich auch jene engagiert, die selbst einmal fremd in Deutschland waren oder aus Einwandererfamilien stammen. Auf Kommunal-, Landes- wie Bundesebene wurde und wird Außerordentliches geleistet. Darauf kann dieses Land zu Recht stolz sein und sich freuen. Und ich sage heute: Danke Deutschland! // Und dennoch spürt wohl fast jeder, wie sich in diese Freude Sorge einschleicht, wie das menschliche Bedürfnis, Bedrängten zu helfen, von der Angst vor der Größe der Aufgabe begleitet wird. Das ist unser Dilemma: Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich. // Tatsache ist: Wir tun viel, sehr viel, um die augenblickliche Notlage zu überwinden. Aber wir werden weiter darüber diskutieren müssen: Was wird in Zukunft? Wie wollen wir den Zuzug von Flüchtlingen, wie weitere Formen der Einwanderung steuern - nächstes Jahr, in zwei, drei, in zehn Jahren? Wie wollen wir die Integration von Neuankömmlingen in unsere Gesellschaft verbessern? // Wie 1990 erwartet uns alle eine Herausforderung, die Generationen beschäftigen wird. Doch anders als damals soll nun zusammenwachsen, was bisher nicht zusammengehörte. Ost- und Westdeutsche hatten ja dieselbe Sprache, blickten auf dieselbe Kultur zurück, auf dieselbe Geschichte. Ost- und Westdeutsche standen selbst in Zeiten der Mauer durch Kirchengemeinden, Verwandte oder Freunde in direktem Kontakt miteinander und wussten über die Medien voneinander Bescheid. Wie viel größere Distanzen dagegen sind zu überwinden in einem Land, das zu einem Einwanderungsland geworden ist. Zu diesem Land gehören heute Menschen verschiedener Herkunftsländer, Religionen, Hautfarben, Kulturen - Menschen, die vor Jahrzehnten eingewandert sind, und zunehmend auch jene, die augenblicklich und in Zukunft kommen, hier leben wollen und hier eine Bleibeperspektive haben. // Ähnlich wie bei den Zuwanderern seit den 1960er Jahren, aber wohl in größerem Ausmaß werden wir erleben: Es braucht Zeit, bis Einheimische sich an ein Land gewöhnen, in dem Vertrautes zuweilen verloren geht. Es braucht Zeit, bis Neuankömmlinge sich an eine Gesellschaftsordnung gewöhnen, die sie nicht selten in Konflikt mit ihren traditionellen Normen bringt. Und es braucht Zeit, bis alte und neue Bürger Verantwortung in einem Staat übernehmen, den alle gemeinsam als ihren Staat begreifen. // Wir befinden uns aktuell in einem großen Verständigungsprozess über das Ziel und das Ausmaß dieser neuen Integrationsaufgabe. So etwas ist in Demokratien auch verbunden mit Kontroversen - das ist normal. Aber meine dringende Bitte an alle, die mitdebattieren, ist: Lassen Sie aus Kontroversen keine Feindschaften entstehen. Jeder soll merken, wir debattieren, weil es uns um Zusammenhalt geht, um ein Miteinander, auch in der Zukunft. // Und wir nehmen aus unserer jüngeren Geschichte etwas mit, das wir niemals aufgeben dürfen: den Geist der Zuversicht. Wir haben nicht nur davon geträumt, unser Leben selbstbestimmt gestalten zu können, nein, wir haben es getan! Wir sind die, die sich etwas zutrauen. // Und so gestimmt fragen wir uns jetzt: Was ist denn das innere Band, das ein Einwanderungsland zusammenhält? Was ist es, das uns verbindet und verbinden soll? // In einer offenen Gesellschaft kommt es nicht darauf an, ob diese Gesellschaft ethnisch homogen ist, sondern ob sie eine gemeinsame Wertegrundlage hat. Es kommt nicht darauf an, woher jemand stammt, sondern wohin er gehen will und mit welcher politischen Ordnung er sich identifiziert. // Gerade weil in Deutschland unterschiedliche Kulturen, Religionen und Lebensstile zuhause sind, gerade weil Deutschland immer mehr ein Land der Verschiedenen wird, braucht es eine Rückbindung aller an unumstößliche Werte - einen Kodex, der allgemein als gültig akzeptiert wird. // Ich erinnere mich noch gut, welche Ausstrahlung die westlichen Werte bei uns in der DDR und in anderen Staaten des ehemaligen Sowjetblocks besaßen. Wir sehnten uns nach Freiheit und Menschenrechten, nach Rechtsstaat und Demokratie. Diese Werte, obwohl im Westen entstanden, sind zur Hoffnung für Unterdrückte und Benachteiligte auf allen Kontinenten geworden. Die Demokratie hat zwar seit 1990 keinen weltweiten Siegeszug angetreten, aber ihre Werte sind weltweit präsent, werden zunehmend nicht mehr als westlich, sondern als universell bezeichnet und verstanden. Und das ist richtig so. // Doch nicht immer und nicht überall vermögen sie jeden zu überzeugen, übrigens auch nicht bei uns. Wir wissen, dass selbst im Westen die eigenen Werte verletzt wurden und gelegentlich auch werden. Aber damit sind doch nicht die Werte diskreditiert, sondern diejenigen, die sie verraten. // Und diese, unsere Werte, sie stehen nicht zur Disposition! Sie sind es, die uns verbinden und verbinden sollen, hier in unserem Land. Hier ist die Würde des Menschen unantastbar. Hier hindern religiöse Bindungen und Prägungen die Menschen nicht daran, die Gesetze des säkularen Staates zu befolgen. Hier werden Errungenschaften wie die Gleichberechtigung der Frau oder homosexueller Menschen nicht in Frage gestellt und die unveräußerlichen Rechte des Individuums nicht durch Kollektivnormen eingeschränkt - nicht der Familie, nicht der Volksgruppe, nicht der Religionsgemeinschaft. Und vor diesem Hintergrund gewinnt der Satz, den wir alle kennen - Toleranz für Intoleranz darf es nicht geben - seine humane Basis. Und noch etwas: Es gibt in unserem Land politische Grundentscheidungen, neben den eben angesprochenen, die ebenfalls unumstößlich sind. Dazu zählt unsere entschiedene Absage an jede Form von Antisemitismus und unser Bekenntnis zum Existenzrecht von Israel. // Wir kennen keine andere Gesellschaftsordnung, die dem Individuum so viel Freiheit, so viele Entfaltungsmöglichkeiten, so viele Rechte einräumt wie die Demokratie. Sie mag mangelhaft sein, aber wir kennen keine andere Gesellschaftsordnung, die im Widerstreit von Lebensstilen, Meinungen und Interessen zu so weitgehender Selbstkorrektur fähig ist. Wir kennen auch keine Gesellschaftsordnung, die sich so schnell neuen Bedingungen anzupassen und zu reformieren vermag, weil sie - wie Karl Popper einmal sagte - auf einen Menschen baut, "dem mehr daran liegt zu lernen, als recht zu behalten". // Für eben diese Werte und für diese Gesellschaftsordnung steht die Bundesrepublik Deutschland. Dafür wollen wir auch unter den Neuankömmlingen werben - nicht selbstgefällig, aber selbstbewusst, weil wir überzeugt sind: Dieses Verständnis, kodifiziert im Grundgesetz, ist und bleibt die beste Voraussetzung für das Leben, nach dem gerade auch Menschen auf der Flucht streben. Ein Leben - wie es in unserer Nationalhymne heißt - in Einigkeit und Recht und Freiheit.
-
Die CDU hat die Idee der Freiheit nie dem Zeitgeist geopfert.
-
Die Politik von Wulff werde ich fortsetzen, mit meinen Worten.
-
Ein ungewöhnlicher, ein stolzer Anlass führt uns heute zusammen: Die deutsche Sozialdemokratie feiert ihren 150. Geburtstag. Keine andere Partei konnte so lange überdauern, weil ihre Kernforderungen auf immer neue Weise aktuell blieben und bleiben: Freiheitsrechte, soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe. // Dies ist ein Feiertag für die älteste Partei in Deutschland. Es ist auch ein Feiertag des europäischen Ringens um Freiheit und Demokratie. Es ist auch eine Geschichte voller Siege und Niederlagen, mit schrecklichen und abgründigen Kriegen, mit Aufstand und Widerstand, vor allem mit der Erkenntnis: Gesellschaften sind veränderbar, Demokratie ist möglich, wenn wir wissen, welche Werte wir mit ihr anstreben, verteidigen oder erkämpfen und wenn wir mutig genug sind, die Widerstände zu überwinden. // Immer lag und liegt es an uns, den Ohnmachtsgefühlen zu trotzen, für uns selbst und für andere Partei zu ergreifen und neue Entwicklungen anzustoßen. So viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben das in der bewegten Vergangenheit ihrer Partei mit unerschütterlicher Konsequenz getan, haben für ihre Überzeugungen viel riskiert: ihren Aufstieg, ihre gesellschaftliche Anerkennung, ihre Existenz und einige - viele - haben sogar ihr Leben hingegeben. // Es ist das Vermächtnis dieser mutigen Menschen, das Jubiläum nicht nur als "Ort der Erinnerung" zu betrachten. Wir fragen heute auch nach unseren Aufgaben in der Zukunft, fragen: Was bedeutet in der Perspektive von heute das alte "Vorwärts"? // Aber lassen Sie mich im Jahr 1863 beginnen, bei Armut und Ausbeutung, bei Arbeitsbedingungen, wie wir sie derzeit nur aus manchen Entwicklungsländern kennen und kritisieren und die damals für Millionen Deutsche bedrückender Alltag waren. Wie konnte die Reaktion derer aussehen, die die Kraft aufbrachten, sich zur Wehr zu setzen: Sollte es Aufruhr sein und dann Revolution und Errichtung einer neuen Herrschaft der zuvor Unterdrückten? Das wäre ja eine naheliegende Option gewesen. Aber Ferdinand Lassalle, der die Revolution von 1848 in der Rheinprovinz miterlebt hatte, fand eine andere Antwort auf Not und Unfreiheit. Wir hören sein Credo - Veränderung der Gesellschaft durch emanzipatorische Politik, die Massenteilhabe ermöglichen sollte. Dazu gehörte nun von Anfang an Bildung, Schulpflicht für alle, aber auch die Arbeiterbildungsvereine, die dem Einzelnen Aufstieg durch Wissen ermöglichten. Emanzipation gelang also durch Teilhabe an verbrieften Rechten, aber immer wieder auch durch Selbst-Ermächtigung. Dieser Ansatz war vor 150 Jahren revolutionär, modern ist er auch heute noch. // In der Gründungszeit der Sozialdemokratie stand selbstverständlich der Kampf für gleiche Rechte der unterdrückten Arbeiterschaft im Vordergrund. Das Eisenacher Programm von 1869 nennt zentral freie, allgemeine und gleiche Wahlen ungeachtet der Herkunft der Wählenden, das Verbot von Kinderarbeit und nicht zuletzt die Unabhängigkeit der Gerichte. // Im langen, innerparteilichen Kampf setzte sich die Haltung durch, keine neuen Klassenprivilegien zu errichten, Ungleichheit nicht durch neue Ungleichheit zu beantworten. Eduard Bernstein, der bedeutende und lange bekämpfte Theoretiker der SPD, bezeichnete die Demokratie dreieinhalb Jahrzehnte nach der Parteigründung durch Lassalle als "Mittel und Zweck zugleich". In diesem neuen Politikverständnis liegt für mich eines der wirklich größten historischen Verdienste seiner Partei. Es war die SPD, die bedeutende Teile der Arbeiterschaft und der sozialistischen Bewegung in Deutschland frühzeitig und intensiv und stark mit der Demokratie verband. Es war die SPD, die auf Reform statt auf Revolution setzte. Und es war die SPD, die den mühsamen und schließlich mehrheitsfähigen Weg beschritt, das Leben der Menschen konkret Stück für Stück zu verbessern, anstatt utopische Fernziele zu proklamieren. // Die kommunistische Weltbewegung entschied sich anders - allerdings mit durchgängig fatalen Folgen. Sie schuf eine neue Klasse der Machtbesitzenden und ersetzte die alte durch eine neue Ohnmacht. Auf Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand warteten die Arbeiter vergeblich. // Umso mehr wissen wir heute den reformerischen Ansatz der Sozialdemokratie zu würdigen. Ihm verdanken wir unter anderem die ersten Arbeitsschutzgesetze und das Frauenwahlrecht. Die erste deutsche Demokratie, die Republik von Weimar, wäre wohl nicht zustande gekommen, wenn nicht die Sozialdemokraten, an ihrer Spitze Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, den Mut gehabt hätten, sich für die politische Zusammenarbeit mit den gemäßigten Kräften der bürgerlichen Parteien einzusetzen. Vor allem haben die Sozialdemokraten diese Demokratie länger und tapferer verteidigt als die meisten anderen Demokraten. Sie haben die Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität hoch gehalten und aufbegehrt gegen jene, die Unfreiheit und Krieg entfesselten. // Unvergessen ist die Rede von Otto Wels am 23. März 1933, als die Nazis bereits viele Oppositionelle inhaftiert und in die Emigration getrieben hatten. "Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht": Es war - wie Peter Struck es einmal beschrieben hat - "die mutigste Rede, die je in einem deutschen Parlament gehalten wurde". // Das wollen wir uns merken. Damals haben 94 SPD-Abgeordnete mit ihrem Nein zum sogenannten Ermächtigungsgesetz nicht nur die eigene Ehre gerettet, sondern die der ersten deutschen Demokratie. Sie haben uns - nämlich allen Deutschen - ein Stück aufrechter Demokratiegeschichte geschenkt, ein Gegenstück zu Schuld und Scham, die kostbare Erfahrung, dass Menschen auch dann zu ihren Werten stehen können, wenn sie verhöhnt, gedemütigt und verfolgt sind. Dankbar würdigen wir heute ihren Mut. // Zu diesen Menschen gehörte Kurt Schumacher, einer der Abgeordneten, die das sogenannte "Ermächtigungsgesetz" ablehnten. Nach zehn Jahren KZ-Haft widerstand er nach dem Krieg der Versuchung, aus Sozialdemokraten und Kommunisten eine gemeinsame Arbeiterpartei zu schaffen. Denn er erkannte, dass die Kommunistische Partei Deutschlands - so seine Worte - "nicht eine deutsche Klassen-, sondern eine fremde Staatspartei" war. Im Osten Deutschlands konnte eine eigenständige SPD tatsächlich erst nach 1989 wieder entstehen. Auch dafür bin ich tief dankbar. // Im Westen Deutschlands hingegen hatte die SPD gemeinsam mit Konservativen und Liberalen entscheidenden Anteil daran, dass die Bundesrepublik ein funktionierender, breit legitimierter "demokratischer und sozialer Bundesstaat" werden konnte - so wie es unser Grundgesetz vorsieht, ein Dokument, das übrigens auch, wie wir alle wissen, an einem 23. Mai verabschiedet worden ist. // An Tagen wie heute wird uns bewusst, dass unsere Demokratie so stabil, bisweilen so anfällig war wie ihr jeweiliges Parteiengefüge. Die SPD kann nicht nur auf die längste Tradition der Parteien in Deutschland zurückblicken. Sie hat wohl auch den tiefgreifendsten inneren Wandel vollziehen müssen. Denn die SPD von heute ist ja keine Klassenpartei mehr. Sie hat sich im Zuge eines langen und schwierigen Lernprozesses zu einer Volkspartei entwickelt. Das Godesberger Programm von 1959 hat diesen Wandel dokumentiert, gefestigt und befördert. // Die Verdienste der SPD in der Bundesrepublik stehen den meisten von uns vor Augen. Ich nenne die gesellschaftlichen und sozialen Reformen der 70er Jahre unter Willy Brandt, ich nenne die erste, die innovative Phase der Ostpolitik, die eine Öffnung gegenüber der DDR und anderen osteuropäischen Nachbarn ermöglichte und den Eisernen Vorhang durchlässiger machte. // Der Film hat uns auch das Wirken der Bundeskanzler Helmut Schmidt und Gerhard Schröder in Erinnerung gerufen, die heute beide unter uns sind. Auch mit ihrer Kanzlerschaft sind bleibende Verdienste der SPD für die Bundesrepublik verbunden. // Das Kernthema der Sozialdemokratie ist in 150 Jahren geblieben: die solidarische Gesellschaft, die sich beständig verbessernde Demokratie. Aber in der veränderten Welt von heute stellen sich für die SPD wie für alle anderen Parteien auch neue Herausforderungen. Dazu gehört zentral, dass Parteien immer auch Teil einer sich selbst ermächtigenden Bürgergesellschaft sein müssen und erst dann belastbare Bindungen herstellen können für ein umfassendes politisches Programm. // Keine leichte Aufgabe, denn in den letzten Jahren haben wir viele Protestbewegungen erlebt, die oftmals radikaler waren als die Volksparteien und sich - oft in der Konzentration auf nur ein Thema - auch als ihre Gegenspieler darstellen konnten. Sie zeigten den Willen vieler Bürger zur Mitsprache. Das begrüße ich und unterstütze ich. Die Parteien sollten sich davor nicht fürchten, sondern umgekehrt derartige Formen der Beteiligung als so etwas wie ein Frühwarnsystem verstehen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Zugleich brauchen neue Partizipationsformen aber auch umgekehrt die Parteien, damit deren Impulse auf dem Weg der parlamentarischen Demokratie ihren Weg in unseren Alltag finden. Kurz: Neue Beteiligungsformen sind eine wichtige Ergänzung, aber sie sind kein Ersatz für die repräsentative Demokratie. // Schauen wir uns das noch einmal an - in einer Frage wird dies besonders deutlich: Bürgerinitiativen vertreten - zumeist berechtigte - Partikularinteressen, Parteien hingegen müssen stärker allgemein ausgerichtet sein, das Ganze im Blick behalten. Manchmal gelingt es Parteien sogar, gerade den eigenen Wählern Zumutungen aufzuerlegen, mit Entscheidungen, die bisherigen Linien oder kurzfristigen Parteiinteressen widersprechen. Ich weiß, so etwas ist innerhalb einer Partei nicht populär. Aber wir haben erlebt: Gerade solche Entscheidungen waren oftmals verantwortungsbewusste Entscheidungen für das ganze Land! // Heute gratuliere ich der SPD zu 150 Jahren ihres Bestehens. Ich sage Dank und Anerkennung all jenen, die in 150 Jahren für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gekämpft haben und damit das Leben von Millionen Menschen verbessert haben. // Ich verbinde diesen Dank an die SPD mit meiner Anerkennung für alle, die in allen demokratischen Parteien für unser Gemeinwohl arbeiten - ob im Ortsverein oder in der Europapolitik, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Ihr Wirken trägt zum Gelingen unserer Demokratie bei. Deshalb gratuliere ich auch uns allen - dazu, dass wir unsere demokratischen Parteien haben. Sie sind wie alle menschlichen Geschöpfe mangelhaft und unvollkommen und tun deshalb gut daran, offen für Kritik und Selbstkritik, also lernfähig, zu sein. Unsere demokratischen Parteien waren immer notwendig für das Leben unserer Demokratie und sie werden auch in Zukunft unentbehrlich sein. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
-
Es ist schön, hier zu sein. Viele Menschen sind zusammengekommen, um miteinander "Ja" zu sagen zum Alter. Ich gehöre dazu. Ich stehe heute vor Ihnen als Verbündeter: Als einer, der hoffentlich bald zum dritten Mal Urgroßvater wird und der jetzt, mit 72 Jahren, eine neue, schöne und ehrenvolle Aufgabe übernehmen durfte und als einer, der Hoffnungen hat und Pläne und so das Motto dieses Seniorentages auf seine ganz eigene Gaucksche Weise mit Leben erfüllt. // Ihr Motto "Ja zum Alter!" gefällt mir. Aber je älter ich werde, desto mehr frage ich mich: Muss das eigentlich extra betont oder gar eingefordert werden? // Dass wir altern, ist ja nicht neu. Seit Menschengedenken fragen wir uns, was das Alter uns bringen wird. Die großen Philosophen und Denker haben sich mit diesem Thema befasst. Platon in seiner "Politeia", Cicero in seinem fiktiven Dialog "Cato der Ältere über das Alter", Jacob Grimm in seiner "Rede über das Alter" oder Ernst Bloch im "Prinzip Hoffnung": Sie alle und noch viele andere haben sich mit dem Alter beschäftigt. // Neu ist, dass so viele von uns um so viel älter werden - eine rasante Veränderung, die seit etwas mehr als einem Jahrhundert in Gange ist. Welch ein Segen für die, die nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkel und sogar Urenkel aufwachsen sehen dürfen! Das war ja in anderen Generationen meistens anders. Historisch neu ist, dass ein materiell abgesicherter Lebensabend heute nicht nur Privileg von ganz wenigen ist. Welch ein Glück, wenn man mit seinem Leben etwas anzufangen weiß! Und welch ein Gewinn, wenn wir mit den geschenkten Jahren auch in der Gesellschaft gut miteinander umzugehen lernen! // Das "wenn" ist wichtig. Denn mit dem Altern verbinden sich auch viele Befürchtungen. Landauf, landab werden sie debattiert: Da ist die Sorge, dass unserer Gesellschaft die Ideen ausgehen, dass die Netze der sozialen Sicherung zerreißen könnten, dass die Kosten für Pflege und Gesundheit explodieren könnten. Da ist auch die Angst vor Armut im Alter, vor Einsamkeit und davor, ein "Pflegefall" zu werden - was für ein schreckliches und eigentlich auch verräterisches Wort - ist das, was einst ein Mensch war, ist das dann nur noch ein "Fall", Pflegefall eben? // So berechtigt die Befürchtungen im Einzelnen sind - wir dürfen uns von ihnen nicht überwältigen und vor allem nicht einschüchtern und nicht ängstigen lassen. Wir sollten sie als Anstoß nehmen, die Dinge anders und besser zu gestalten. Die höhere Lebenserwartung ist uns schließlich auch nicht einfach in den Schoß gefallen, sie ist erarbeitet und manchmal auch erkämpft worden, von Ihnen, von unseren Vorgängern. Sie ist eine Leistung unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft und jedes Einzelnen. Wir leben gesünder, wir bekämpfen erfolgreich viele Krankheiten, wir arbeiten sicherer. Und so liegt es jetzt auch in unserer Verantwortung, das längere Leben zu einem Gewinn für alle zu machen. Und dort, wo aus Krankheitsgründen von Gewinn nun wahrlich keine Rede mehr sein kann, soll es jedenfalls darum gehen, vom Wert und von der Würde derer zu sprechen, die dieses für sich selbst nicht mehr zu reklamieren vermögen. // Die gewonnenen Lebensjahre, meine Damen und Herren, schenken uns Freizeit und Freiheit: die Freiheit, entlastet von vielen äußeren Zwängen, unsere Fähigkeiten nun weiter zu erproben und vielleicht auch weiterzugeben. Sie geben uns zugleich eine Verantwortung auf: die Verantwortung, unser Leben, solange irgend möglich, selbst zu gestalten und - was besonders schön und erfüllend ist - unsere Fähigkeiten so einzusetzen, dass das individuelle Glück des längeren Lebens auch ein Glück für unser Gemeinwohl bleibt oder wird. "Ja zum Alter!" heißt also für mich: "Ja" zum eigenverantwortlich gestalteten Leben, und "Ja" zu den Veränderungen, die wir dafür als Einzelne und als Gesellschaft anstoßen, manchmal auch ertragen müssen. // So setzen wir uns in Beziehung zur Lebenswelt unserer Enkel und Urenkel. Was wird sie erwarten, wenn sie erwachsen sind? Wie wird es aussehen, ihr Land - wird es ein Land sein, in dem alle Lebensalter menschenwürdig und verantwortlich miteinander zusammenleben? // Eines sollten wir auf jeden Fall begriffen haben: Das Alter gibt es nicht, ebenso wenig wie die Alten. Den einen versagen schon mit Mitte 60 die geistigen oder körperlichen Kräfte, die anderen können noch mit über 90 völlig klar denken und sich selbst versorgen. Wir altern so individuell, wie wir unser Leben führen, und so gut, wie es unser Schicksal und die Umstände im Lande es erlauben. Ebenso wenig gibt es den Rentner oder die Rentnerin. Manche sind kinderlos, andere haben Enkel oder gar Urenkel, die einen sind lebensfroh, die anderen frustriert. Manche können ihren Lebensabend in Wohlstand genießen, andere beziehen Renten, die kaum zum Leben reichen. Manche übrigens trotz eines Lebens voll harter Arbeit. Derartiges dürfte es ja eigentlich in diesem reichen Land gar nicht geben, nicht wahr? Aber schauen wir auf die Gesamtheit. Und da sieht es so aus, dass die heutige ältere Generation die wohlhabendste und gesündeste ist, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und während ich diesen Satz spreche, frage ich mich zugleich: Ist es eigentlich auch die dankbarste Generation, die es jemals gegeben hat? // Es gilt Anspruch und Wirklichkeit aneinander anzupassen. Unsere Ansprüche an den Ruhestand, unsere Vorstellungen davon, wann er beginnt und was wir mit dieser Zeit anfangen, mit der Wirklichkeit der neuen, hinzugewonnenen Jahre. Das ist unter anderem auch ein Gebot der volkswirtschaftlichen Vernunft, nicht nur, aber auch. Es ist nötig, um die Errungenschaft des Ruhestandes auch kommenden Generationen zu erhalten. Aber es ist auch in unserem eigenen Interesse. // Wir wissen doch, wie glücklich es macht, wenn wir unsere Fähigkeiten einsetzen und etwas erreichen können. Wenn wir herausholen, was in uns liegt an Kraft, an Potenz, an Verantwortungsfähigkeit. Ich bin überzeugt, dass wir gestalten können und müssen, damit es uns gut geht. Und ich glaube fest daran, dass wir Menschen lern- und begeisterungsfähig sind bis ins hohe Alter hinein - da weiß ich auch die Wissenschaft auf meiner Seite, unter dem Stichwort "Plastizität des Gehirns". Hannah Arendt hat einmal gesagt: "Verstehen beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod." Das ist die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen sollten! // Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die von uns Älteren erwartet, veränderungsbereit zu sein, die uns die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen auch gibt, und damit die Grundlage, lebenslang tätig zu sein. "Tätig zu sein ist des Menschen erste Bestimmung", so heißt es schon in Goethes "Wilhelm Meister". Das mag manchem Bild vom Ruhestand konterkarieren. Aber ist es nicht im Grunde viel kraftraubender, wenn man sein Leben nur auf seine Tätigkeit ausrichtet, und mit der dann plötzlich schlagartig aufhört, auf Kosten der Vielfalt an Fähigkeiten, die doch immer noch in uns stecken? Viele geraten dann in eine regelrechte Krise, wenn plötzlich Anerkennung durch Arbeit und Leistung und damit auch durch das soziale Umfeld wegbrechen. // Ich wünsche mir, dass jene, die es wollen, länger im Beruf bleiben können - unter besseren Bedingungen täten das bestimmt heute schon viele. Dazu gehört auch, dass ich mir wünsche, dass wir individuelle Übergänge ermöglichen: zwischen den Lebensphasen und zwischen unterschiedlichen Arten des Tätigseins. Ich wünsche mir, dass wir Älteren eine Chance geben, sich weiter zu entwickeln, ihnen Achtung und Wertschätzung entgegenbringen und ihren Bedürfnissen pragmatisch entgegenkommen. // Gewiss ist es nicht jedem vergönnt, bis ins hohe Alter tätig zu bleiben. Es gibt Krankheiten, Schicksalsschläge. Mancher ist früh ausgelaugt, von lebenslanger harter Arbeit und lebenslangen Strapazen. Deshalb wünsche ich mir auch: Niemandem soll Unzumutbares zugemutet werden. Aber das Zumutbare schon, denn wir alle wissen doch, wir tun einander auch nichts Gutes, wenn wir nichts von uns erwarten. Ich tue mir nichts Gutes, wenn ich nichts von mir erwarte. Ich rede in diesem Zusammenhang ganz bewusst nicht nur vom Broterwerb, sondern ich rede von Tätigkeit. // Warum, so werden mich meine Urenkelkinder vielleicht später fragen, hattet Ihr früher Euer Zusammenleben eigentlich so eingerichtet, dass den Jüngeren oft die Zeit gefehlt hat - und vielen Alten die Decke auf den Kopf gefallen ist? Und wenn sie so fragen, hätten sie recht. Warum teilen wir all diese Tätigkeiten, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde, nicht besser auf zwischen den Generationen und Geschlechtern - die Sorge um Kinder, die Sorge um ältere Angehörige, die Arbeit im Haushalt, das Engagement in der Nachbarschaft, in der Zivilgesellschaft und in den Ehrenämtern? Je selbstverständlicher wir schon in unseren jungen Jahren zwischen all diesen Sphären wechseln, desto selbstverständlicher wird das auch im Alter sein, nicht nur für uns, sondern auch für andere tätig zu bleiben. Es fasziniert mich immer wieder, dass es dieses abrupte Ausscheiden, wie wir es aus dem Berufsleben kennen, bei denen selten gibt, die ehrenamtlich über lange, lange Jahre aktiv gewesen sind in ihren verschiedenen sozialen Bereichen. Sei es im kirchlichen, im kulturellen, im sportlichen Bereich. Da gibt es diesen Abbruch zwischen tätig und aktiv sein und dann Ruhekissen überhaupt nicht so. Das ist ein guter Hinweis auf die Art und Weise, wie wir aktiv in dieser Lebensphase uns selber finden und unserer Gesellschaft nützen können. // Es gibt im Übrigen viele gute Ansätze für diese Art von Aktivität, von Einbezogensein in das Leben in der Gesellschaft. Immer mehr Bürgerstiftungen organisieren Gemeinsinn und bieten die Plattform, mit seinem Geld und seiner Zeit etwas Sinnvolles für das Allgemeinwohl zu leisten. Es gibt Leihomas oder -opas. Ich weiß nicht, ob die eine Antwort auf jedes Problem sind, aber immerhin will ich mich freuen, dass es sie gibt. Denn vielfach ist es so, dass es gar keine Großeltern an dem Ort gibt, wo die jungen Menschen leben und schaffen. Manche haben auch gar keine Enkelkinder und wünschten sich, gerade einmal dieser Generation begegnen zu können. Wir haben die Senior Experten. Sie teilen ihr Wissen mit den Jüngeren, bringen Erfahrungen ein aus dem weiten Feld ihres Berufslebens, helfen in Gründungsphasen von Unternehmungen oder geben Rat in Krisensituationen einer Firma oder einer beruflichen Karriere. Immer öfter ziehen Ältere und Jüngere, Familien und Singles bewusst zusammen, weil sie einander helfen und ergänzen wollen. In Seniorengenossenschaften - wie der im baden-württembergischen Riedlingen, die es seit über 20 Jahren gibt - helfen die, die noch können und rüstig sind, denen, die nicht mehr so gut auf den Beinen sind, gegen ein kleines Entgelt oder nur gegen das Versprechen, dass ihnen selbst später von anderen geholfen wird. Und es spricht vieles dafür, dass wir im mittleren Alter anderen das geben, was wir uns selbst fürs hohe Alter selber dringlich wünschen - Zuwendung, liebevolle Pflege bei weitestgehender Autonomie. // Selbstverantwortung ist in unserer Gesellschaft ein hoher Wert. Wir wissen aber natürlich auch, dass ein Moment kommen kann, in dem wir nur noch sehr bedingt selbst steuern können, was mit uns passiert. Diese Lebensphase zu akzeptieren als eine, in der die gewohnten Kategorien von Selbstverantwortung, Leistung und Nützlichkeit gar nicht mehr zählen - ja nicht mehr zählen dürfen -, ist eine der großen Herausforderungen, der wir uns zu stellen haben. Hier wird sich die Menschlichkeit unserer alternden Gesellschaft erweisen. // Wir alle werden hier sehr viel neu oder wieder neu lernen müssen, denn es wird nicht gehen ohne die Haltung von Barmherzigkeit - oder nennen Sie es einfach Solidarität miteinander. Und vielen Menschen sind solche Werte in ihren beruflichen Lebensläufen ja leider abhanden gekommen. So müssen wir zum Teil wieder erlernen, was wir eventuell früher einmal gewusst, aber dann verlernt haben bei unseren mannigfachen Formen von Egotrips oder unsozialen Arbeitsverhältnissen. // Eine weitere Herausforderung ist, zukunftsfähig zu bleiben. Früher hieß es, wir müssten die Alten fürchten, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben. Heute fürchten viele eher die Angst der Alten vor dem Neuen. Doch der Unmut der Älteren muss uns nur dann Sorgen machen, wenn er sich aus einer generellen Abneigung jeglicher Veränderungen speist oder, was es auch gibt, aus rein egoistischen Motiven. Die meisten Älteren sind aber nicht einfach nur "Wutbürger". Sie nehmen eine ganz andere und wichtige Verantwortung wahr: kommenden Generationen ein funktionierendes Gemeinwesen zu hinterlassen. Es ist wichtig, ihre Stimme zu hören und abzuwägen: Was ist es wert, bewahrt zu werden gegen den Furor des Fortschritts - und was muss sich wirklich ändern? Und es ist gut, wenn möglichst viele der Älteren interessiert sind und bleiben. Denn wer interessiert ist, ist dazwischen, mittendrin, bringt er sich ein. // Wie gut es gelingt, dieses Interesse wach zu halten, wird auch die Zukunft unserer Demokratie mit beeinflussen. Franz Müntefering, den ich hier vorne sehe, übrigens genau acht Tage älter als ich, hat einmal den schönen Satz gesagt: "Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl. Solange der Kopf klar ist, ist man mitverantwortlich." Und damit, meine Damen und Herren, meint er doch sicher, nicht nur für das, was uns jeweils ganz persönlich betrifft, sondern auch für das sind wir verantwortlich, was nach uns kommt, was wir weitergeben an unsere Kinder und Enkel. Ich bin sicher, Sie, meine Damen und Herren, leben genau diese Verantwortung, deshalb sind Sie hier, und deshalb danke ich Ihnen, all den Aktiven in ihrem Verband, Frau Professorin Lehr, und allen, die sich hier so engagiert einbringen. Was wäre unsere Gesellschaft ohne Ihr aktives Mittun. // Mir ist darum nicht bang, meinen Urenkeln sagen zu können: Wir werden das schaffen. Wir werden den Gewinn an Lebenszeit besser teilen - zum Vorteil von Alten und Jungen, zum Vorteil der Gesellschaft wie des Einzelnen. Wir werden das Alter als eine besondere Phase unseres Lebens schätzen und diese verantwortlich gestalten. Wir werden erkennen, dass die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen einer Gesellschaft des langen Lebens nur dann bedrohlich sind, wenn zu starr an bisherigen Systemen, Vorgaben und Eckpunkten festgehalten wird. // Wenn wir viele sind, die so denken, dann wird auch das Loslassen einst, wenn die Kräfte schwinden, uns keine Angst machen. Ich bin dankbar für die Begegnung mit Menschen, die von dem Geschenk des Alters sprechen können. Ich gebe ehrlich zu, ich muss das noch lernen, so zu sprechen. Vor etwas über 100 Jahren schrieb Rainer Maria Rilke an einen Freund: "Ich glaube an das Alter, lieber Freund, Arbeiten und Altwerden, das ist es, was das Leben von uns erwartet. Und dann eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen, nein, aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und Unsagbarem, bis in die Sterne hinein." Welch eine Eloge auf die Möglichkeiten des Alters! // Wir alle haben nicht die poetischen Gaben eines Rainer Maria Rilke. Aber wir alle hatten und haben einen Schatz an Erfahrungen und Wissen, haben erworbene Geduld und erhaltene Ungeduld, wir haben nicht die alte, aber die uns jetzt mögliche Fähigkeit, Verantwortung zu leben. Und mit alledem kann es uns doch gelingen, unser "Ja zum Alter" zu sprechen, zu leben.
-
Es sind dies bewegte Zeiten - auch für Sie, lieber Herr Schröder. In den vergangenen Wochen standen Sie im Mittelpunkt des medialen Interesses. Ihre aktuellen Äußerungen und Ihre Aktivitäten sind viel diskutiert worden. Daran möchte ich heute ausdrücklich nicht anknüpfen. Denn wir treffen uns hier zu Ehren eines Mannes, eines Bundeskanzlers, der im Amt unser Land entscheidend vorangebracht hat. Um dieses Verdienst soll es uns heute gehen. // Knapp zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Einheit in Freiheit wurden Sie, lieber Herr Schröder, zum Bundeskanzler gewählt. Die Welt schien nach dem Ende des Kalten Krieges, wiewohl nicht frei von Konflikten, so doch sicherer geworden zu sein. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts ereignete sich mit den Terroranschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Center nicht weniger als eine Zeitenwende in der internationalen Politik - mit denen große innen- wie außenpolitische Herausforderungen für Sie und Ihre Regierung einhergingen. // Viel ist über Ihren persönlichen Weg von Bexten und Talle über Göttingen und Hannover nach Bonn und schließlich nach Berlin geschrieben worden. Wichtig scheint mir, dass Sie in einer von materiellen Entbehrungen und sozialer Ausgrenzung geprägten Kindheit lernten, wie bedeutsam Zielstrebigkeit und Ehrgeiz sind. Auch wussten Sie schon früh, was Zusammenhalt bedeutet und wie wichtig die Unterstützung durch andere für jeden von uns ist. Für Sie war die größte Unterstützerin Ihre Mutter, deren unermüdlichen Einsatz für ihre Kinder, auch unter schwierigsten Bedingungen, Sie in bewegenden Worten öffentlich gewürdigt haben. // Mit Entschlossenheit und Disziplin haben Sie Ihren beruflichen Traum verwirklicht. Eigentlich war es nicht nur ein Traum, es waren zwei: In der Abendschule machten Sie das Abitur und studierten anschließend Jura, um als Rechtsanwalt zu arbeiten. Das ist an sich schon bemerkenswert. Das gilt übrigens auch für die politischen Schlüsse, die Sie aus Ihrem eigenen Weg zogen: Von "Dankbarkeit gegenüber einem Staat, der es mir doch ermöglicht hatte, den ersten Schritt nach oben zu tun" haben Sie später berichtet. Diese Dankbarkeit zeigte sich wohl auch in jenem gesunden Pragmatismus, mit dem Sie manch eigenartigen Formen der 68er begegneten. Sie anerkannten zwar das richtige Bestreben, drängende Fragen an die Elterngeneration zu richten und die Gesellschaft zu öffnen. Aber Sie wandten sich der mühevollen politischen Praxis zu und damit dem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern - nicht in der marxistischen Theorie, sondern in der konkreten Realität. // Danach gelang Ihnen auch noch, höchste politische Ämter zu erreichen - Sie wurden Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Ministerpräsident Niedersachsens, Vorsitzender Ihrer Partei und schließlich Bundeskanzler. Dieser unbedingte Wille zum Aufstieg hat mich beeindruckt. Damit sind Sie ein herausragendes Beispiel dafür, welche Aufstiegsgeschichten die Bundesrepublik zu erzählen hat."Bildungschancen sind stets Lebenschancen. [ ] Ich habe es selber gespürt." Diese eigene Erfahrung und der Antrieb, möglichst allen Kindern gute Bildungs- und Lebenschancen zu ermöglichen, wurden zum Movens auch Ihrer Arbeit als Bundeskanzler. Mancher hier im Saal wird dabei etwa an das 4 Milliarden Euro starke Investitionsprogramm des Bundes für verlässliche Ganztagsschulen denken, das Sie seinerzeit durchsetzten. // In Ihre Amtszeit als Bundeskanzler fallen zahlreiche Ereignisse, die man - wie auch immer man sie im Einzelnen bewertet - als zeitgeschichtliche Wegmarken bezeichnen muss. Nach Ihrem Wahlsieg 1998 schlossen Sie das erste rot-grüne Bündnis auf Bundesebene. Politisch betrachtet wurde die Republik bunter. // Ihr damaliges Bündnis ist vielfach beschrieben und charakterisiert worden, von den Medien wie von den Protagonisten selbst. Nicht nur ein Generationenwechsel war das, nach 16 Jahren Kanzlerschaft Helmut Kohls. Auch so etwas wie ein Neubeginn, ja ein Aufbruch, verband sich für viele Menschen mit der rot-grünen Bundesregierung. Als dritter Sozialdemokrat nach Willy Brandt und Helmut Schmidt wurden Sie Bundeskanzler, und erstmals überhaupt in der Bundesrepublik gelang es Ihnen, eine amtierende Bundesregierung abzulösen und eine vollständig neue Regierungsmehrheit anzuführen. // Nur wenige Monate nach der Wahl mussten Sie über eine der grundsätzlichsten Fragen entscheiden, die sich ein deutscher Regierungschef nur vorstellen konnte: ob deutsche Soldaten in einen Kampfeinsatz geschickt werden sollen, zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Gemeinsam mit dem damaligen Außenminister Joschka Fischer machten Sie deutlich, worum es bei diesem Einsatz ging: schweren Menschenrechtsverletzungen im zerfallenden Jugoslawien und damit mitten in Europa ein Ende zu setzen und, so haben Sie es beschrieben, "an der Schwelle zum 21. Jahrhundert den neuerlichen Brandherd auf dem Balkan nicht nur zu löschen, sondern die Region zu einem friedlichen Miteinander zu bringen". Der Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan - uns allen steht vor Augen, wie ernsthaft und verantwortungsvoll Sie und Ihre Regierung damals mit dieser Entscheidung rangen. // Ein weiterer Einschnitt in der politischen Geschichte der Bundesrepublik war zweifellos der Regierungsumzug nach Berlin im Sommer 1999. Als Kanzler waren Ihnen die Besonderheiten der deutsch-deutschen Geschichte ganz besonders präsent: Während der ersten beiden Regierungsjahre war das Kanzleramt provisorisch im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude untergebracht. Ihr Blick aus dem Fenster fiel damals noch auf den "Palast der Republik". Der Blick auf das Alte half Ihnen offenkundig dabei, Innovationen zu wagen: Ich denke zum Beispiel an das bis heute bestehende Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. // Als Bundeskanzler war Ihr Blick in die Vergangenheit wie in die Zukunft gerichtet. Sie brachten die lange überfällige Entschädigung für die ehemaligen NS-Zwangsarbeiter ebenso auf den Weg wie richtungsweisende Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsreformen, etwa - damals heißumstritten - ein zeitgemäßeres Staatsbürgerschaftsrecht und die eingetragene Lebenspartnerschaft. Schon in Ihrer ersten Regierungserklärung am 10. November 1998 setzten Sie sich mit der Rolle Deutschlands auseinander: "Wir sind stolz auf dieses Land. Was ich hier formuliere, ist das Selbstbewusstsein einer erwachsenen Nation, die sich niemandem über-, aber auch niemandem unterlegen fühlen muss." // Diese veränderte Rolle der Bundesrepublik zeigte sich auch darin, dass Sie als erster deutscher Bundeskanzler zu den Feierlichkeiten anlässlich der Jahrestage der Landung der Alliierten in der Normandie, der Niederschlagung des Warschauer Aufstands und zur Erinnerung an das Kriegsende nach Moskau eingeladen wurden. // Sie selbst waren, wenn Sie sich entschlossen hatten, in Ihrem politischen Handeln konsequent. Und Sie scheuten auch Risiken nicht: Die Entscheidung über die deutsche Beteiligung am Afghanistan-Einsatz verbanden Sie im Bundestag mit der Vertrauensfrage, nachdem Sie den Vereinigten Staaten von Amerika Deutschlands" uneingeschränkte Solidarität" ausgesprochen hatten. Die Bereitschaft Deutschlands, im Bündnis mit seinen Partnern "Ja" zu wohlüberlegter außenpolitischer und, wenn nötig, militärischer Verantwortung zu sagen, verbindet sich ebenso mit Ihrer Kanzlerschaft wie Ihr entschlossenes "Nein" zu einer deutschen Beteiligung am Irakkrieg. // Auch innenpolitisch waren Sie bereit, unpopuläre Schritte zu gehen und die Folgen zu akzeptieren. Dazu gehören natürlich die Reformen der "Agenda 2010", für die Sie zunächst hart kritisiert wurden. Doch Sie haben mit Weitsicht dazu beigetragen, dass unser Land seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiedergewinnen und dann erhalten konnte. // Über die "Agenda 2010" sagten Sie rückblickend: "Wenn Sie eine solche umfassende Reform einleiten wollen, müssen Sie die notwendigen und schmerzhaften Entscheidungen jetzt treffen, während Sie die positiven Folgen dann drei Jahre später sehen. Dadurch entsteht eine Zeitlücke - und in diese Zeitlücke kann demokratisch legitimierte Politik fallen." // Der französische Politiker und Denker Talleyrand sagte, kein Abschied auf der Welt falle schwerer als jener von der Macht. Sie mussten nach einer vorgezogenen Wahl 2005 Abschied von der Macht nehmen. Leicht ist es Ihnen nicht gefallen, das haben Sie später selbst gesagt. Doch auch wenn die Macht verloren geht, so bleibt doch ein Stück Verantwortung für das Land - auch nach der Amtszeit. // Lieber Herr Schröder, Sie haben als Bundeskanzler der Weitsicht - und damit der Zukunft unseres Landes - den Vorzug gewährt, dafür gebührt Ihnen großer Respekt. So danke ich Ihnen für Ihre bleibenden Verdienste. // Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie Ihr Glas auf Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf. Auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohl!
-
Es war mir in meinem Leben so wenig gesungen, Präsident zu werden, wie es Karl Carstens geschehen ist. Er kam nicht aus erlauchten Kreisen, sondern hat sich seinen Weg von unten an die Spitze einer freien Republik gebahnt. Und dass ich, der ich vom Osten her so oft sehnsüchtig ins Fernsehen geschaut habe auf das, was sich hier im deutschen Parlament der Freiheit abgespielt hat, an diesem Ort verschiedene Male sprechen kann und nun auch einen Bundespräsidenten würdigen kann, das ist ein besonderes Geschenk der Geschichte. Und es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. // Wir ehren heute einen Mann, dessen Dienst am Gemeinwesen wir als herausragend empfinden, dessen Einsatz zur Förderung des freiheitlich verfassten Staates vorbildlich war. Deshalb treffen wir uns hier in guter Laune und mit Zuversicht, weil die Erinnerung an eine solche Haltung und an ein solches Wirken uns selber stärken soll. Karl Carstens' pragmatischer Realismus, sein Pflichtbewusstsein und die überzeugende Repräsentanz der Demokratie und unseres Gemeinwesens, das kann uns bis heute Orientierung geben. Als Realist und Pragmatiker war er bekannt. In der Rückschau treten aber auch jene Elemente seines Denkens hervor, die hineinragen bis in unsere Zeit. // Deshalb bin ich der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr dankbar, dass sie zu dieser Gedenkstunde zum 100. Geburtstag von Karl Carstens eingeladen hat - ich bin dieser Einladung gern gefolgt. // Denn damit wird uns Gelegenheit gegeben, die Welt des Karl Carstens neu zu betrachten und seine Republik - unsere Republik! - geistig zu durchwandern. Ja, wandern. // Mit dem "Wander-Präsidenten" begeben wir uns also noch einmal zurück in jene Zeit. // Beim Wandern, das spürt man, kommt gelegentlich die Heiterkeit auf, die damals die Zeitgenossen bewegte. Das begann schon während seiner Antrittsrede, da hat er die deutsche Öffentlichkeit darüber informiert, er werde die Republik im Laufe seiner Amtszeit durchwandern, zu Fuß, etappenweise, von der Ostsee bis zu den Alpen. Natürlich gibt es Kritiker, wenn man ein solches Vorhaben ankündigt. // Und die haben dann gleich geschlossen: altbacken, irgendwie provinziell! Wandern: Wer macht das schon? Irgendwie traditionalistisch, dieser Bundespräsident. Und das nach den wilden Zeiten der 1968er Ära. // Dabei hatte Karl Carstens einen interessanten Plan. Einerseits konnte er eine Zeitströmung aufnehmen und sie zugleich auf eine zurückhaltende Weise ein wenig hinterfragen. Die Sorge um die Umwelt hatte damals besonders junge Leute ergriffen. Carstens teilte diese Sorge durchaus, wollte sich aber der generellen Wachstums- und Zivilisationskritik entgegenstellen. Es war natürlich auch das Milieu, aus dem heraus sehr forciert diese Themen angebracht wurden, von der damals sehr jungen grünen Bewegung. Das lag Carstens nicht, das müssen wir ja nicht verbergen. // Er machte sich dann auf seine Weise daran, die Naturschönheiten Deutschlands zu erkunden - zu Fuß. Das war eine ganz eigenartige, als Norddeutscher würde ich sagen, eine gediegene Einladung an das Bürgertum, ein bisschen genauer hinzuschauen, was unser Land eigentlich ausmacht. Damals gab es als Herausforderung das sogenannte "Waldsterben". Während der Wanderungen sah Carstens sich auch Demonstranten gegenüber, die darauf in besonderer Weise aufmerksam machten. Er konnte dann auf seine Weise Gespräche führen, beispielsweise über die Idee, bleifreies Benzin einzuführen. // "Unterwegs", so schrieb eine große Zeitung, "unterwegs ging den Spöttern die Luft aus". Der Bundespräsident war ja mit offenen Augen unterwegs. Und so begegnete er auf seinen Wanderungen nicht nur der Fichte und der Tanne, dem Bärwurz und dem Sonnentau, sondern er begegnete Menschen, und zwar sehr vielen Menschen. Anfangs waren es dutzende, die ihn begleiteten, später hunderte, schließlich tausende. Sie brachten gerne auch Proviant mit und Geschenke oder sangen ihm etwas vor. Das war dann so eine wunderbare Begegnungsmöglichkeit mit den Bürgern. Nach 60 Tagen und 1600 Kilometern war Karl Carstens und seiner Frau Veronica, die ihn oft begleitete, keine Sorge mehr fremd, die es in diesem Land gab. // Bei Amtsantritt hatte der Bremer Karl Carstens eher als norddeutsch-kühl gegolten, vielleicht auch als hanseatisch-streng. Aber nun zeigte sich seine Wärme, auch Herzlichkeit. Er konnte Nähe herstellen und Barrieren niederreißen. Er zeigte - wie auch sein Vorgänger Walter Scheel -, dass sich die Würde des Amtes durchaus mit Bürgernähe verträgt. Eine Kluft zwischen Repräsentanten und Repräsentierten, die muss es nicht geben, das wissen wir alle. Denn in der Demokratie ist jeder Bürger gleich. Und Autorität wird in ihr nur auf Zeit verliehen, durch Wahl. Und im Mittelpunkt, auch das wissen wir, steht immer der Souverän, steht unser Volk. Indem er diese Ansichten seinerseits beglaubigte, hat Karl Carstens ein Amtsverständnis demonstriert, dem sich Bundespräsidenten bis heute verpflichtet fühlen. Sich hinein versetzen in andere, das kann eben nicht jeder. Karl Carstens hat sich diese Qualität erarbeitet, und vielleicht darf er auch damit als ein Wanderer gelten - nicht zuletzt war er auch ein Wanderer zwischen den Welten. // Er bewegte sich zwischen der Privatwirtschaft und Wissenschaft hin und her, zwischen Ministerialbürokratie und Politik. Er war Anwalt und war Diplomat, Hochschullehrer und Parlamentarier, Staatssekretär und dann Bundestagspräsident. Er brachte Erfahrungen aus der einen Sphäre ein in die andere. Sein Werdegang ist ein frühes Beispiel für eine vielseitige Karriere mit bemerkenswertem Ausgang. // Karl Carstens darf auch als Rollenvorbild für den Aufstieg durch Bildung gelten. Und meine Damen und Herren, schauen Sie sich in unserer politischen Landschaft um. Sie werden dieses Modell in den verschiedenen Parteien immer wieder erblicken. Es wäre schlimm, wenn das in unserem Land in Zukunft nicht mehr möglich wäre. Wir arbeiten daran, dass das so bleibt. // Karl Carstens hat seinen Vater nie kennengelernt, er fiel im Ersten Weltkrieg, noch vor der Geburt des Sohnes. Die Mühen der Vaterlosigkeit und drohender sozialer Abstieg prägten Carstens' Jugend. Und doch trugen ihn Talent, Fleiß und Leistungsbereitschaft in eine Bildungslaufbahn, die ihn zur Professur und schließlich ins höchste Amt unseres Staates führte. // Carstens' Karriere begann, als die Bundesrepublik gegründet wurde. Sein steiler Aufstieg ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel dieser Republik. Er gehörte zu jener Generation, die sich mit den Irrungen und Lasten und vielfältiger Schuld während der NS-Diktatur auseinandersetzen musste. // Und er musste diese Lehren auch für sich selbst ziehen. Als er 1979 für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, nahmen ihm Teile der Öffentlichkeit diesen Lernprozess nicht ab. Sie sahen Carstens' Wahl gar als Gipfel der Verdrängungskunst. Denn er war Mitglied der NSDAP gewesen. Tatsächlich war seinerzeit Druck auf Carstens ausgeübt worden, dass er, um Rechtsanwalt zu werden, in die Partei eintreten müsse. Karl Carstens beugte sich. Und zwar, wie er später formulierte, wider die eigenen "besseren Überzeugungen". Er selbst sagte damals, dass er "verstrickt" gewesen sei. Er benutzte dieses Wort. Eine intensive, zumal öffentliche, Auseinandersetzung mit der objektiv geringen eigenen Verstrickung suchte Carstens nicht. // Als er für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, hatte die notwendige Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus inzwischen weite Teile der Bevölkerung erreicht. In diesen Jahren war die Erkenntnis gewachsen, wie viele Personen des öffentlichen Lebens tatsächlich verstrickt gewesen waren, auf die eine oder andere Weise. Es gab auch so etwas wie eine systemische Verstrickung, die vielfach ohne persönliche Schuld war. Aber sie existierte eben, und man war zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise bereit, darüber zu sprechen. // Aus heutiger Sicht illustrieren die damaligen Kontroversen, welch schmerzhafte Prozesse notwendig waren, um der Bundesrepublik trotz ihrer Vorgeschichte ein so ansehnliches Profil zu geben. Aus heutiger Sicht können und müssen wir sagen, dass manches damals leichter gewesen wäre, wenn mehr Betroffene früher Schuld auch als Schuld benannt und anerkannt hätten. Aber es zählt zu den großen Errungenschaften der Nachkriegsgeschichte, auf den Trümmern des Totalitarismus, auf tiefer Schuld und moralischem Versagen, ein neues Haus der Demokratie gebaut zu haben. Gewiss konnten nur wenige Repräsentanten der frühen Bundesrepublik auf eine Biographie ohne Verstrickung und ohne Widerspruch zurückblicken. Aber die meisten von denen, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung übernahmen und sich in den demokratischen Parteien engagierten, zogen aus der Erfahrung ihrer Generation einen wichtigen Schluss: dass nur unbedingtes Eintreten für die Demokratie und den Rechtsstaat Deutschland in die Zukunft führen konnte und dass die Würde des Menschen und die Grundrechte des Einzelnen Kern dieser Republik waren. Karl Carstens hat diese Erkenntnis glaubhaft und überzeugend vertreten. Dafür sind wir ihm dankbar. // Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn suchte er keineswegs den Weg in den öffentlichen Dienst. Nach der Befreiung wollte er staatsfern bleiben. Doch er besann sich früh, 1948, nach einem prägenden Erlebnis - einem Studienaufenthalt an der amerikanischen Yale-Universität. // Er traf dort auf den Geist der Freiheit und auf eine Bereitschaft zum Engagement für das Gemeinwohl, die ihn ansteckten und die er mit zurück nach Bremen brachte. Später habilitierte er sich mit einer Arbeit über die amerikanische Verfassung. Schließlich bedurfte es nur noch der Einladung seines Mentors, des Bremer Bürgermeisters Wilhelm Kaisen, einer der Gründungsfiguren der Bundesrepublik. Er hat sich als Sozialdemokrat übrigens schon frühzeitig für die Westintegration eingesetzt. Machen wir uns dieser Tage immer mal wieder bewusst, wie wichtig es für dieses Land ist, nicht von einem Weg abzuweichen, der so wichtig war für Deutschland, für das geteilte Deutschland wie für das wiedervereinigte. Aus diesem Grunde ist es mir an dieser Stelle eine große Freude, dass ich mit Dankbarkeit den Namen eines solchen wachen und wunderbaren Sozialdemokraten nennen kann. Dagegen hat die Adenauer-Stiftung sicher nichts einzuwenden. // Mit Hilfe von Wilhelm Kaisen fand sich nun also Karl Carstens im Staatsdienst wieder. Fortan und bis zu seinem Tod war er davon überzeugt, dass Deutschlands Platz an der Seite der freien Völker sein müsse. Die Pflege enger Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika stand für ihn "an erster Stelle aller außenpolitischen Überlegungen". Deutschland brauche Freunde und Verbündete, und die finde es im Westen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft und der NATO. Denn wer verantwortlich Politik betreiben wolle, dürfe die Macht des großen Nachbarn im Osten nicht außer Acht lassen. Im westlichen Bündnis sah Carstens, so sagte er, die Grundlage für eine "kraftvolle, gesicherte, freiheitlich-demokratische Bundesrepublik". // Für Carstens, den schnell bis zum Staatssekretär aufsteigenden Diplomaten, war die große Aufgabe der Nachkriegszeit die Aussöhnung mit Frankreich. Und er hat dabei aktiv mitgewirkt. Er beschäftigte sich intensiv mit europäischen Fragen, als Wissenschaftler wie als Praktiker. // Nicht zuletzt seine Erfahrungen als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik beim Europarat und seine Teilnahme an den Verhandlungen zu den Römischen Verträgen machten ihn zum Verfechter der Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Am Erfolg der Europäischen Integration hat er großen Anteil: Als die Verhandlungen über den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Oktober 1956 in eine schwere Krise gerieten, waren es Karl Carstens und sein französischer Partner Robert Marjolin, die ein Scheitern der Verhandlungen verhinderten. Der Kontinent, davon war Karl Carstens sein Leben lang überzeugt, müsse mehr sein als nur eine Freihandelszone, er müsse sich auch politisch einigen. // Aus heutiger Perspektive wissen wir besonders zu schätzen, wie Carstens die Westintegration als Bedingung der deutschen Einheit erkannte und betonte. Nach seiner Auffassung hätte die Bundesrepublik ohne Westbindung keine hinreichende Attraktivität auf die Bewohner der DDR ausüben können. Und ohne Westintegration, ohne europäische Integration hätte man nicht Frankreich, nicht Großbritannien und auch nicht die Vereinigten Staaten dem Ziel der Wiedervereinigung verpflichten können. Daraus ergaben sich für Carstens wie selbstverständlich die Prioritäten bundesdeutscher Politik: Freiheit - Frieden - Einheit, in dieser Reihenfolge. // Und so gehörte es für den Bundespräsidenten Carstens zu den unverzichtbaren Elementen eines jeden Staatsbesuches, die Gesprächspartner daran zu erinnern, dass die Bundesrepublik auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirkt, "in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt". Besuchern aus den entferntesten Gegenden der Welt - wie etwa dem Königspaar von Tonga - präsentierte er dieses Zitat aus dem "Brief zur Deutschen Einheit". // Der Logik der frühen Ostpolitik mochte er nicht folgen. Nachdem die Ostverträge dann aber abgeschlossen waren, hat er gleichwohl erkannt, dass Deutschland der Wiedervereinigung ohne eine Entspannung des Verhältnisses zu den Staaten des Warschauer Paktes nicht näher kommen würde. Aus heutiger Sicht war Karl Carstens ein Deutschland- und Außenpolitiker, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass ein Land entstand, in dem wir bis heute in Freiheit, in Frieden und in Wohlstand leben können. // Er sah sein Amt als Bundespräsident als parteiferne Instanz an, übte seine verfassungsrechtlichen Pflichten mit Bedacht aus und machte gleichzeitig deutlich, dass er sich seiner amtsspezifischen Autorität bewusst war. So ließ er den Bundeskanzler einmal vertraulich wissen, dass er die Entlassung eines Ministers nicht vornehmen werde, weil er sie für ungerechtfertigt hielt. // Die wichtigste innenpolitische Entscheidung seiner Präsidentschaft hatte er Anfang 1983 zu treffen, als es darum ging, den Bundestag vorzeitig aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen. Bundeskanzler Kohl wollte - nach der Übernahme der Kanzlerschaft - seine Bundesregierung durch Bundestagswahlen grundsätzlich neu legitimieren lassen und hatte deshalb im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt - mit dem Ziel der Bundestagsauflösung. // Wie geplant, ging dann die Abstimmung verloren. // Es war nicht nur Carstens' wichtigste, es war - wie er selber sagte - seine "schwerste Entscheidung". Er beriet sich genau 21 Tage lang, so lange, wie es das Grundgesetz höchstens erlaubt. Er wusste, dass seine Entscheidung politisch und rechtlich umstritten sein würde, egal wie sie ausfiel. Er wollte sie als ordentlicher Professor des Staatsrechts vor seiner Zunft vertreten können. Und zugleich ahnte er, dass seine Entscheidung im Wege der Organklage beim Bundesverfassungsgericht angefochten werden würde, als erstes Verfahren dieser Art für einen Bundespräsidenten. // Damals, im Übergang von der SPD-FDP-Koalition zur Koalition aus Union und FDP, ging es um eine prinzipielle Frage: ob nämlich das Instrument der Vertrauensabstimmung, bewusst von der Regierungsmehrheit eingesetzt und doch in einer absehbaren Niederlage für den Bundeskanzler endend, zu einer Neuwahl führen könne und dürfe. Kritiker sahen darin eine "unechte" Vertrauensabstimmung, eine Trickserei, in der ein Vertrauensentzug nur vorgetäuscht werde. // So entstehe in der Praxis ein verfassungsfremdes Selbstauflösungsrecht des Parlaments. // Karl Carstens entschied sich für die Auflösung des Bundestages. In seiner Begründung sagte er, er habe nicht feststellen können, "aus welchen Gründen der einzelne Abgeordnete dem Bundeskanzler die Zustimmung versagt" habe. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass die vom Grundgesetz gewollte und politisch zu erstrebende stabile Regierung ohne Neuwahlen nicht mehr zu erreichen sei. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte später Carstens' Rechtsauffassung. Diese Bestätigung war für ihn essentiell, bekannte er doch später, er wäre zurückgetreten, hätte das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung nicht bestätigt. Diese Begebenheit ist bis heute bedeutsam, weil sie die Bedingungen von Misstrauensvoten und Neuwahlen zu klären half. Karl Carstens` umsichtiges Handeln im Sinne der Verfassung trug dazu bei, die Stabilität und die Regierungsfähigkeit des Landes zu sichern, zwei Prinzipien, die in der Hierarchie seiner politischen Wertmaßstäbe ganz weit oben standen. // Karl Carstens wurde auch deshalb zum respektierten Bundespräsidenten, weil er den scharfzüngigen Parteipolitiker, der er gewesen war, hinter sich ließ. Er nutzte sein Amt, um zu integrieren. Im Laufe seiner Amtszeit überzeugte er viele, die seine Wahl einst mit Skepsis betrachtet hatten. Respekt und Zuneigung aus allen Schichten der Bevölkerung kamen ihm entgegen. Daran hatte auch seine Gattin Veronica Carstens großen Anteil. Ich erinnere heute gerne an Sie. Während seiner Präsidentschaft arbeitete sie weiter als Ärztin und nahm dabei viele Sorgen und Nöte der Menschen auf. Gemeinsam gründeten sie die Karl-und-Veronica-Carstens-Stiftung. // Auch als Schirmherrin der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft erwarb sich Veronica Carstens große Verdienste. Wir dürfen uns heute auch vor ihr verneigen. // Und noch eines wollen wir nicht vergessen: Karl Carstens schöpfte aus dem christlichen Glauben und gab seine Kraft für die Idee des Gemeinwohls. Und beides hängt miteinander zusammen - so jedenfalls sehe ich das. // Die Quintessenz seines Denkens hinterließ er wenige Jahre vor seinem Tod in einer Rede in Dresden: "Wer frei ist, trägt Verantwortung, wer Rechte hat, der hat auch Pflichten, wer Ansprüche stellt, vor allem Ansprüche an den Staat, muss auch bereit sein, Leistung zu erbringen." Hinter diesen Sätzen können wir uns auch heute noch versammeln. // Verneigen wir uns also vor der Leistung eines deutschen Demokraten, und halten wir sein Andenken durch unsere Haltung und durch unsere Handlungen als Staatsbürger in Ehren.
-
Fast 40 Jahre ist es jetzt her, dass Willy Brandt Bundeskanzler war, mehr als 20 Jahre ist er nun nicht mehr unter uns. // Und doch fällt es mir schwer, in der Vergangenheitsform über ihn zu reden. Ich spreche sicher vielen aus dem Herzen, wenn ich sage: Willy Brandt ist noch immer gegenwärtig - mit allem, was er verkörpert: mit seiner Liebe zur Freiheit, mit seinem Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, mit seiner Überzeugung, dass jede Zeit eigene Antworten will und dass wir selbst die Welt verändern müssen. // Wie sehr wirkt er damit nach, wie sehr fordert er uns alle damit heute heraus! // Die eine große Sehnsucht seines Politikerlebens, für die er so lange gekämpft hatte, als Berliner Bürgermeister, als Außenminister und Bundeskanzler - die Sehnsucht, es möge zusammenwachsen, was zusammengehört. Sie nahm noch zu seinen Lebzeiten reale Gestalt an. Gerechter Dank der Geschichte für einen, der furchtlos, geschickt und pragmatisch nach Wegen gesucht hat, wo andere nur Mauern sahen! Vor kurzem habe ich in alten Unterlagen vier handgeschriebene Blätter gefunden: meine Begrüßungsrede für Willy Brandt, der am 6. Dezember 1989 zu uns in die Marienkirche nach Rostock kam. Da war Willy Brandt schon viele Jahre ohne Staatsamt - und doch derjenige, auf den sich ganz selbstverständlich unsere Blicke richteten, weil er verkörperte, wonach wir uns sehnten. "Da begegnen wir uns nun: wir, das Volk, und Sie, der große Politiker", habe ich damals gesagt. Und: "Ihr Wort ist uns wichtig". So ist es auch heute noch - im Präsens! // Darum ist Willy Brandts 100. Geburtstag Gelegenheit zur Rückschau auf ein Jahrhundert voller Schrecken und Aufbrüche und auf das, was sich - auch ihm sei Dank - zum Guten gewandelt hat. Es ist zugleich eine gute Gelegenheit, vorauszuschauen auf das, was vor uns liegt und was Willy Brandt uns für die Zukunft aufgetragen oder doch nahegelegt hat. // So manches, was Willy Brandt in früheren Zeiten entgegenschlug, ist heute jungen Leuten kaum noch verständlich zu machen: dass einer, der den nationalsozialistischen Ungeist bekämpfen half, noch Jahrzehnte nach dem Ende des Hitlerregimes bei vielen als "Vaterlandsverräter" galt und sich fragen lassen musste, was er im Exil eigentlich gemacht habe. Unglaublich, heute, dass sein Kniefall in Warschau - diese Geste der Trauer und der Überwältigung, die auch kommende Generationen noch kennen werden - dass diese Geste vielen seiner Landsleute damals übertrieben erschien. Und später, viel später dann die Pfiffe von Unbelehrbaren vor dem Schöneberger Rathaus, als Willy Brandt mit Helmut Kohl und anderen am 10. November 1989 die Maueröffnung feierte - wie unverständlich, von heute aus betrachtet! // Heute können wir wieder ohne Nationalismusverdacht unsere Nationalhymne singen - auch das ist ein wenig Willy Brandts Verdienst. Viele konnten dank seiner wieder "ja" sagen zu unserem Land. 1972 hieß ein SPD-Wahlslogan: "Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land." So schlecht konnte dieses Land doch gar nicht sein, wenn einer wie er es trotz allem liebte! Vor allem aber hat er, der "andere Deutsche", der Europäer und Weltbürger, im Ausland glaubwürdig und zugleich selbstbewusst für neues Vertrauen geworben. // Inzwischen sind wir wieder ein "Volk der guten Nachbarn". Wir wissen um die Abgründe der deutschen Geschichte. Verantwortung für diese Geschichte zu übernehmen - so hatte es Willy Brandt schon früh gesehen - bedeutet nicht, Enthaltsamkeit zu üben in gegenwärtigen Konflikten. Im Gegenteil: Aus der Einsicht in das Vergangene erwuchs für ihn die Verantwortung für die Probleme und die Chancen der Gegenwart. 1973 erklärte er als erster deutscher Bundeskanzler vor der UN-Generalversammlung: "Wir sind [ ] gekommen, um - auf der Grundlage unserer Überzeugungen und im Rahmen unserer Möglichkeiten - weltpolitische Verantwortung zu übernehmen." Vor 40 Jahren war das, wohlgemerkt! Heute ist unserem vereinten Deutschland ungleich größere Verantwortung zugewachsen. Wir sind gut beraten, sie unseren Überzeugungen und Möglichkeiten entsprechend anzunehmen. // Von Willy Brandts Haltung in Konflikten lernen heißt: geduldig sein, Vertrauen schaffen und scheinbar unerbittliche Gegner einander schrittweise annähern. Wir sind ja manchmal geneigt zu vergessen, wie aktuell etwa die Bedrohung durch Nuklearwaffen ist, auch weit nach dem Ende des Kalten Krieges. Den gemeinsamen Aktionsplan zwischen Iran, den fünf UN-Vetomächten und Deutschland könnte man - bei aller gebotenen Vorsicht - als einen der hoffnungsvollsten Anfänge der vergangenen Jahre bezeichnen. // In vielem, was Willy Brandt sehr früh schon bewegte, sind wir auch heute noch lange nicht angekommen. Beispiel Entwicklungspolitik: Tatsächlich lebt nach wie vor ein größerer Teil der Weltbevölkerung in Armut. Beispiel Klimawandel und Umweltverschmutzung: Sie abzubremsen ist dringlicher denn je - die Folgen gerade für die Verletzlichsten erkannte Brandt als einer der ersten. Beispiel Zusammenleben der Verschiedenen: Schon früh sprach er vom "Recht der Ebenbürtigkeit, der Gleichheit und der guten Nachbarschaft" als Grundlage des Miteinanders. Ich bin mir sicher, Willy Brandt hätte auch heute viel zu sagen über das, was wir so sperrig "Integration" nennen und was doch so viel mit der Anerkennung von Unterschieden und dem Streben nach dem Gemeinsamen zu tun hat. Und er, der politische Emigrant, würde gewiss auch Partei ergreifen für die, die heute fliehen vor Unterdrückung und Gewalt. Wir wollen nicht vergessen, dass Willy Brandt, der von den Nationalsozialisten Ausgebürgerte, damals in Norwegen aufgenommen und eingebürgert wurde! Tusen takk! Ich bin gespannt, was Sie, sehr geehrter Herr Gahr Støre, und Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, uns gleich über Willy Brandts Wirken berichten werden. // Ich kann nur jedem, der es noch nicht getan hat, wärmstens empfehlen, in den Briefen, Notizen, Tagebuchaufzeichnungen, Redemanuskripten und Memoranden der "Berliner Ausgabe" zu blättern - ich habe das Glück, die zehn Bände griffbereit in meinem Amtszimmer stehen zu haben. Willy Brandt hat immer wieder Worte gefunden für das, was andere bewegte. Und er hat andere mit seinen Worten bewegt. Als Berliner Bürgermeister in den Tagen des Mauerbaus: "Wir fürchten uns nicht!" Als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler: "Wir wollen mehr Demokratie wagen!". Oder, am Ende seines Lebens: "Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum - besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll." // So soll Willy Brandt uns noch heute prägen und ermutigen: mit seiner Haltung zu seinem Land, über das er weiter hinausblickte als die allermeisten, das er liebte mit all seinen Schwächen und zugleich verbessern wollte, und zwar durch praktische Politik, die sich im Alltag bewähren sollte, um das Leben der Menschen besser zu machen. Er hatte Träume. Aber er gab nicht vor, das Ziel der Politik ein für alle Mal zu kennen. Er sah das Offene, das Unfertige. Manchmal, so meinte er, gebe es keine Lösung. Doch handlungsfähig sind wir nicht erst dann, wenn wir das Ende einer Entwicklung benennen können. Wir sind es bereits, wenn wir darum ringen, das zu verändern, was in unserer Macht und unseren Möglichkeiten liegt, auch wenn es sich nur um das etwas Bessere handelt. Immer warb er dafür, dass sich heute für Veränderungen einsetzen muss, wer morgen besser leben will. // Wir ehren Willy Brandt darum nicht allein für das, was er getan hat, sondern auch für das, wozu er andere motiviert hat. Sein ganzes politisches Leben war eine Einladung zum Mitgestalten und Weiterdenken - übrigens auch dazu, sich nicht zufrieden zu geben mit einer alles andere ausschließenden Wahrheit, an die er, Willy Brandt, nicht mehr glauben konnte, wie er sagte: "Ich glaube an die Vielfalt und also an den Zweifel". Den produktiven Zweifel auszuhalten, ohne ihn als dominierende Lebensform zu kultivieren, auch dazu kann uns Willy Brandt motivieren. // In einer der vielen Fernsehrunden rund um den Geburtstag hat eine junge SPD-Genossin bekannt, sie fühle sich Willy Brandt zwar nicht als Person nahe, wohl aber in dem, was sie tue. Das hätte ihn gefreut. // Es hätte ihn auch gefreut zu sehen, wie viele hier zusammengekommen sind, um "danke" zu sagen, aus allen Teilen unserer Gesellschaft, aus seiner zweiten Heimat Norwegen und anderen Ländern, denen er verbunden war. Er hätte den Dank vielleicht mit dem bescheidenen Satz quittiert, den er sich angeblich einmal - mit feiner Selbstironie - als Inschrift auf seinem Grabstein wünschte: "Man hat sich bemüht". Nehmen wir sein Vermächtnis an. Es heißt: Seid nicht gleichgültig! Setzt Euch auseinander und ringt um die bessere, nicht die nächstbeste Lösung! Erkennt, was Ihr verändern und verbessern könnt. Sagt "ja" zu unserem Land, zu unseren Aufgaben und Möglichkeiten! Und habt Mut, Geduld und Zuversicht.
-
Freiheit ist immer Freiheit für etwas und zu etwas. Die Freiheit der Erwachsenen bedeutet Verantwortung.
-
Gestern war ich in Bergen-Belsen. Ich musste daran denken, als ich die Bilder von Mauthausen sah. Heute darf ich mit Ihnen die österreichische Freiheit und Befreiung feiern. Ich bin tief bewegt und dankbar, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Nicht an irgendeinem Tag und zu irgendeinem Anlass, sondern gerade an jenem Tag, an dem Österreich vor genau 70 Jahren die Grundlagen für seine demokratische Nachkriegsordnung legte. // Noch tobten damals Kämpfe hier, aber auch um Breslau und Berlin. Noch befanden sich große Teile Österreichs in der Hand der Wehrmacht. Noch herrschte vielerorts der Terror der Nationalsozialisten: Zivilisten wurden erhängt oder erschossen, weil sie weiße Fahnen gehisst hatten. Soldaten wurden zum Tode verurteilt, weil sie sich von ihren Truppenteilen entfernt hatten. Doch die Hauptstadt Wien befand sich bereits in den Händen der Roten Armee. Und noch bevor die Wehrmacht kapitulierte, erklärte eine neue österreichische Regierung den gewaltsamen Anschluss an Deutschland 1938 für null und nichtig und proklamierte die Wiederherstellung der demokratischen Republik Österreich. Voller Erleichterung tanzten die Wiener zwischen den Trümmern ihrer Stadt zum Donauwalzer. // Die Bürger der Republik Österreich und die Bürger der Bundesrepublik Deutschland wissen sehr genau, warum wir das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft als Befreiung würdigen. Schrecklich allein die Vorstellung, die Alliierten hätten uns nicht befreit und unsere Vorgängergeneration hätte uns ein Europa unter dem Hakenkreuz hinterlassen. // Heute, nach Jahrzehnten demokratischer und ökonomischer Konsolidierung, leben Österreicher und Deutsche in einem spannungsfreien und freundschaftlichen Verhältnis - von Fußballländerspielen einmal abgesehen. Wir sind einander willkommen - als Köche und Kellner, als Fachärzte, als Wissenschaftler und Theaterleute. Geschäftsleute und Touristen überqueren millionenfach die Grenze in beide Richtungen. Viele unserer Unternehmen sind miteinander verflochten, und unsere Länder sind füreinander ein wichtiger Markt. // Zu Recht ist es oftmals betont worden: Österreicher und Deutsche sind sich besonders vertraut - allein schon wegen der Sprache. Das Publikum fragt kaum mehr, ob ein Schriftsteller, Komponist oder Schauspieler und Sänger in Deutschland oder Österreich geboren wurde und welche Staatsbürgerschaft er besitzt. // Unsere Völker verbindet zudem eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte: dazu gehört das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber natürlich auch blutiger Krieg, um Schlesien etwa, in der Vergangenheit, ebenso wie der 1815 gemeinsam ins Leben gerufene Deutsche Bund. Und selbst in der Zeit der Nationalstaatsbildung fühlten wir uns einander so nahe, dass die Debatte über einen gemeinsamen Staat lange Jahre auf der politischen Agenda stand. // Wir wissen, wie die Geschichte ausging. 1871 entstand das Deutsche Reich - ohne Österreich. Die staatliche Vereinigung Deutschlands und Österreichs war auch nach dem Ersten Weltkrieg keine Option, die Siegermächte hatten es so verfügt. Und als der Zusammenschluss dann 1938 als Anschluss Realität wurde, verspielte er im selben Moment jede Zukunftschance. Auch wenn Zehntausende auf den Straßen jubelten, als Adolf Hitler Österreich 1938 anschloss ans Deutsche Reich, so gab es zugleich die vielen anderen Österreicher, die in der nationalsozialistischen Herrschaft von Anfang an nichts als ein menschenverachtendes System der Unterdrückung sahen. Das, Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, ist eine Traditionslinie, auf die sich das moderne freiheitliche Österreich stolz berufen kann. Für die Menschen, die in dieser Tradition standen, war die Einheit mit Deutschland unter dem Vorzeichen der Diktatur eben keineswegs erstrebenswert, sondern erschreckend und bestürzend gewesen. // Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehen Deutschland und Österreich getrennte Wege - zunächst in kritischem Respekt, dann in wachsender freundschaftlicher Geneigtheit. Beide Staaten sind im Rückblick gut mit dieser Lösung gefahren. Mit dem Staatsvertrag von 1955, einem Meilenstein der zweiten Republik, wurde Österreich souverän und frei. Das ist nun schon 60 Jahre her. Längst bekennen sich die Österreicher ganz selbstverständlich zu ihrer Identität, voller Stolz auf dieses Land mit seiner wunderschönen Landschaft, seiner tiefverwurzelten Kultur, seiner politischen Stabilität und seinem sozialen Frieden. // In den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen Österreich und Deutschland vielfach vor ähnlichen Herausforderungen. Zunächst strebten beide nach dem Ende der Besatzung und nach der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität, was im Falle Deutschlands erheblich länger dauerte als im Falle Österreichs. Beide Länder hatten gewaltige Leistungen zu erbringen, um die vielen Flüchtlinge und Vertriebenen zu integrieren. Auch in Österreich standen zunächst der Wiederaufbau des Landes und die Mehrung des Wohlstands im Vordergrund. Dabei flüchteten viele Österreicher ebenso wie viele Westdeutsche vor den langen Schatten der Vergangenheit ins große Schweigen oder auch in die Traumwelt von Heimatfilmen oder Schlagermusik. Es hat mich sehr bewegt, Herr Bundespräsident, wie Sie diese Zeit und die Position innerhalb der Bevölkerung hier gerade beschrieben haben. // Der Umgang mit der eigenen Vergangenheit, das musste erst erlernt werden, von Deutschen wie von Österreichern. Sie, Herr Bundespräsident, gehörten 1962 zu den ersten, die in Österreich die fortdauernde Weitergabe von antisemitischem oder neonazistischem Gedankengut unter dem Dach einer Hochschule anprangerten. In den 1980er Jahren drangen die Dispute aus der Alpenrepublik bis ins europäische Ausland und bis nach Amerika. Ich weiß zu schätzen, welche große Bedeutung den Worten von Franz Vranitzky zukam, der 1991 als erster Bundeskanzler im Nationalrat aussprach, was lange - für einige viel zu lange - tabuisiert worden war: "Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen. Und so, wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen, bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten." // Deutschland hat nach seinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit nationalsozialistischer, später auch mit kommunistischer Vergangenheit ähnliche Überzeugungen gewonnen wie Österreich: Wenn wir uns offen und unvoreingenommen der Vergangenheit nähern, kann Wissen an die Stelle des Schweigens treten. Wahrheit hilft und Wahrheit befreit. Wir achten die Erfahrungen eines jeden Einzelnen. Gewiss: Wir sind nationale Narrative gewohnt. Aber wir können durchaus die eigenen Sichtweisen um die Sichtweisen der Anderen erweitern, und wir können unsere bisherigen Sichtweisen, wo es erforderlich ist, verändern: Das beste Korrektiv gegenüber einem Denken, das sich primär am Nationalen orientiert, ist die Orientierung an universellen Werten, an den Menschenrechten und an der Menschenwürde. // Lassen Sie mich noch einen Blick auf die letzten Jahrzehnte werfen. In einem beispiellosen Einigungsprozess ist es gelungen, die Staaten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg verfeindet und misstrauisch gegenüber standen, auf der Grundlage der Prinzipien von Frieden, Freiheit und Menschenrechten zusammenzuführen. Es war ein Einigungsprozess, der zunächst im Westen des Kontinents, Jahrzehnte später auch in der Mitte und im Osten stattfand. Den Europäern ist es fast überall auf unserem Kontinent gelungen, den Dialog an die Stelle der Feindschaft, und das Miteinander der Verschiedenen an die Stelle eines Wettkampfs um Vorherrschaft und Macht zu setzen. Europa ist damit zum Modell für viele demokratische und freiheitsliebende Menschen auf der ganzen Welt geworden. // An dieser Stelle liegt es nahe, einen weiteren Jahrestag ins Gedächtnis zu rufen: Vor fast genau zwanzig Jahren, am 1. Januar 1995, wurde Österreich Mitglied der Europäischen Union. Sich militärisch zur Neutralität verpflichtend, ist Österreich politisch doch immer ein Teil jener Völkerfamilie gewesen, die sich der Freiheit des Einzelnen und des Rechts auf nationale Selbstbestimmung verschrieben hat. Gerade Österreich, das kommunistischen Ländern Nachbar war, wurde ein wichtiger Ort der Sehnsucht und der Zuflucht für Verfolgte aus Mittel- und Osteuropa. // Die besondere Anteilnahme der Österreicher am Schicksal der Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs verdient großen Respekt. Während des Aufstands 1956 standen sie an der Seite der freiheitsliebenden Ungarn. 1968 hofften und bangten sie mit den Tschechen und Slowaken während des Prager Frühlings. Flüchtlingen aus beiden Ländern begegneten sie mit viel Sympathie und Hilfsbereitschaft. Und im Frühsommer 1989 war Österreich gerne bereit, tausenden von DDR-Bürgern ein erstes Obdach zu bieten, als sich die Chance für die Flucht dieser Menschen bot, weil Ungarn schon den Schießbefehl aufgehoben und die Grenzen partiell geöffnet hatte. Das werden wir nicht vergessen und dafür bleiben wir dankbar. // Nachbarschaftliche und kulturelle Bande konnten erneuert werden, als Europa nach 1989 wieder eins wurde und Österreich den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellte. Die Wirtschaft profitierte von der Einigung - und mit ihr die Menschen. Und doch haben sich die Hoffnungen auf eine immer engere Zusammenarbeit nicht überall erfüllt. In einigen Ländern Europas, auch innerhalb der Europäischen Union, sehen wir Gefahren für Rechtsstaat und Pluralismus, in anderen das Anwachsen populistischer und nationaler bis nationalistischer Strömungen und Parteien. Sogar ein so großer und für uns alle so wichtiger Partner wie Großbritannien hat Schwierigkeiten, seine Mitgliedschaft in der EU dauerhaft zu bejahen. Dazu kommt noch die Gefahr, die islamistische Terrororganisationen innerhalb Europas darstellen. Angesichts dieser Herausforderungen gewinnt die gemeinsame Verteidigung und Festigung von Einheit, Freiheit und Demokratie in Europa eine neue, eine große Bedeutung. // Deshalb erscheint mir ein abgestimmtes, ja gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union in der Außenpolitik besonders bedeutsam zu sein. Wenn keine Garantie mehr besteht, dass überall in Europa das Völkerrecht geachtet wird, dann haben die Mitglieder der Europäischen Union neu über ihre gemeinsame Sicherheit nachzudenken. // Unsere beiden Staaten haben je eigene Erfahrungen gemacht mit den Möglichkeiten und den Grenzen der Politik in den Zeiten des Kalten Krieges: Konkurrenz und Konfrontation zwischen den beiden Machtblöcken bargen immer auch die Gefahr eines "heißen" Krieges. Trotz mancher Enttäuschungen setzen wir deshalb heute auf Deeskalation und Gespräch. // Zugleich wissen wir: Es war 1975 die Schlussakte des Helsinki-Prozesses und das Bekenntnis zu unveräußerlichen Menschenrechten und Grundfreiheiten, das der mitteleuropäischen Freiheitsbewegung auch Inspiration und Ermutigung bot. Es war der erklärte Wille der Menschen dort, unabhängig und selbstbestimmt, in Freiheit und Demokratie zu leben. Was vor einem Vierteljahrhundert bei Polen, bei Ungarn und Tschechen unsere ungeteilte Unterstützung fand, kann uns deshalb heute in der Ukraine nicht gleichgültig lassen. // Heute wie damals besteht Europa auf dem Respekt vor der Souveränität und territorialen Integrität jeden Landes und dessen Recht, seine Partner frei wählen zu dürfen. Heute wie damals weiß Europa, dass nichts den Wohlstand und das friedliche Zusammenleben besser sichert als die Menschen- und Bürgerrechte in einem funktionierenden Rechtsstaat. // Ich freue mich, dass ich an diesem Tag bei Ihnen sein kann. Und ich freue mich vor allem deshalb, weil unsere beiden voneinander getrennten Staaten doch noch mehr verbindet als eine gemeinsame Sprache. Es ist unser gemeinsames Wertefundament und es sind gemeinsame Ideale. Sie verbinden unsere Länder als gleichberechtigte Partner in der großen Familie der Europäischen Union. Und noch etwas verbindet uns: Österreich und Deutschland haben heute die gemeinsame Verantwortung, die Ordnung und die Werte auf denen sie beruht, in der Zukunft zu sichern. Es ist der Geist der europäischen Zusammenarbeit, der unsere Länder auch künftig vereinen wird. Der 70. Jahrestag der Wiedererrichtung der demokratischen Republik Österreich, zu dem ich von Herzen gratuliere, ist ein guter Anlass, sich darüber zu freuen und gemeinsam "Ja" zu sagen zu dieser Verantwortung.
-
Gott schuf uns, damit wir Verantwortung übernehmen.
-
Guten Abend aus dem Schloss Bellevue, ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen allen. // Ein frohes Weihnachtsfest - so wünschen wir es einander jedes Jahr. Aber vielen von uns fällt es in diesem Jahr nicht leicht, in weihnachtlicher Stimmung zu sein. Zwar hat sich die Mehrzahl der Deutschen mit Freude und Dank daran erinnert, dass wir nun schon seit 25 Jahren in einem wiedervereinigten, freien und demokratischen Land leben. // Aber das Jahr war doch in hohem Maß gekennzeichnet von Unglück, von Gewalt, Terror und Krieg. Wir erinnern uns an die schreckliche Flugzeugkatastrophe in den französischen Alpen. Wir rufen die zahlreichen Krisen auf, die sich überlagerten, fast alle andauern und bei zahllosen Menschen Unsicherheit, oft auch Angst auslösen. Ich nenne nur die Finanzkrise und die zunehmenden Differenzen in der Europäischen Union, ich nenne die intensiven Debatten um die Zukunft Griechenlands. Ich denke auch an die Ukraine, Syrien, Afghanistan, die vom Terror bedrohten Gebiete Afrikas. Und heute, Weihnachten, denke ich besonders an Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt werden. Dankbar grüße ich die zivilen Helfer, die inmitten von Hunger, Not und Bürgerkrieg unermüdlich tätig sind. In gleicher Weise grüße ich die Soldatinnen und Soldaten, die im gefährlichen Kampf gegen die Wurzeln des Terrors, der vor kurzem unter anderem auch in Paris gewütet hat, eingesetzt sind. // Was uns gegenwärtig jedoch besonders umtreibt, ist die Frage: Wie sollen wir mit den vielen Flüchtlingen umgehen, die in unserem Land Bleibe und Zukunft suchen? // Wir standen und stehen vor einer besonders großen Herausforderung. Wo die Behörden an ihre Grenzen kamen, haben Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Menschen willkommen geheißen. Spontan und wie selbstverständlich. Tausendfach haben Sie Essen und Trinken, Decken und Kleidung gebracht, Sprachkurse organisiert und Unterstützung bei Behördengängen geleistet. // Sie alle sind zum Gesicht eines warmherzigen und menschlichen Landes geworden. // Auch von Berufs wegen haben Unzählige getan, was in ihren Kräften stand: in Landratsämtern und Stadtverwaltungen, in Sozial- und Gesundheitsbehörden, in Schulen und Kindergärten, bei den Landespolizeien und der Bundespolizei, in Bundesämtern und Ministerien. // Ob haupt- oder ehrenamtlich: Wir haben gezeigt, was in uns steckt - an gutem Willen und an Professionalität, aber auch an Improvisationskunst. Und wir haben gesehen: Der Einzelne wie auch die Gesellschaft können sich beständig neu entdecken und wachsen. So kann sich das Land erkennen in den Herausforderungen, die es annimmt und, da bin ich zuversichtlich, auch meistern wird. // Gegenwärtig belastet viele zwar die Heftigkeit der Debatte. Aber lassen Sie mich daran erinnern: Der Meinungsstreit ist keine Störung des Zusammenlebens, sondern Teil der Demokratie. Lassen Sie uns einen Weg beschreiten heraus aus falschen Polarisierungen. Gerade die solidarischen und aktiven Bürger und Bürgermeister sind es ja oft, die auf ungelöste Probleme hinweisen. // Eines allerdings ist klar: Gewalt und Hass sind kein legitimes Mittel der Auseinandersetzung, Brandstiftung und Angriffe auf wehrlose Menschen verdienen unsere Verachtung und verdienen Bestrafung. // Genauso klar ist: Nur mit offenen Diskussionen und Debatten können wir Lösungen finden, die langfristig Bestand haben und von Mehrheiten getragen werden. Wir sind es, die Bürger und ihre gewählten Repräsentanten, die entwickeln und verteidigen werden, was dieses unser liberales und demokratisches Land so lebenswert und liebenswert macht. Wir sind es, die Lösungen finden werden, die unseren ethischen Normen entsprechen, und den sozialen Zusammenhalt nicht gefährden. Lösungen, die das Wohlergehen der eigenen Bürger berücksichtigen, aber nicht die Not der Flüchtlinge vergessen. // Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Weihnachtsfest erinnert uns daran, dass wir Menschen Kraftquellen benötigen, um unser Leben immer wieder zu meistern - im Politischen wie im Privaten. // Für unzählige ist es die Familie, die ihnen Geborgenheit und das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Bei anderen sind es Freunde und Wahlverwandte, die sie motivieren, stützen und tragen. // Aber es ist doch auch das Weihnachtsfest selbst mit seiner Botschaft, die uns in schwierigen Zeiten hilft, Wege der Mitmenschlichkeit zu finden. // Die Heilige Schrift der Christen erzählt davon, dass sich im Weihnachtsgeschehen die Menschenfreundlichkeit Gottes zeigt. Es ist schön, von dieser Menschenfreundlichkeit umfangen zu werden. Aber noch schöner ist es, diese Menschenfreundlichkeit selbst zu leben und in unsere Welt hinein zu tragen. // Mit dieser leisen Ermutigung wünsche ich uns allen, dass wir ein frohes und gesegnetes Weihnachten feiern können und miteinander in ein neues gutes Jahr gehen.