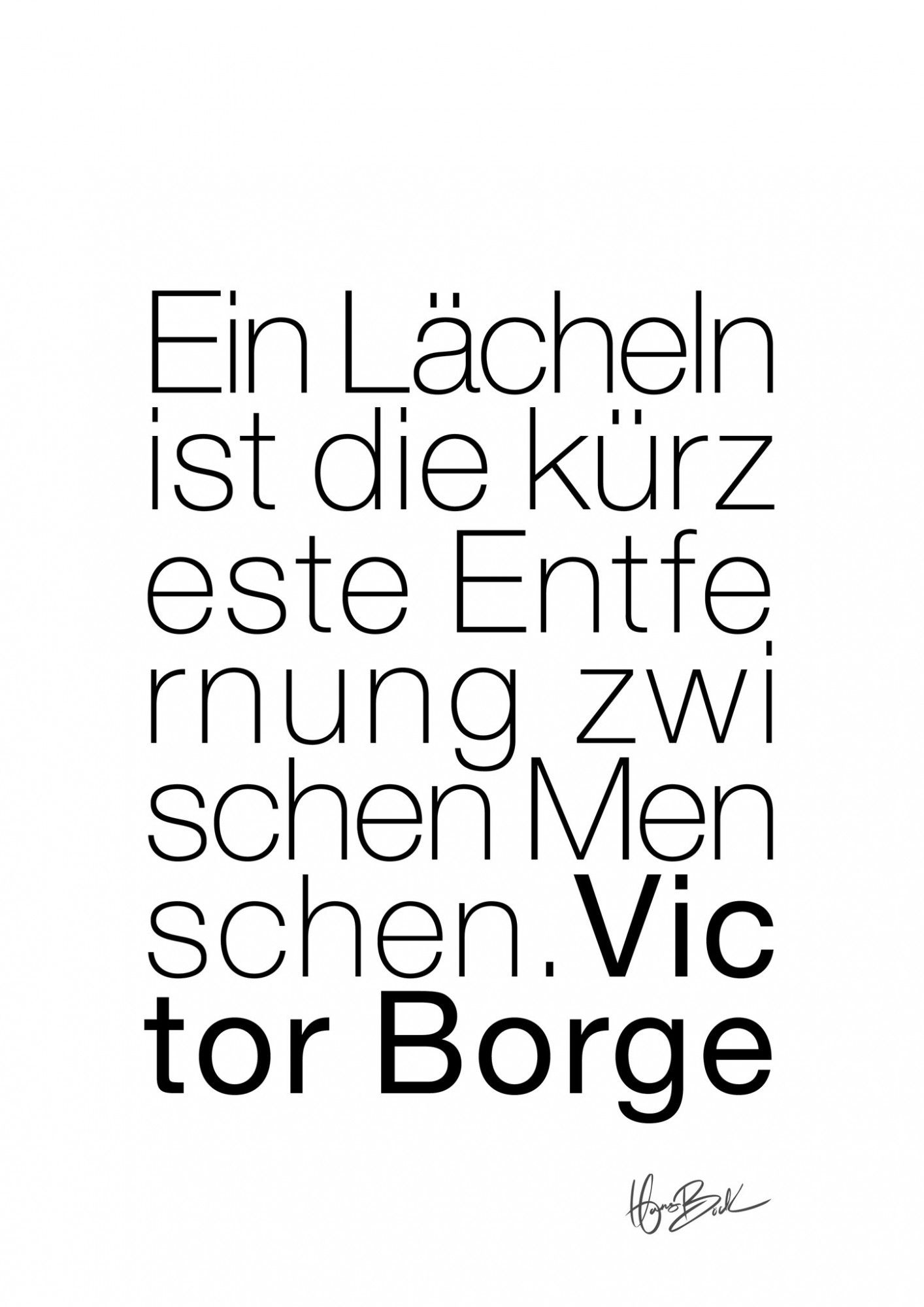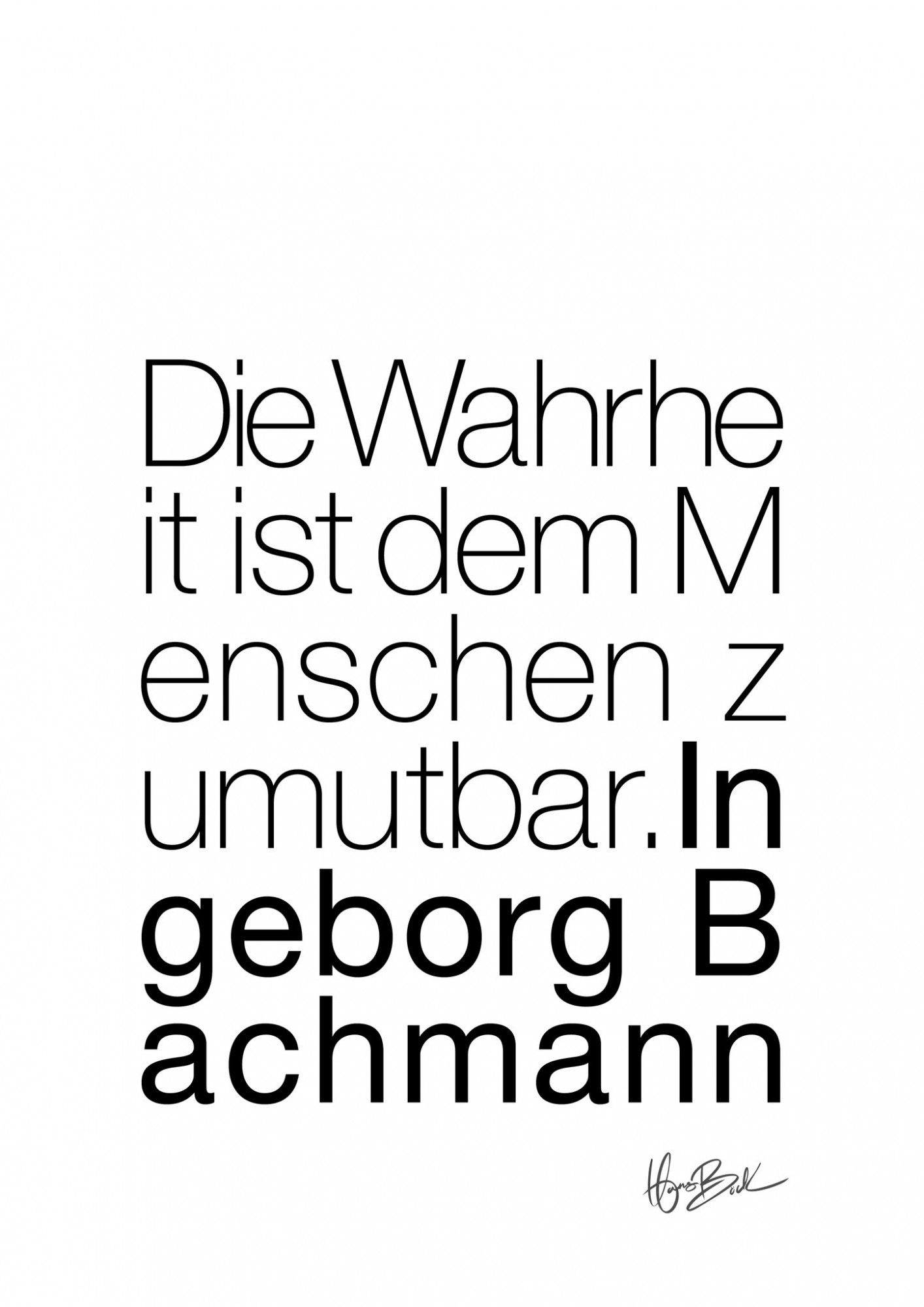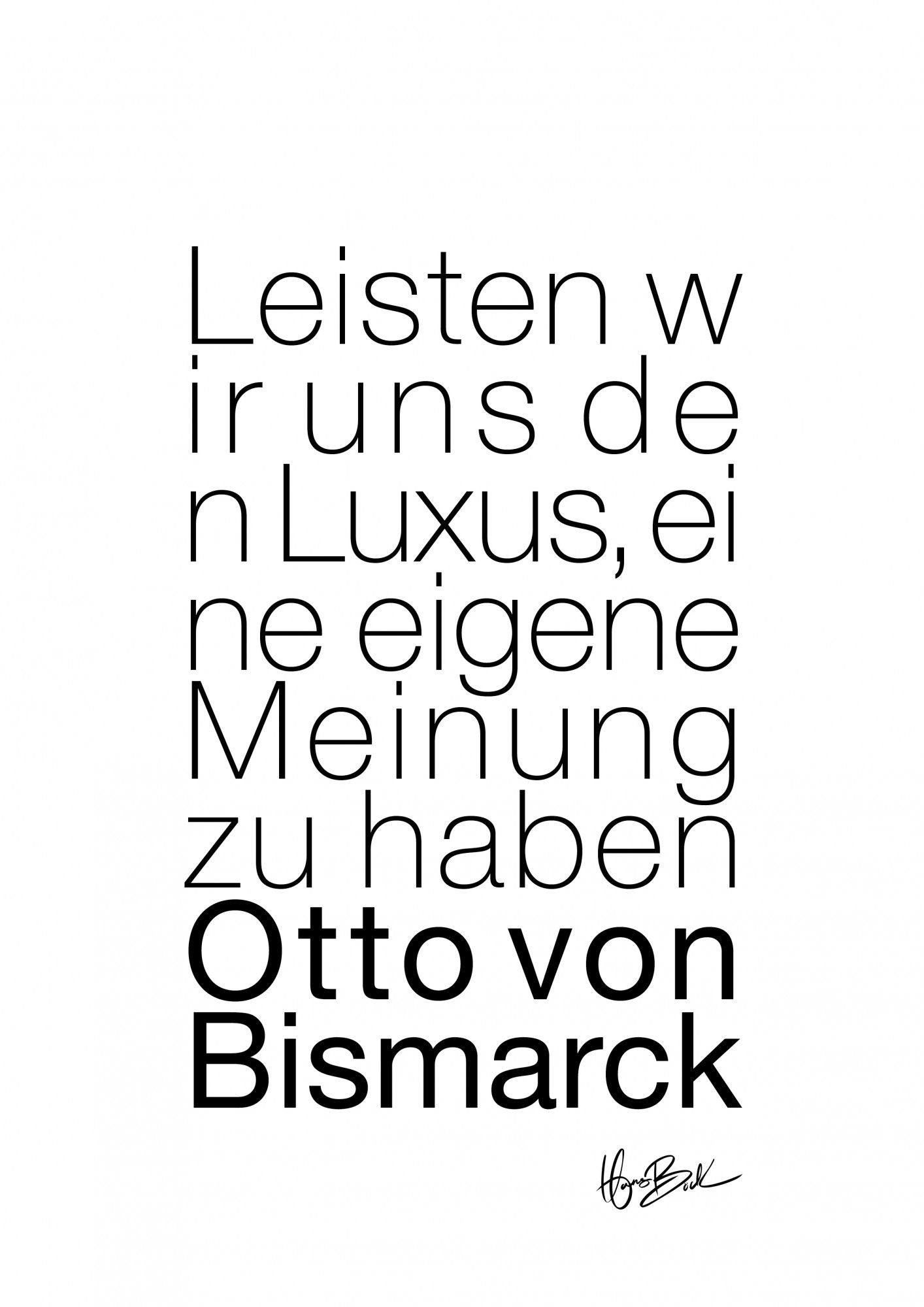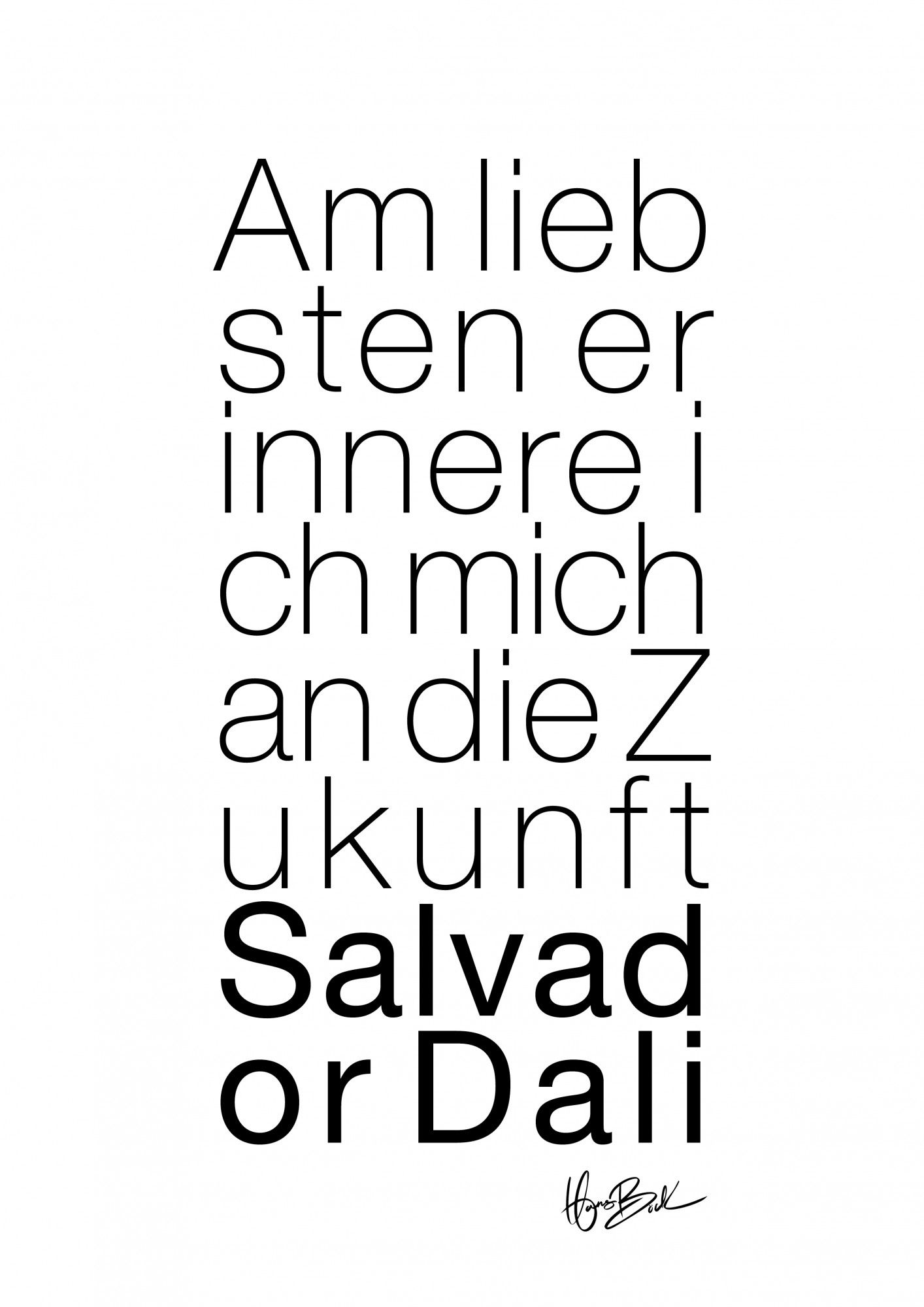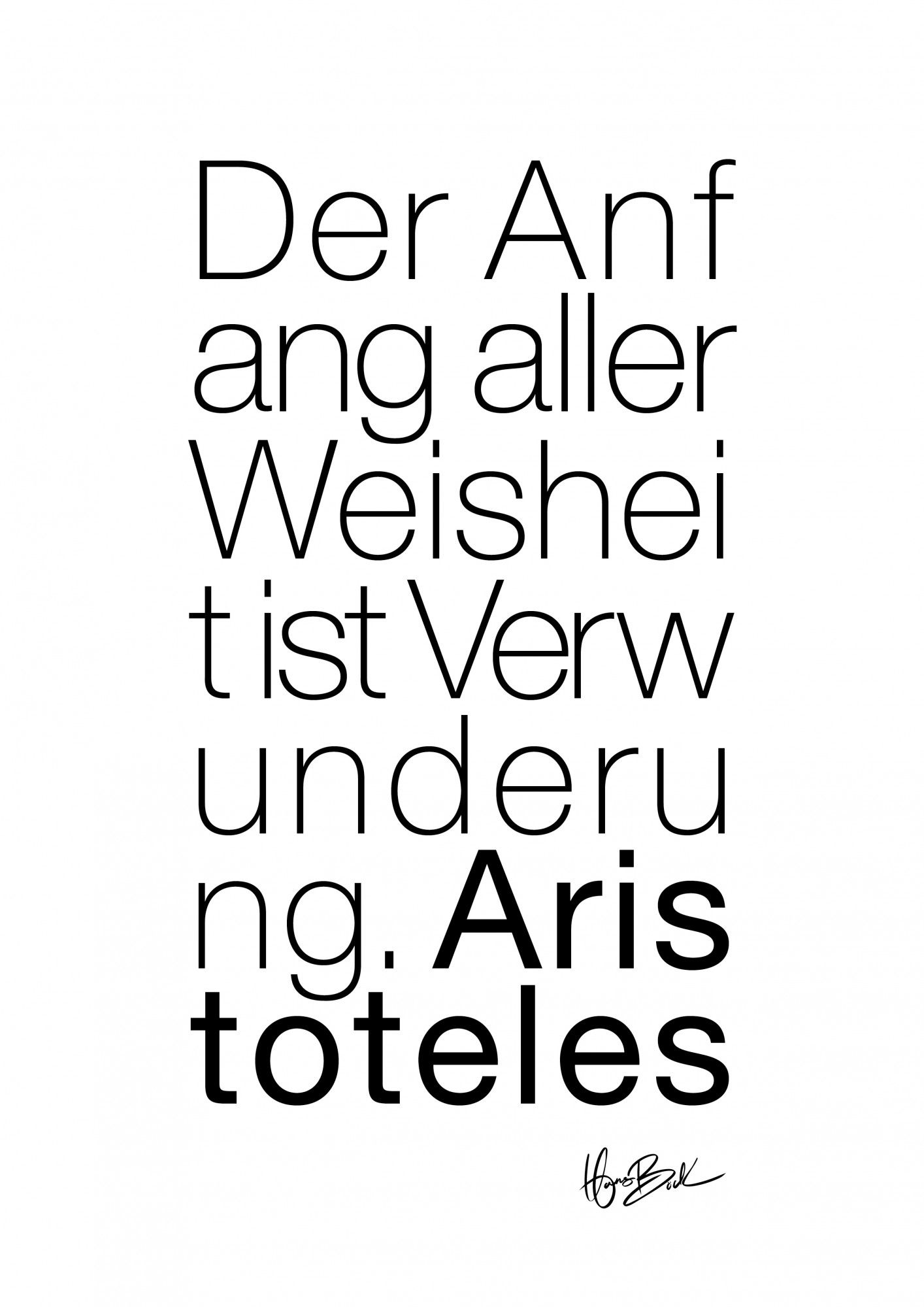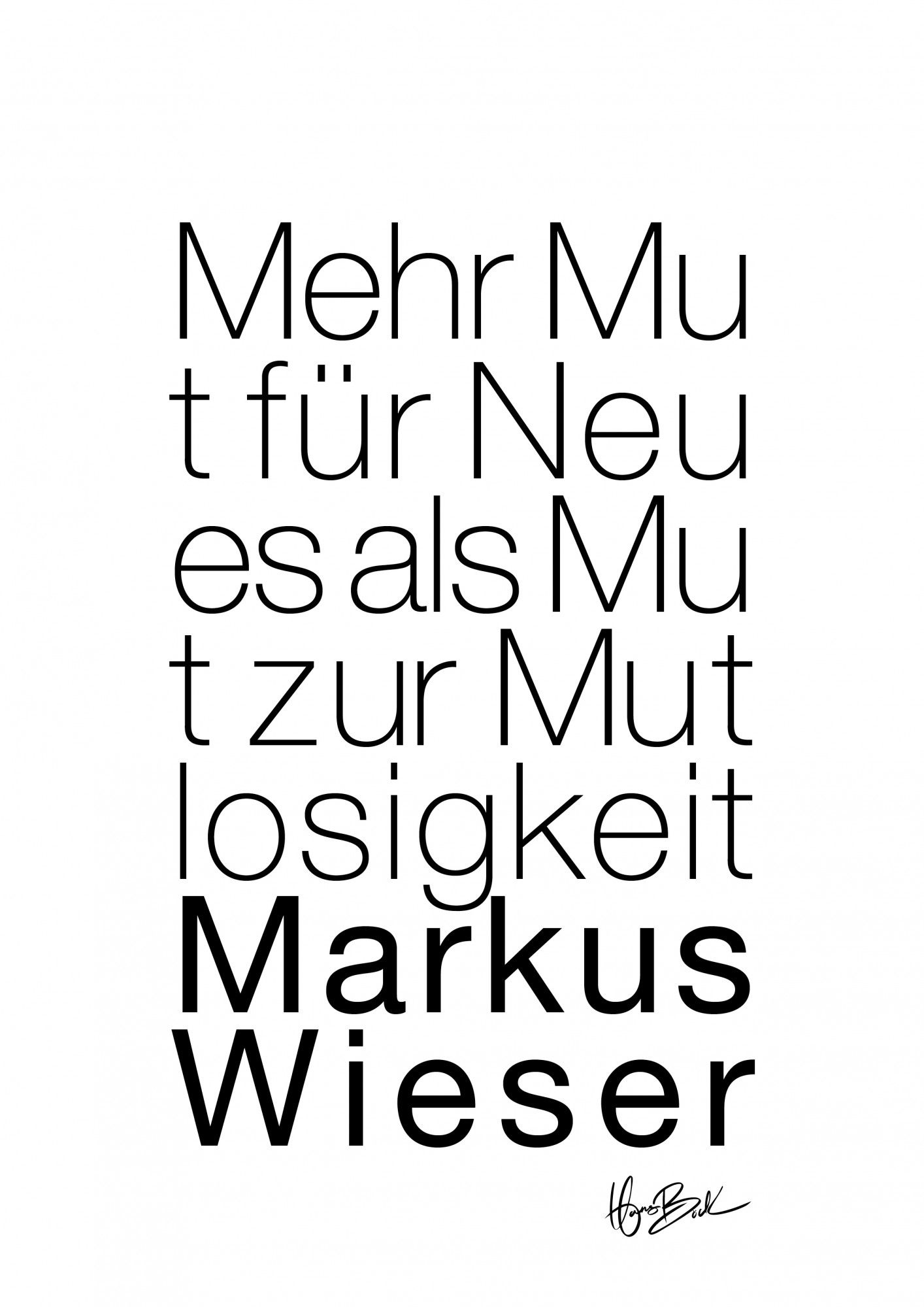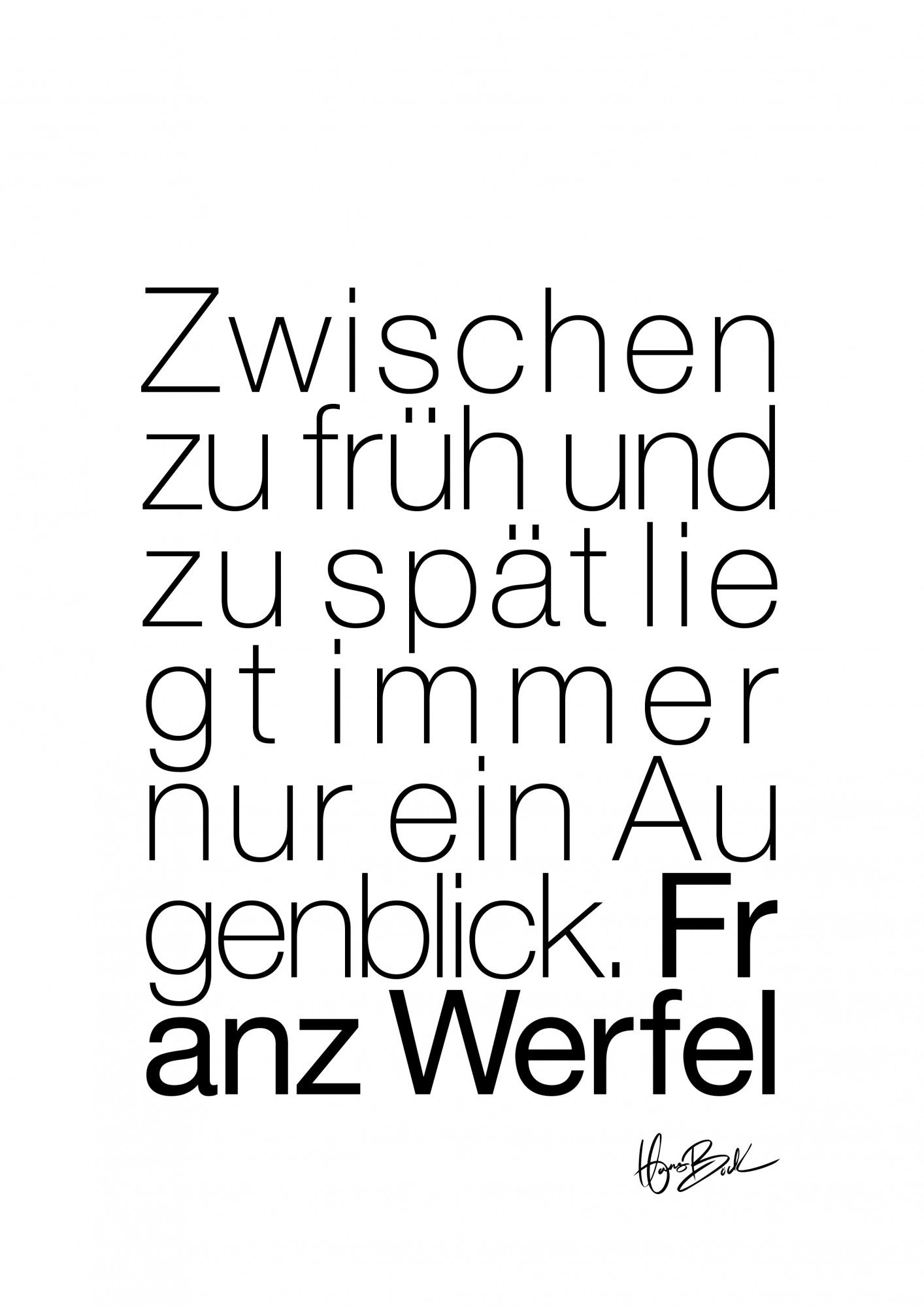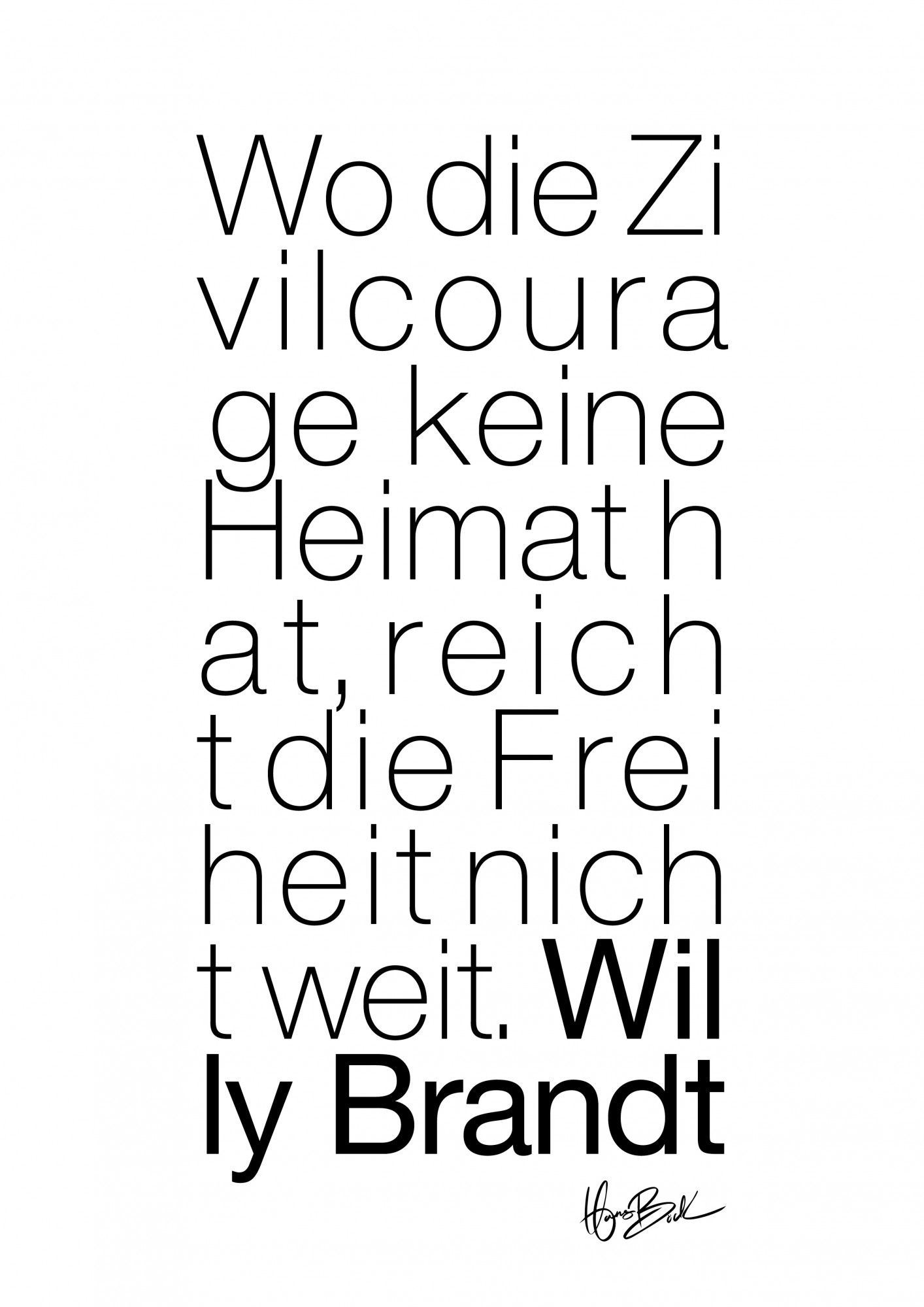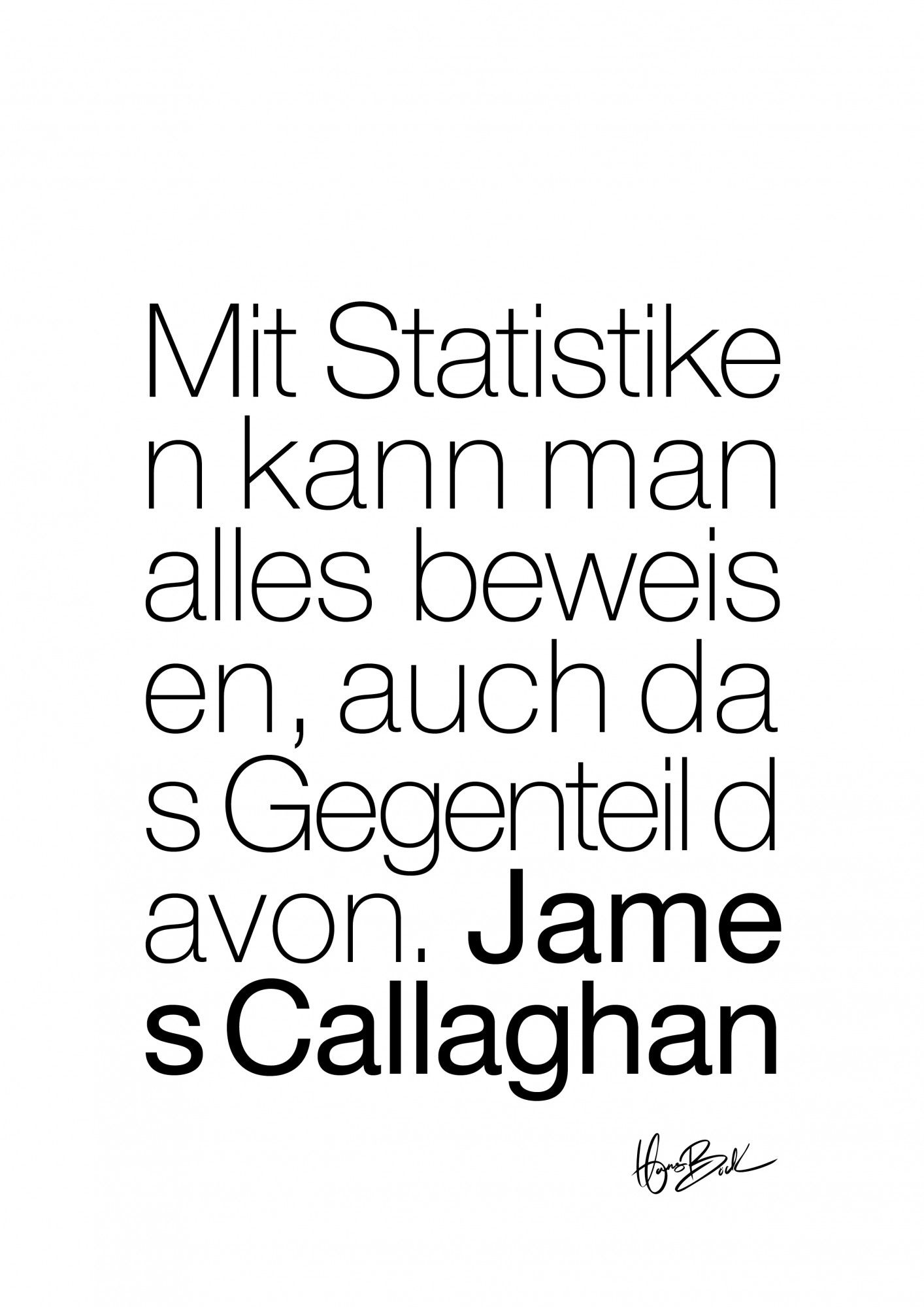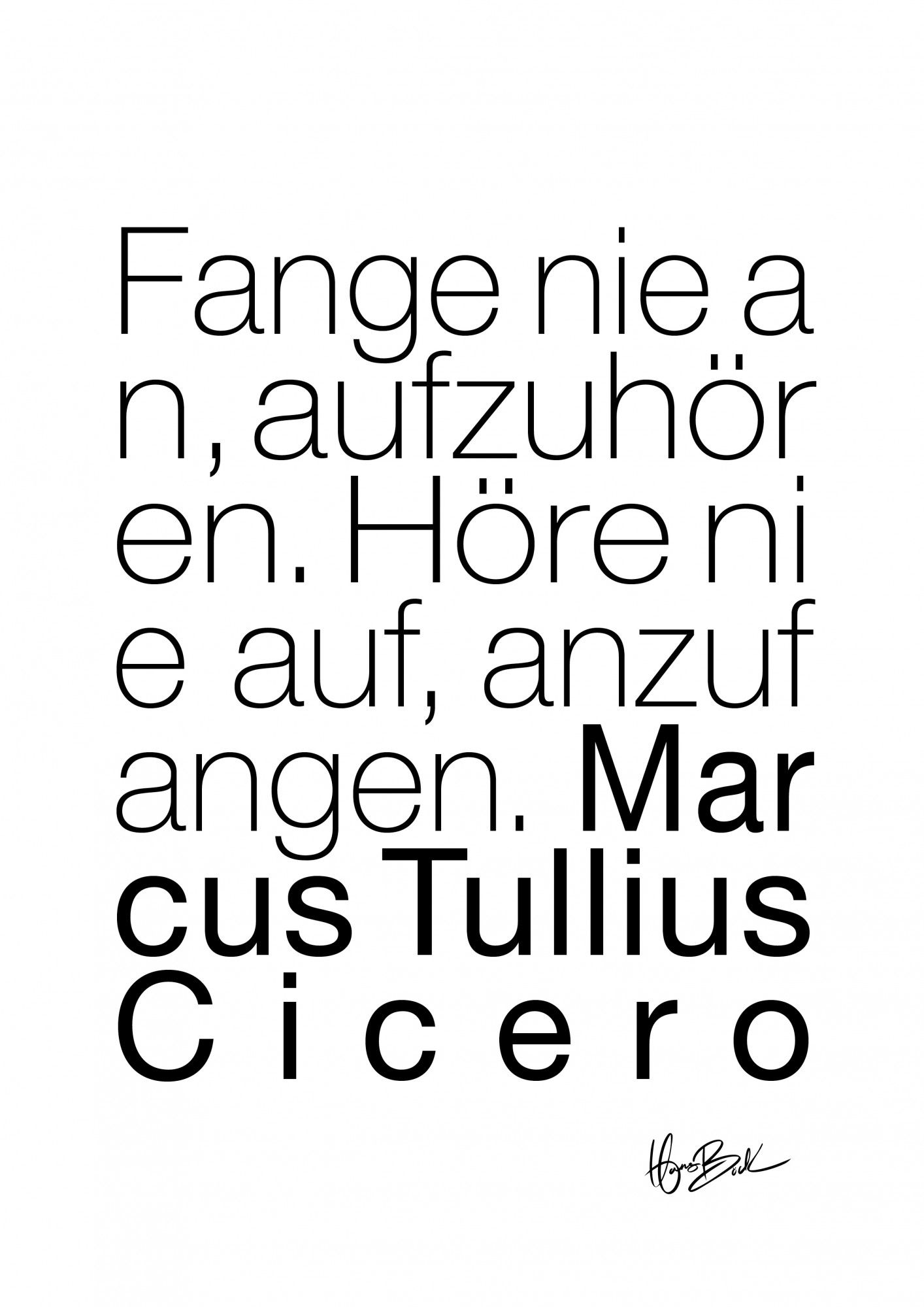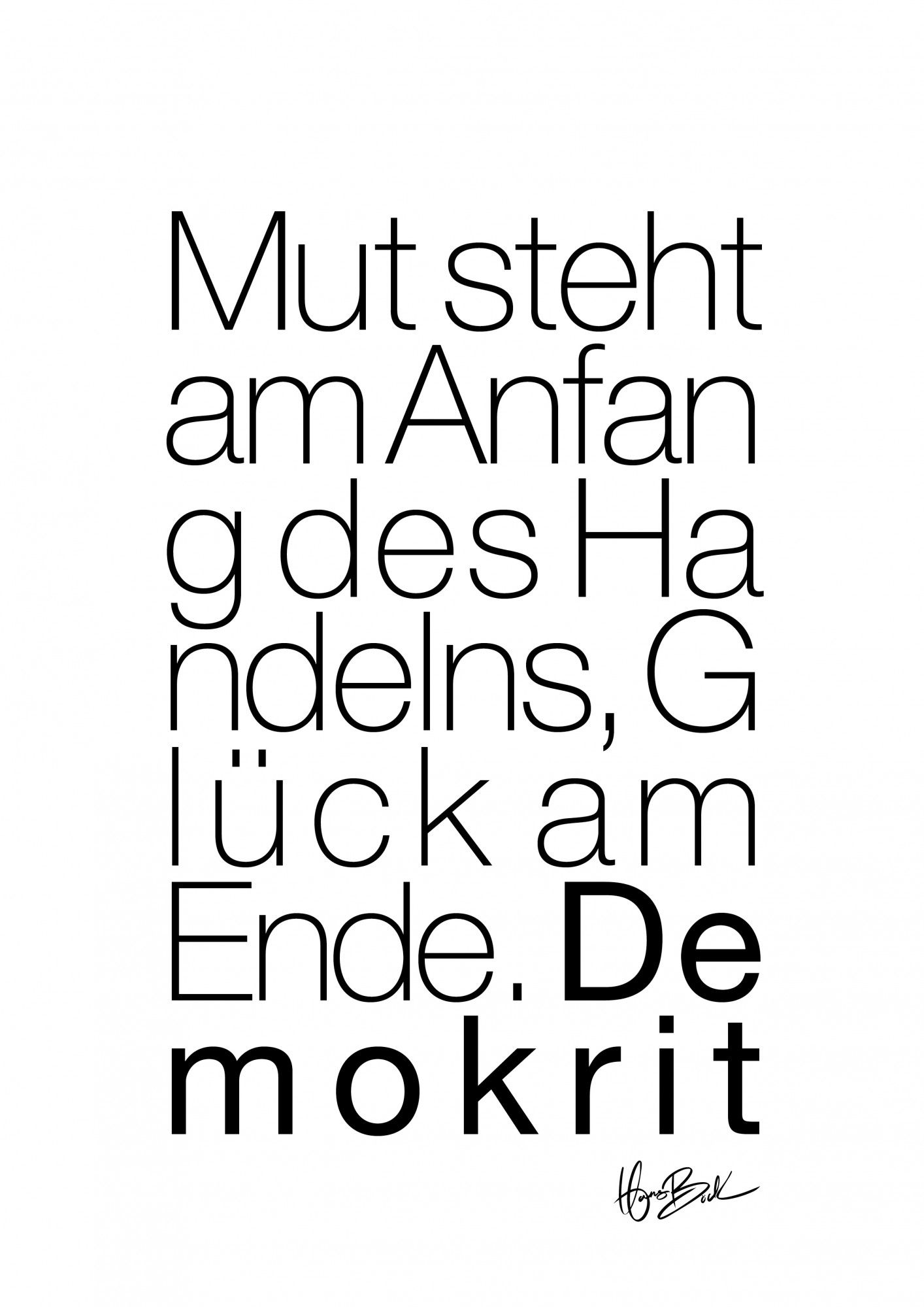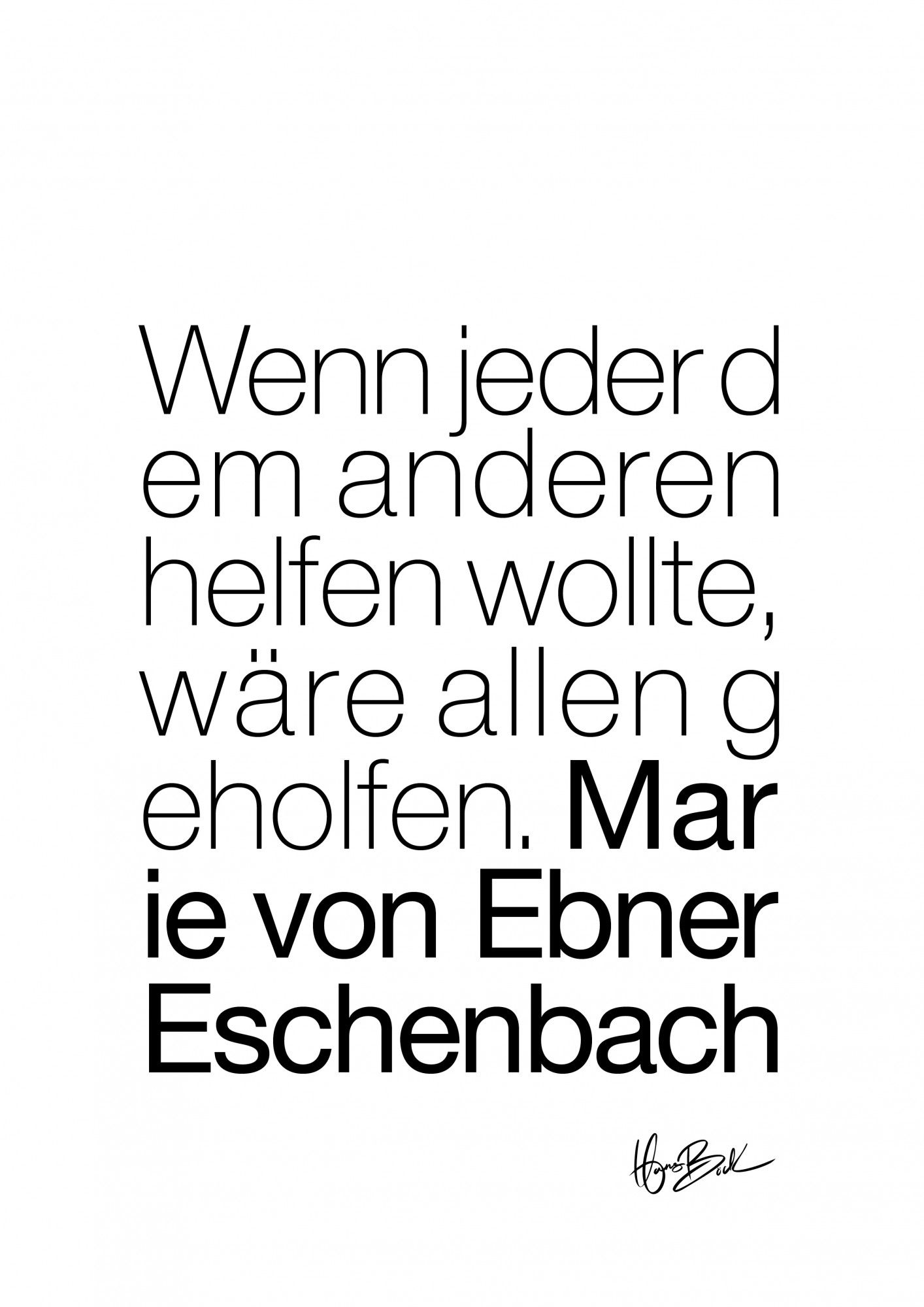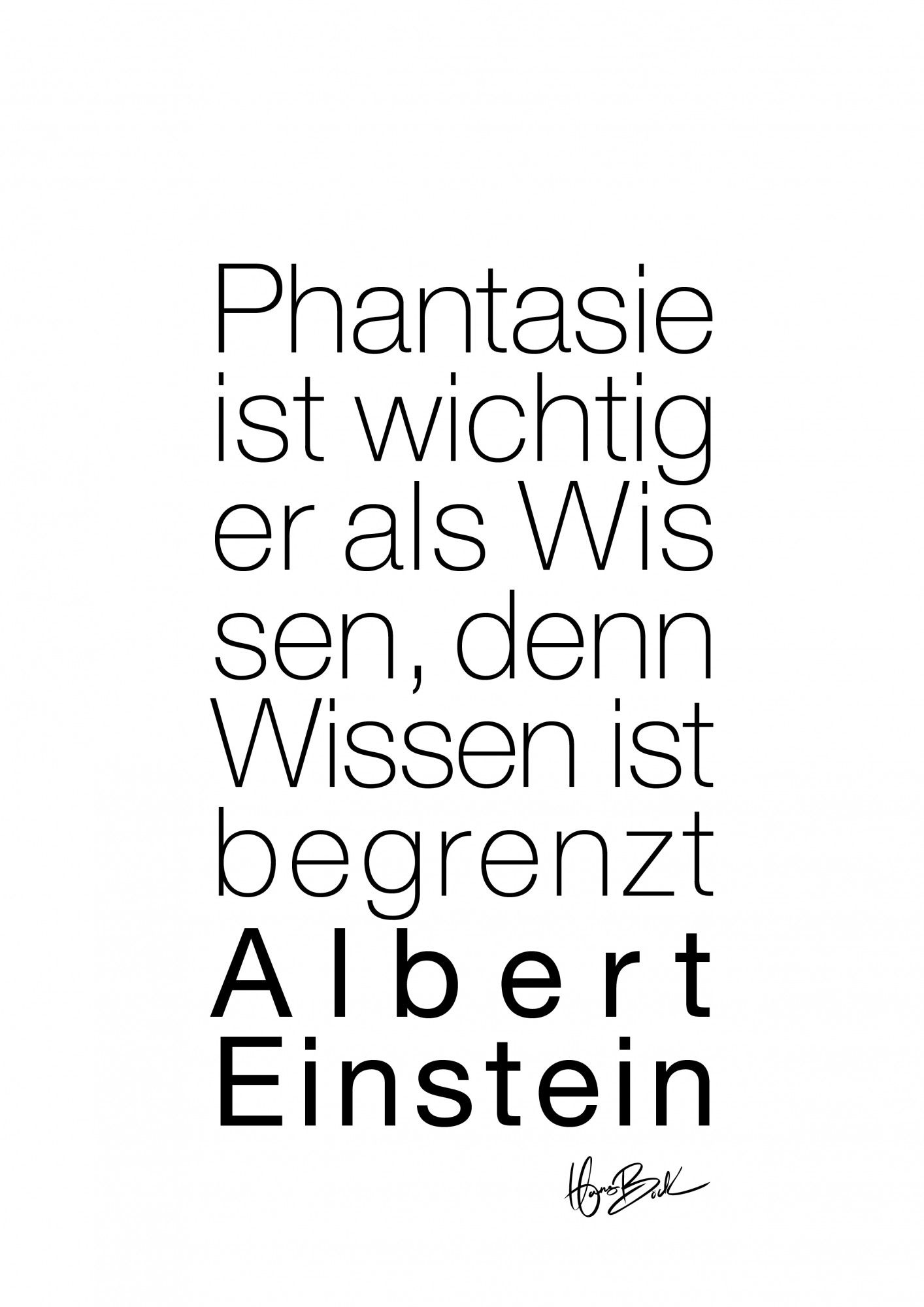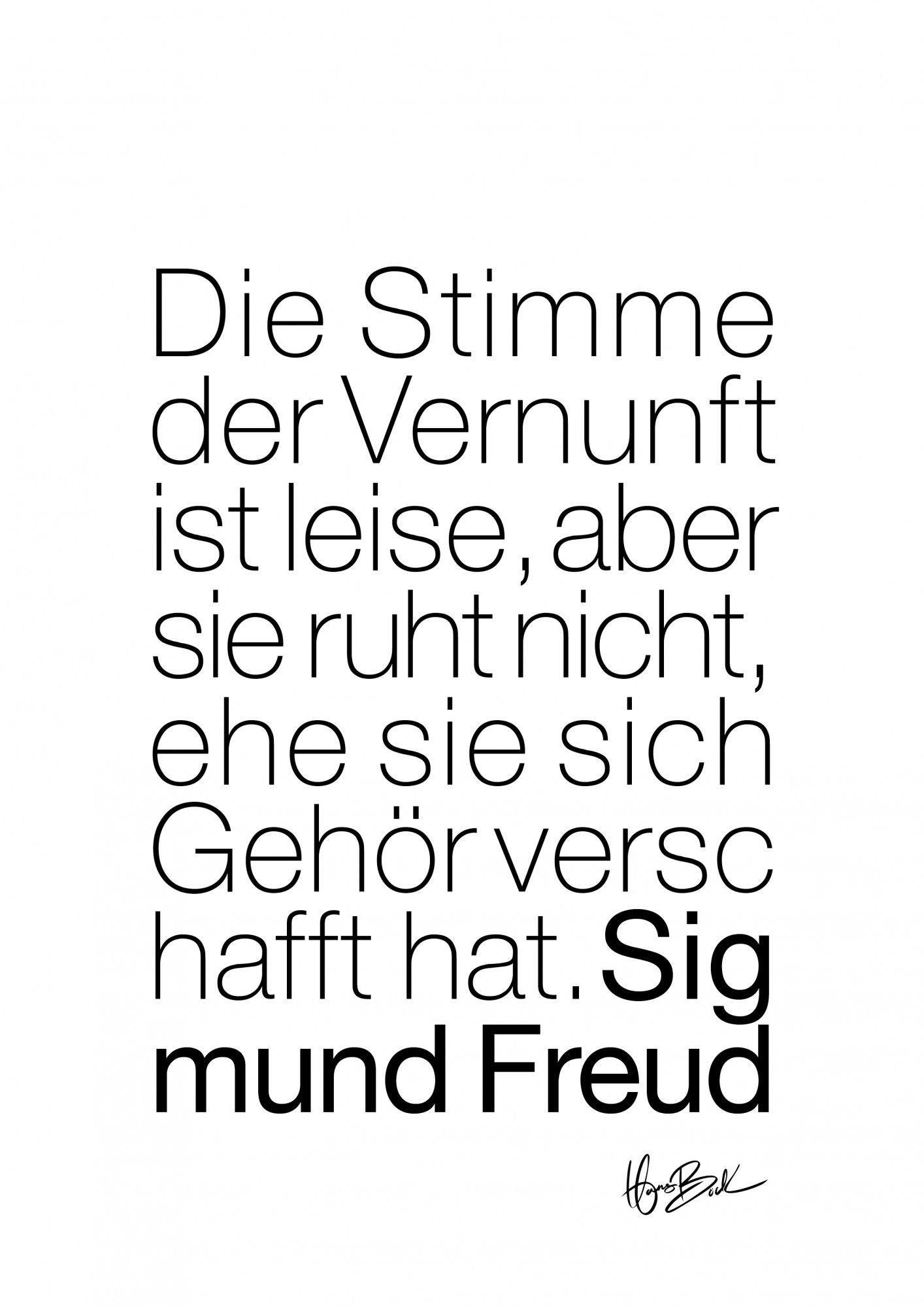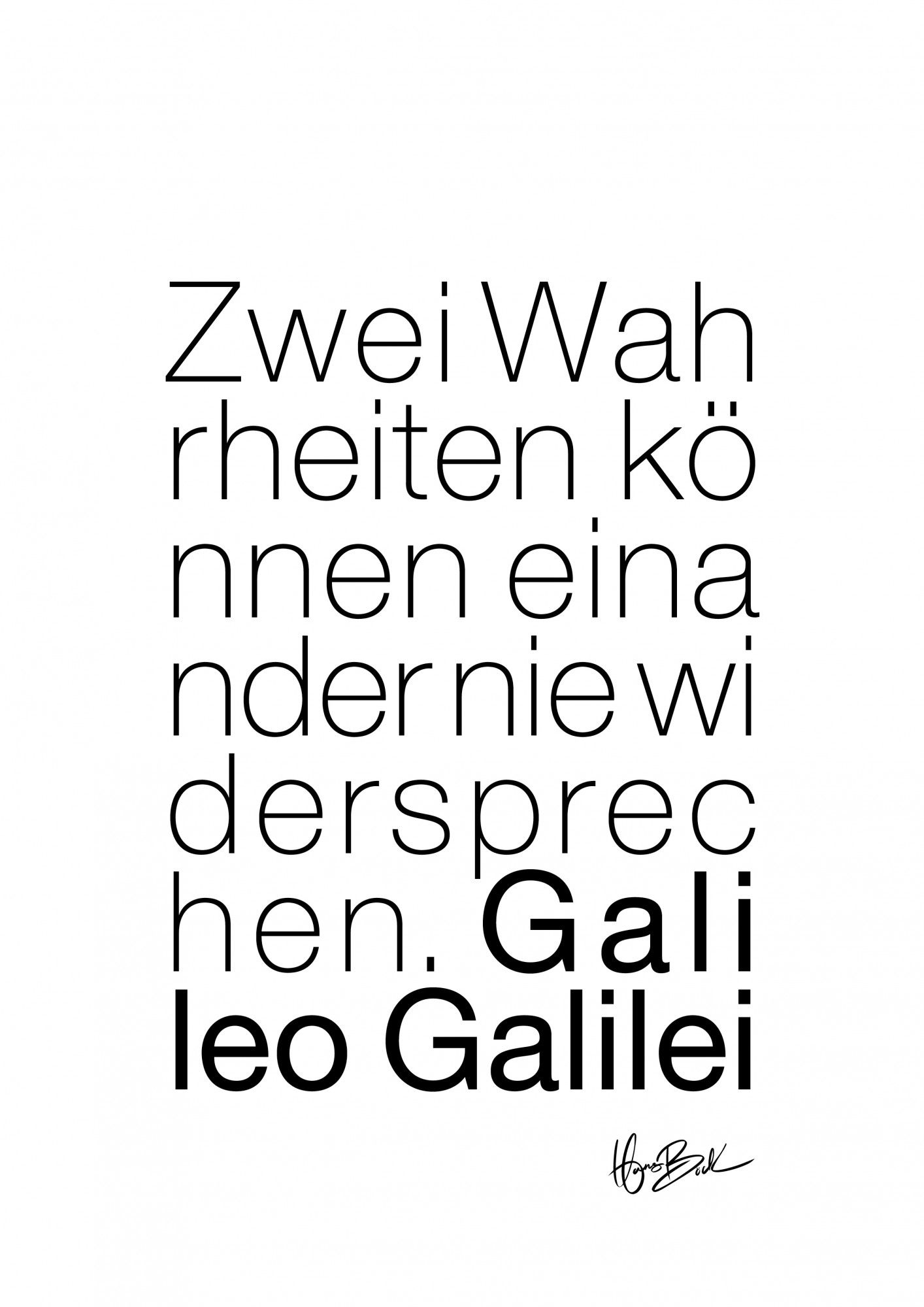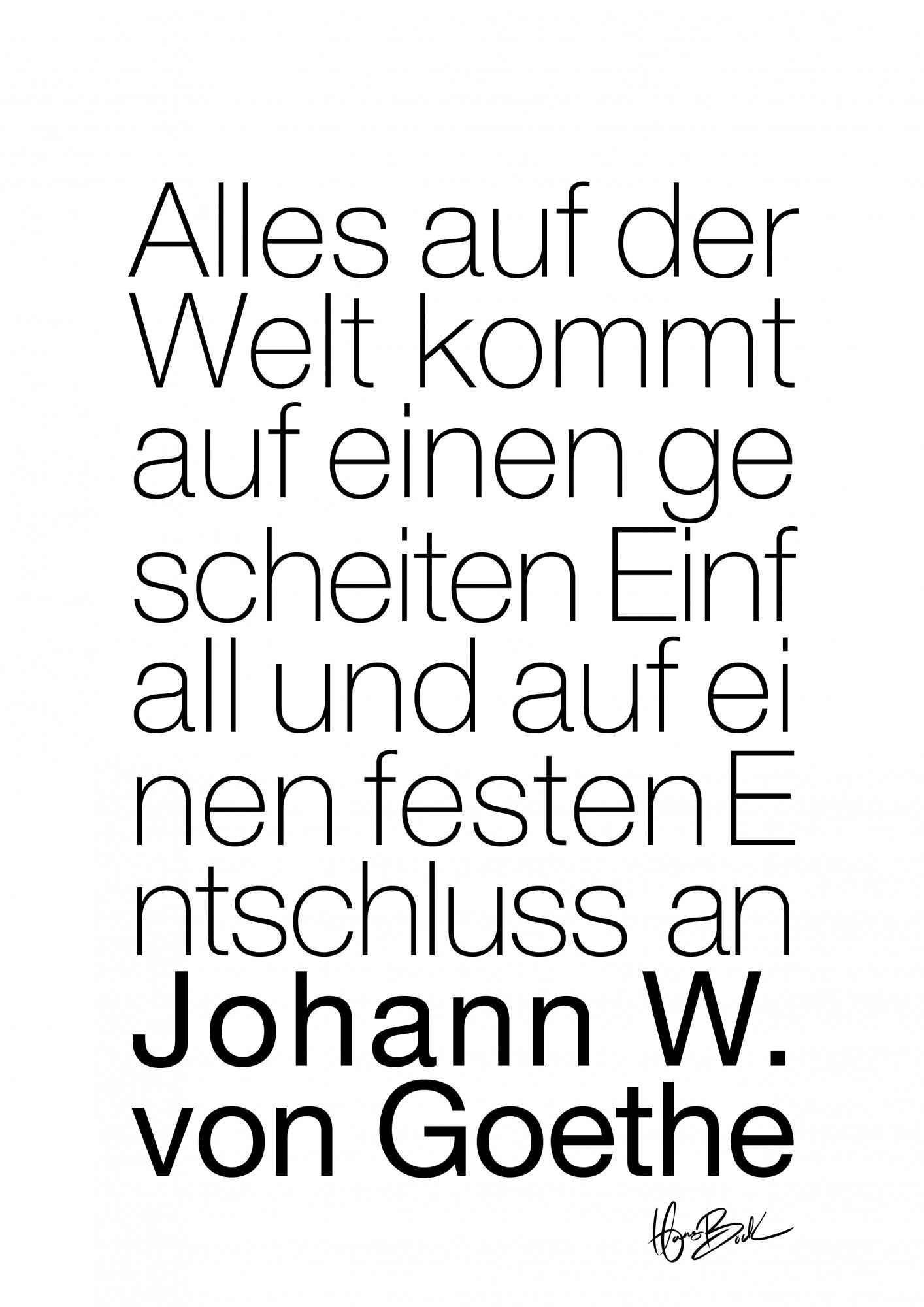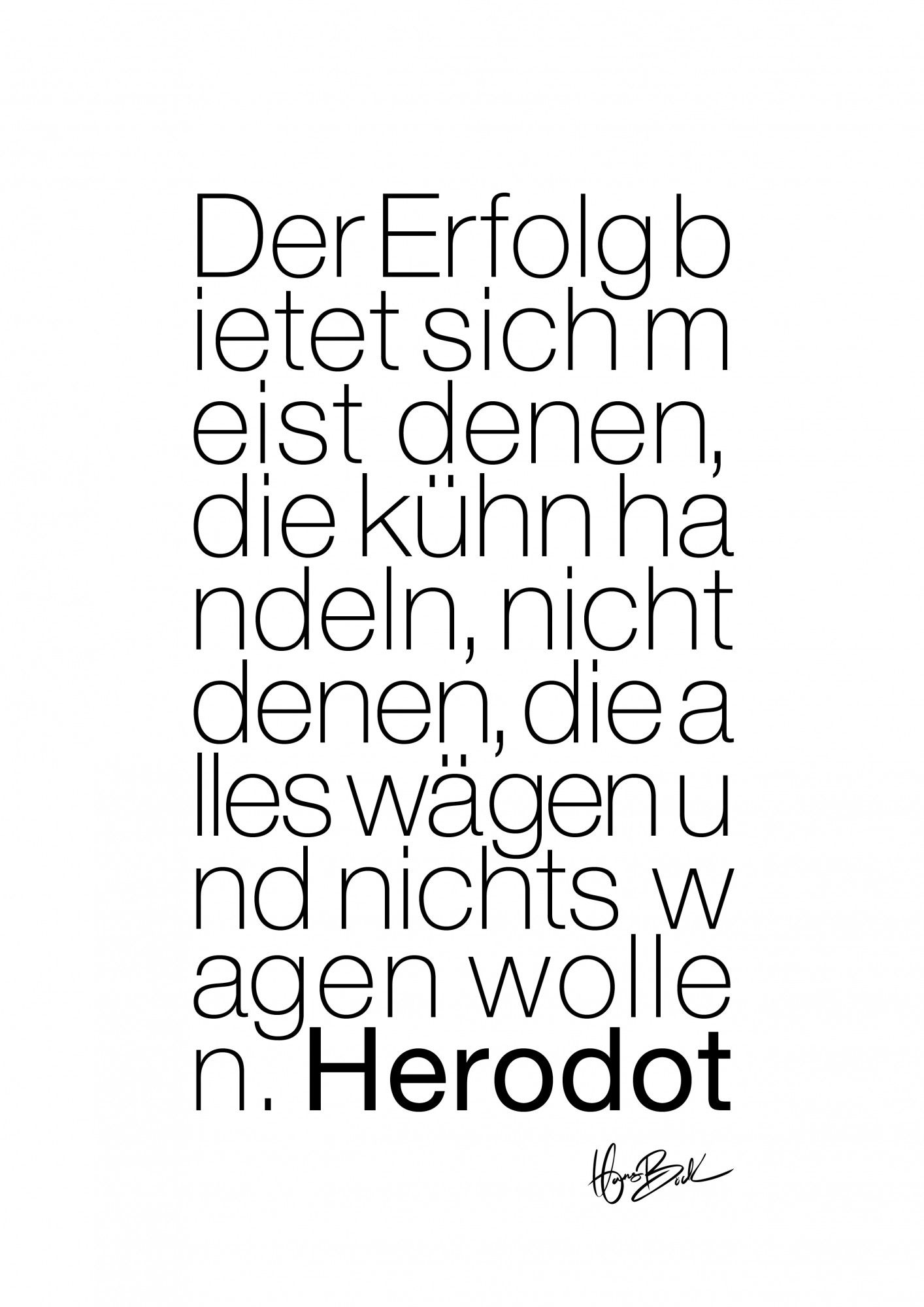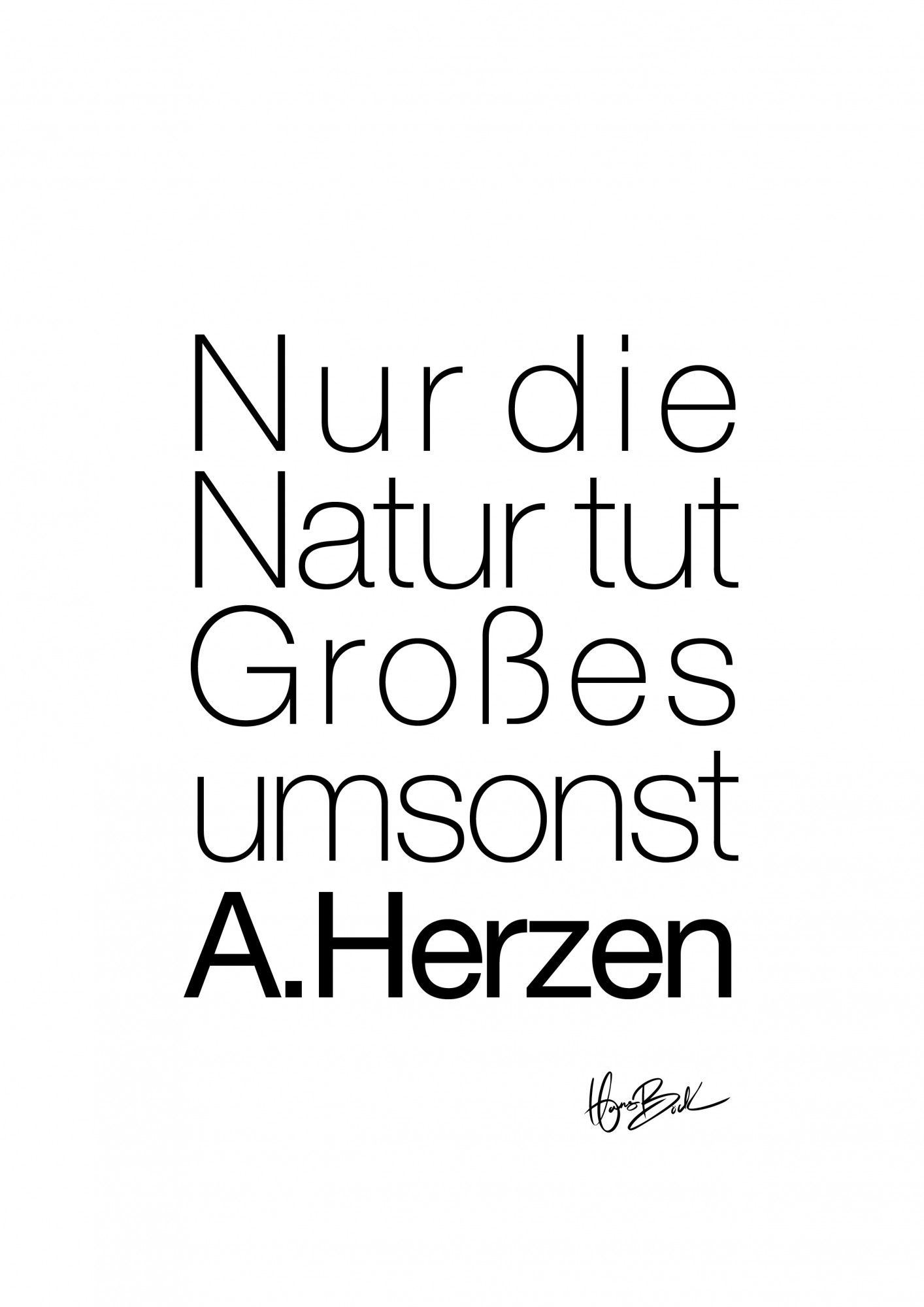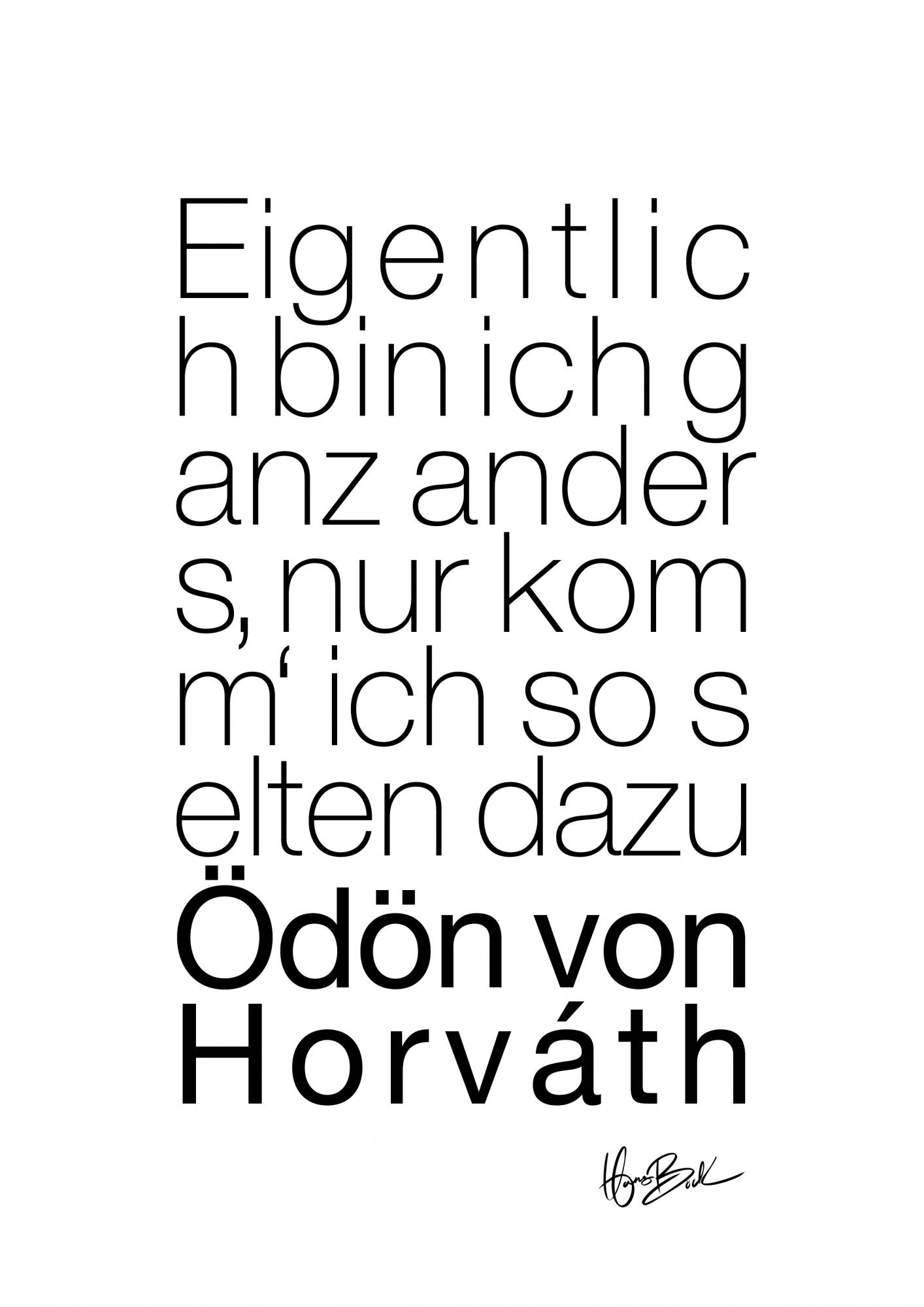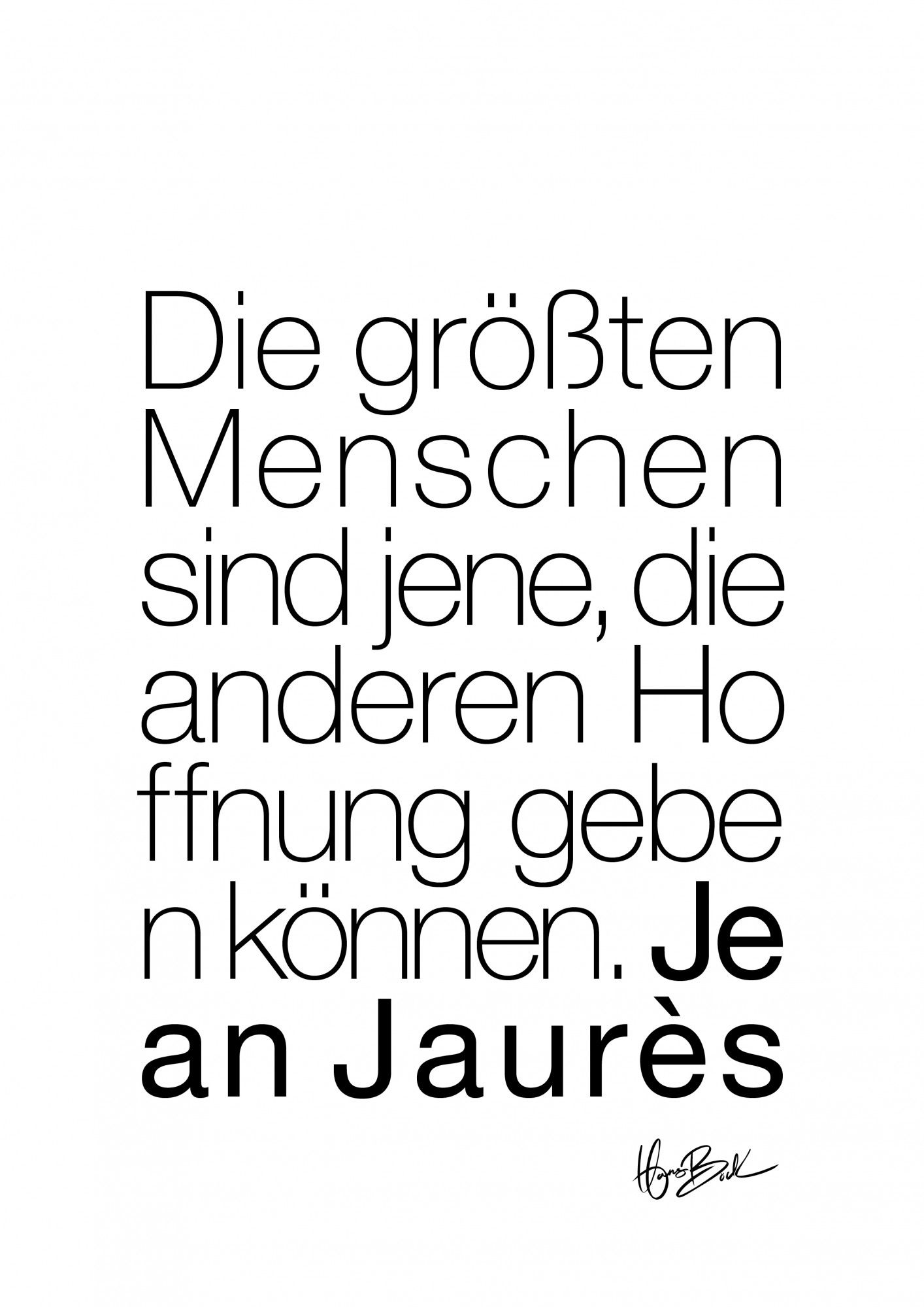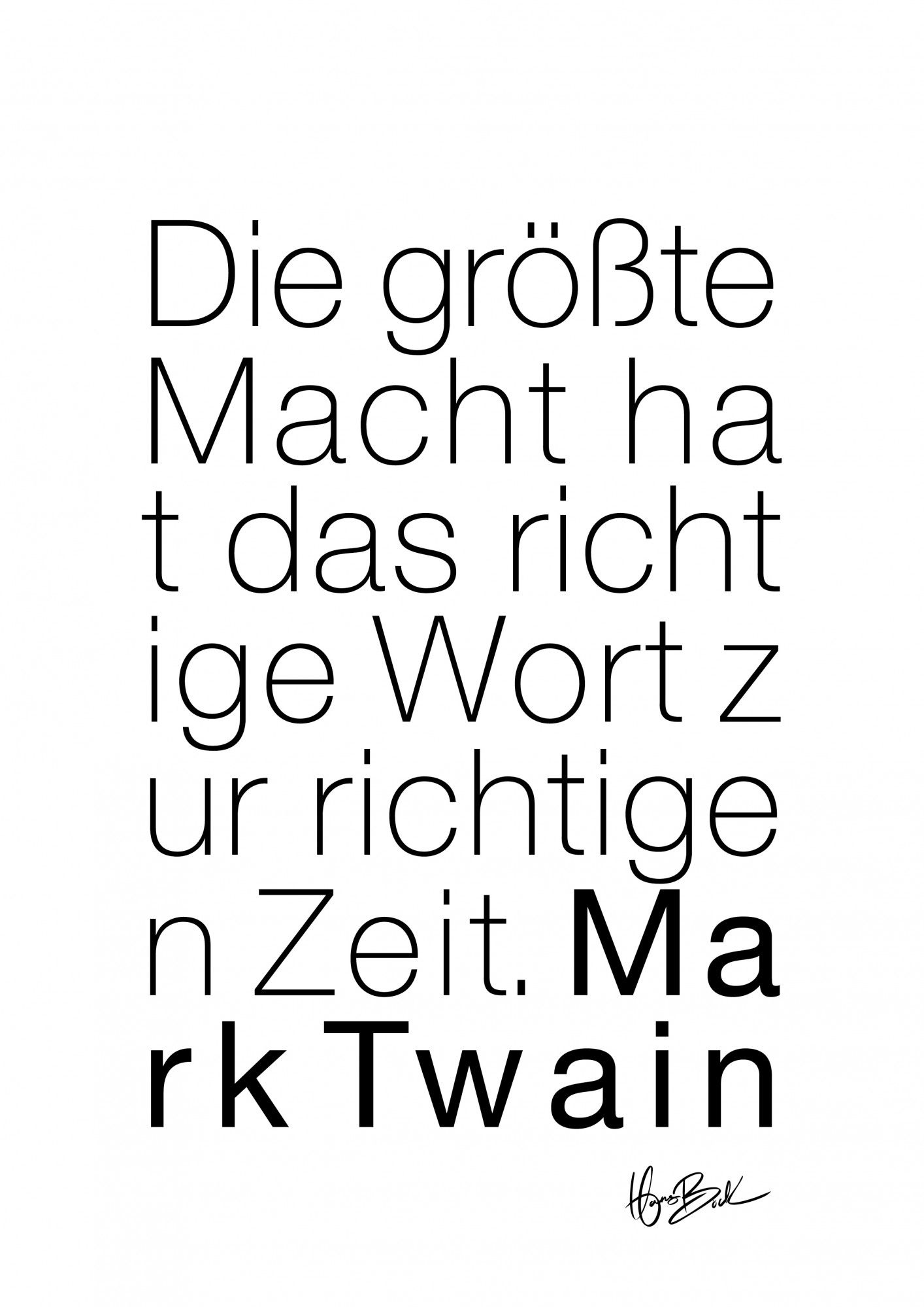Zitate von Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen
Das bekannteste Zitat von Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen:
Werte Ehren- und Festgäste, meine Damen und Herren! Seien Sie alle herzlich willkommen beim Staatsakt zum hundertjährigen Gründungstag unserer Republik.
Meine Damen und Herren! Unsere Demokratie wurde 1918 mit dem allgemeinen, freien, gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Wahlrecht verwirklicht. Endlich waren auch Frauen wahlberechtigt. Um den Platz in der Politik müssen sie aber bis heute kämpfen. Ja, Frauen sind inzwischen Abgeordnete, Parteichefinnen, Ministerinnen, Nationalratspräsidentinnen. Doch sie sind immer noch unterrepräsentiert und es bleibt immer noch viel zu tun. Das Frauenwahlrecht war eine Errungenschaft in einer Zeit, die ansonsten zu wenig Optimismus Anlass gab.
Denn der Start unserer Republik vor 100 Jahren war holprig: Der Erste Weltkrieg mit Millionen von Toten war eben zu Ende gegangen. Das große, jahrhundertealte Habsburgerreich war zerfallen. Hunger und Arbeitslosigkeit beherrschten das Leben der Menschen. Der Hoffnung, dass die junge Republik die immensen Herausforderungen bewältigen könne, stand viel Skepsis gegenüber. Vielen war es unmöglich, an eine gemeinsame, blühende Zukunft zu glauben angesichts der Feindseligkeiten, Ungewissheiten und Ängste, die den Alltag bestimmten.
Und prompt ging es schief. Die parlamentarische Demokratie wurde 1933 von Engelbert Dollfuß ausgeschaltet, ein autoritärer Ständestaat errichtet. Nach dem Einmarsch Hitlers und dem sogenannten "Anschluss", wurde unser Land Teil Nazideutschlands. Der Name "Österreich" war ausgelöscht. Hitler entfesselte einen neuen Weltkrieg. Es wütete der nationalsozialistische Terror und die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust.
Nach dem Ende des Krieges ging es 1945 erneut darum, eine demokratische Republik zu gründen. Auch dieser Neubeginn war mühsam.
Aber es gab einen ganz wesentlichen Unterschied zu den Jahren nach 1918: Wir stellten jetzt das Gemeinsame vor das Trennende.
Nur in der gemeinsam errungenen Lösung liegt das größtmögliche Wohl aller. Eine Einsicht, an die wir uns in diesen Tagen wieder erinnern sollten.
Gemeinsam gründeten die Parteien die Zweite Republik, gemeinsam verhandelten sie den Staatsvertrag, gemeinsam erklärten sie Österreichs immerwährende Neutralität, gemeinsam arbeiteten sie an Österreichs Integration in der EU. Das Talent, Gemeinsamkeit herzustellen, ist ja etwas, was im Herzen das Österreichische ausmacht: Erkannt zu haben, dass die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß, nicht aus unversöhnlichen Positionen besteht. Sondern dass eine Lösung zum Wohle aller fast immer in der Mitte liegt.
Nur in der gemeinsam errungenen Lösung liegt das größtmögliche Wohl aller. Eine Einsicht, an die wir uns in diesen Tagen wieder erinnern sollten.
Meine Damen und Herren! Nur die liberale Demokratie kennt dieses Ringen um gemeinsame Lösungen zum Wohle aller. Dieses Ringen kann mitunter anstrengend sein. Es darf uns aber nie zu anstrengend sein.
Ja, Demokratie bedeutet Diskussion, Auseinandersetzung, auch zivilisierten Streit - im Bewusstsein eines offenen Ausganges.
Demokratie bedeutet, dass auch das Gegenüber Recht haben kann. Man muss sich auf die anderen einlassen. Man muss zuhören. Das kostet Zeit.
Manche würden sich vielleicht wünschen, dass das schneller und einfacher geht. Wäre unsere Demokratie nicht ganz so liberal, so denken sie, ginge ja manches auch schneller.
Aber das ist ein Trugschluss. Es gibt keine Abkürzungen. Der Weg zur gemeinsamen Lösung mag manchmal steinig sein. Aber er ist aller Mühen wert.
Eine Einsicht, die unserem Land wirtschaftlichen Aufschwung und sozialen Frieden brachte, und Österreich zu dem machte, was viele als "Konsensdemokratie" bezeichnet haben. Es gab einen weitgehend gelungenen Interessenausgleich.
Meine Damen und Herren! Die liberale Demokratie ist mehr als die Herrschaft der Mehrheit. Die liberale Demokratie verlangt nach der Vielfalt der Stimmen, und dass keine Stimme ungehört bleibt. Grund- und Freiheitsrechte sowie unveräußerliche Minderheitenrechte sind daher wesentlich.
Zugleich muss Demokratie wachsam sein, kompromisslos gegenüber den Intoleranten. Aber offen und tolerant für den Meinungsaustausch der Demokratinnen und Demokraten. Dazu bedarf es unabhängiger und freier Medien, die den unterschiedlichen Stimmen der Demokratie Raum geben und so erst die Diskussion unter Gleichen ermöglichen.
Heute kommen die neuen Medien dazu, sie erlauben es mehr Menschen als jemals zuvor, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Die einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang. Aber die neuen Medien haben auch eine Schattenseite: Der Rückzug in die Social-Media-Echokammern und -Blasen, wo nur noch die eigene Meinung hundertfach bestätigt wird, kann zu Intoleranz und Gesprächsverweigerung führen. Verweigerung ist aber keine Lösung. Wir müssen uns aufeinander einlassen.
Meine Damen und Herren! Demokratie ist ein Prozess. Dazu gehört der Wahltag und die Wahlurne. Und der Parlamentarismus ist ein wichtiger, ja ein zentraler Teil des demokratischen Prozesses.
Aber Demokratie braucht auch das Engagement jeder und jedes Einzelnen von uns. Immer wieder und in allen Bereichen. Wir alle sind verantwortlich für die Gestaltung unserer Gesellschaft.
Dieses täglich gelebte demokratische Miteinander gerät immer wieder in die Defensive. Feindbilder werden aufgebaut: Nach dem Muster: "Wir" und die "Anderen". Die "Anderen" können die Alten sein, mitunter die Jungen, oder Musliminnen und Muslime, oder Jüdinnen und Juden, in manchen Ländern Christinnen und Christen, oder Ausländerinnen und Ausländer, oder Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen- und -Empfänger.
Solche Zuschreibungen münden fast immer in die Aushöhlung von Grund- und Freiheitsrechten sowie zu systematischer Diskriminierung. Stattdessen sollten wir uns öfter in die Lage der Anderen versetzen. Wir alle können schließlich in Situationen kommen, wo wir auf Hilfe, auf Solidarität angewiesen sind. Verhalten wir uns also Anderen gegenüber so, wie wir es für uns selbst wünschen würden.
Meine Damen und Herren! Ich habe die Bedeutung des Gemeinsamen betont. Das scheint mir für die politische Kultur in unserem Land und für die Zukunft Österreichs ganz wesentlich zu sein: Konsenssuche bedeutet nicht, Konflikte unter den Teppich zu kehren, sich die Macht im Stillen untereinander aufzuteilen, Weichenstellungen und Richtungsentscheidungen auf ewig zu vertagen.
Konsenssuche bedeutet durchaus, Konflikte öffentlich auszutragen, die Machtaufteilung öffentlich zu machen, Weichenstellungen und Richtungsentscheidungen legitimerweise zu treffen. Aber nicht die alleinige Machtausübung der Mehrheit ist ihr Ziel, sondern die Einbeziehung und Beachtung der Minderheitsmeinungen. Die politisch Andersdenkenden sind demokratische Partnerinnen und Partner, nicht Feindinnen und Feinde.
Meine Damen und Herren! Die Suche nach dem Gemeinsamen hat Österreich erfolgreich gemacht und viele in Europa haben uns darum beneidet. Erneuern wir diese Gemeinsamkeit, erneuern wir dieses Österreichische.
Dann muss uns vor der Zukunft nicht bange sein. Denn wir alle sind Teil eines friedlichen, freien und erfolgreichen Österreichs und natürlich Teil eines friedlichen, freien und erfolgreichen Europas. Es lebe unsere Heimat, die Republik Österreich.
Es lebe unser gemeinsames, friedliches Europa. Danke. (Staatsakt "100 Jahre Republik Österreich" am 12. 11. 2018 in der Wiener Staatsoper).
Meine Damen und Herren! Unsere Demokratie wurde 1918 mit dem allgemeinen, freien, gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Wahlrecht verwirklicht. Endlich waren auch Frauen wahlberechtigt. Um den Platz in der Politik müssen sie aber bis heute kämpfen. Ja, Frauen sind inzwischen Abgeordnete, Parteichefinnen, Ministerinnen, Nationalratspräsidentinnen. Doch sie sind immer noch unterrepräsentiert und es bleibt immer noch viel zu tun. Das Frauenwahlrecht war eine Errungenschaft in einer Zeit, die ansonsten zu wenig Optimismus Anlass gab.
Denn der Start unserer Republik vor 100 Jahren war holprig: Der Erste Weltkrieg mit Millionen von Toten war eben zu Ende gegangen. Das große, jahrhundertealte Habsburgerreich war zerfallen. Hunger und Arbeitslosigkeit beherrschten das Leben der Menschen. Der Hoffnung, dass die junge Republik die immensen Herausforderungen bewältigen könne, stand viel Skepsis gegenüber. Vielen war es unmöglich, an eine gemeinsame, blühende Zukunft zu glauben angesichts der Feindseligkeiten, Ungewissheiten und Ängste, die den Alltag bestimmten.
Und prompt ging es schief. Die parlamentarische Demokratie wurde 1933 von Engelbert Dollfuß ausgeschaltet, ein autoritärer Ständestaat errichtet. Nach dem Einmarsch Hitlers und dem sogenannten "Anschluss", wurde unser Land Teil Nazideutschlands. Der Name "Österreich" war ausgelöscht. Hitler entfesselte einen neuen Weltkrieg. Es wütete der nationalsozialistische Terror und die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust.
Nach dem Ende des Krieges ging es 1945 erneut darum, eine demokratische Republik zu gründen. Auch dieser Neubeginn war mühsam.
Aber es gab einen ganz wesentlichen Unterschied zu den Jahren nach 1918: Wir stellten jetzt das Gemeinsame vor das Trennende.
Nur in der gemeinsam errungenen Lösung liegt das größtmögliche Wohl aller. Eine Einsicht, an die wir uns in diesen Tagen wieder erinnern sollten.
Gemeinsam gründeten die Parteien die Zweite Republik, gemeinsam verhandelten sie den Staatsvertrag, gemeinsam erklärten sie Österreichs immerwährende Neutralität, gemeinsam arbeiteten sie an Österreichs Integration in der EU. Das Talent, Gemeinsamkeit herzustellen, ist ja etwas, was im Herzen das Österreichische ausmacht: Erkannt zu haben, dass die Welt eben nicht aus Schwarz und Weiß, nicht aus unversöhnlichen Positionen besteht. Sondern dass eine Lösung zum Wohle aller fast immer in der Mitte liegt.
Nur in der gemeinsam errungenen Lösung liegt das größtmögliche Wohl aller. Eine Einsicht, an die wir uns in diesen Tagen wieder erinnern sollten.
Meine Damen und Herren! Nur die liberale Demokratie kennt dieses Ringen um gemeinsame Lösungen zum Wohle aller. Dieses Ringen kann mitunter anstrengend sein. Es darf uns aber nie zu anstrengend sein.
Ja, Demokratie bedeutet Diskussion, Auseinandersetzung, auch zivilisierten Streit - im Bewusstsein eines offenen Ausganges.
Demokratie bedeutet, dass auch das Gegenüber Recht haben kann. Man muss sich auf die anderen einlassen. Man muss zuhören. Das kostet Zeit.
Manche würden sich vielleicht wünschen, dass das schneller und einfacher geht. Wäre unsere Demokratie nicht ganz so liberal, so denken sie, ginge ja manches auch schneller.
Aber das ist ein Trugschluss. Es gibt keine Abkürzungen. Der Weg zur gemeinsamen Lösung mag manchmal steinig sein. Aber er ist aller Mühen wert.
Eine Einsicht, die unserem Land wirtschaftlichen Aufschwung und sozialen Frieden brachte, und Österreich zu dem machte, was viele als "Konsensdemokratie" bezeichnet haben. Es gab einen weitgehend gelungenen Interessenausgleich.
Meine Damen und Herren! Die liberale Demokratie ist mehr als die Herrschaft der Mehrheit. Die liberale Demokratie verlangt nach der Vielfalt der Stimmen, und dass keine Stimme ungehört bleibt. Grund- und Freiheitsrechte sowie unveräußerliche Minderheitenrechte sind daher wesentlich.
Zugleich muss Demokratie wachsam sein, kompromisslos gegenüber den Intoleranten. Aber offen und tolerant für den Meinungsaustausch der Demokratinnen und Demokraten. Dazu bedarf es unabhängiger und freier Medien, die den unterschiedlichen Stimmen der Demokratie Raum geben und so erst die Diskussion unter Gleichen ermöglichen.
Heute kommen die neuen Medien dazu, sie erlauben es mehr Menschen als jemals zuvor, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Die einzige Voraussetzung ist ein Internetzugang. Aber die neuen Medien haben auch eine Schattenseite: Der Rückzug in die Social-Media-Echokammern und -Blasen, wo nur noch die eigene Meinung hundertfach bestätigt wird, kann zu Intoleranz und Gesprächsverweigerung führen. Verweigerung ist aber keine Lösung. Wir müssen uns aufeinander einlassen.
Meine Damen und Herren! Demokratie ist ein Prozess. Dazu gehört der Wahltag und die Wahlurne. Und der Parlamentarismus ist ein wichtiger, ja ein zentraler Teil des demokratischen Prozesses.
Aber Demokratie braucht auch das Engagement jeder und jedes Einzelnen von uns. Immer wieder und in allen Bereichen. Wir alle sind verantwortlich für die Gestaltung unserer Gesellschaft.
Dieses täglich gelebte demokratische Miteinander gerät immer wieder in die Defensive. Feindbilder werden aufgebaut: Nach dem Muster: "Wir" und die "Anderen". Die "Anderen" können die Alten sein, mitunter die Jungen, oder Musliminnen und Muslime, oder Jüdinnen und Juden, in manchen Ländern Christinnen und Christen, oder Ausländerinnen und Ausländer, oder Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen- und -Empfänger.
Solche Zuschreibungen münden fast immer in die Aushöhlung von Grund- und Freiheitsrechten sowie zu systematischer Diskriminierung. Stattdessen sollten wir uns öfter in die Lage der Anderen versetzen. Wir alle können schließlich in Situationen kommen, wo wir auf Hilfe, auf Solidarität angewiesen sind. Verhalten wir uns also Anderen gegenüber so, wie wir es für uns selbst wünschen würden.
Meine Damen und Herren! Ich habe die Bedeutung des Gemeinsamen betont. Das scheint mir für die politische Kultur in unserem Land und für die Zukunft Österreichs ganz wesentlich zu sein: Konsenssuche bedeutet nicht, Konflikte unter den Teppich zu kehren, sich die Macht im Stillen untereinander aufzuteilen, Weichenstellungen und Richtungsentscheidungen auf ewig zu vertagen.
Konsenssuche bedeutet durchaus, Konflikte öffentlich auszutragen, die Machtaufteilung öffentlich zu machen, Weichenstellungen und Richtungsentscheidungen legitimerweise zu treffen. Aber nicht die alleinige Machtausübung der Mehrheit ist ihr Ziel, sondern die Einbeziehung und Beachtung der Minderheitsmeinungen. Die politisch Andersdenkenden sind demokratische Partnerinnen und Partner, nicht Feindinnen und Feinde.
Meine Damen und Herren! Die Suche nach dem Gemeinsamen hat Österreich erfolgreich gemacht und viele in Europa haben uns darum beneidet. Erneuern wir diese Gemeinsamkeit, erneuern wir dieses Österreichische.
Dann muss uns vor der Zukunft nicht bange sein. Denn wir alle sind Teil eines friedlichen, freien und erfolgreichen Österreichs und natürlich Teil eines friedlichen, freien und erfolgreichen Europas. Es lebe unsere Heimat, die Republik Österreich.
Es lebe unser gemeinsames, friedliches Europa. Danke. (Staatsakt "100 Jahre Republik Österreich" am 12. 11. 2018 in der Wiener Staatsoper).
Informationen über Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen
9. Bundespräsident der 2. Republik, Amtszeit: seit 26. 1. 2017, Wirtschaftsexperte, Politiker, vom 13. 12. 1997 - 3. 10. 2008 Bundessprecher der "Grünen", vom 21. 10. 1999 - 3. 10. 2008 Klubchef der "Grünen" (Österreich, 1944).
Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen · Geburtsdatum
Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen ist heute 81 Jahre, 3 Monate, 22 Tage oder 29.698 Tage jung.
Geboren am 18.01.1944 in Wien
Sternzeichen: ♑ Steinbock
Unbekannt
Weitere 85 Zitate von Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen
-
Eine Verfassung ist das Betriebssystem der Demokratie.
-
Es gibt im Deutschen das Märchen vom "Hans im Glück", in dem ein junger Mann einen großen Klumpen Gold, den er anfänglich besitzt, erst gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh, usw. und schlussendlich gegen einen Stein eintauscht. Weil er sich einreden lässt, das sei jeweils ein gutes Geschäft. Das ist natürlich nicht sehr klug von ihm, aber wir stehen in Europa knapp vor dem Punkt, an dem der Affekt wichtiger wird als die Vernunft. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Es ist bestürzend, dass schlichte Tatsachen oder bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse auch von manchen politischen Playern bisweilen geleugnet und sogar abgestritten werden. Wenn wir hier nicht klar auftreten und die Dinge beim Namen nennen, steht eines Tages unser gesamtes Gesellschafts- und Wertesystem infrage. Medien spielen dabei eine wichtige Rolle und tragen eine große Verantwortung. (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).
-
Es ist ja oft nicht die Frage, ob man Argumente teilt, sondern ob jemand überhaupt welche hat.
-
Es ist unser aller Aufgabe, ein Bild von einer Zukunft zu entwerfen, auf die man sich wieder freuen kann. Wir alle entwerfen dieses Bild durch unser tägliches Handeln. (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).
-
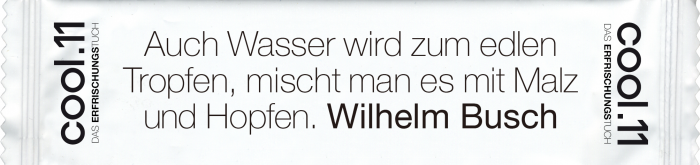
-
Es ist unsere Pflicht, allen ein Leben in Frieden und Freiheit zu ermöglichen.
-
Europa ist ein Kontinent des "UND" - und nicht des "Entweder/Oder". Das macht uns auf dieser Erde einzigartig. Unser aller Zukunft ist direkt mit der zukünftigen Rolle Europas in der Welt verbunden. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Gemeinsam können wir alle - alt und jung - die anstehenden Herausforderungen, die vor uns liegen, meistern. Wir Ältere dürfen nicht zulassen, dass Europa den Jungen gestohlen wird. Denn wiederaufzubauen, was einmal zerstört wurde, ist mühsam und zeitaufwändig. Es braucht nur wenige Minuten, um einen Baum zu fällen, aber Jahrzehnte, ihn wieder wachsen zu lassen. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Gewöhnen wir uns bitte wieder ab, der puren Logik der Klicks zu folgen. Ich weiß schon, die Überschrift, die am meisten aufregt, generiert auch die meiste Aufmerksamkeit. Aber verdient sie diese wirklich? Ist sie wichtig genug? (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).
-
Grasser wird das Budgetloch nicht auf dem Golfplatz finden.
-
Ich glaube an ein gemeinsames Europa, wo die rechtsstaatlichen Grundfesten unserer Demokratien fest verankert sind, wo der Klimawandel ernst genommen wird, und wo wir zwischen Tatsachen, fake news und alternative facts sehr wohl unterscheiden können. Und ja, ich glaube an ein Europa, das mit seinem rechtsstaatlichen Wertefundament auch weiter das Vorbild für die ganze Welt sein kann. Wir können und wir müssen als Vorbild für die Welt vorangehen. Wir können zeigen, dass unsere europäischen Werte unverhandelbar sind. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Ich glaube an ein gemeinsames, starkes Europa der Grundwerte, der Menschenrechte, der Freiheit, der Gleichheit und Brüderlichkeit - Solidarität würde ich dazu heute sagen. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Ich halt's mit dem Philosophen, der gesagt hat: Ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf Luxus.
-
Ich halte nichts von der platonischen Republik, von der Vorstellung, dass man alles nur Experten anvertrauen muss.
-
Ich kenn' Leute, die haben drei Doktorate und ich halte sie trotzdem für echte Deppen.
-
Ich persönlich glaube an unsere liberale Demokratie. Ich weiß, dass wir die Lösungen haben. Aber sie werden teilweise diffamiert. Das ist die Art des Populismus. Populismus holt nicht das Beste aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste. Das Trennende, Ausgrenzende.
-
Ich verstehe nur zu gut, dass junge Menschen wütend und verzweifelt sind. Es geht um ihre Zukunft. Wir müssen etwas tun! Wir müssen so schnell wie möglich raus aus der fossilen Energie. Und wir können etwas tun. Ich will jedenfalls das Meinige dazu beitragen. (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).
-
In meiner Antrittsrede im Österreichischen Parlament habe ich mich direkt an die jüngsten Generationen gewandt. Lassen Sie mich hier und heute diese Worte an die Jüngsten unter uns, an die Zukunft Europas wiederholen: Ihr, die ihr jetzt am Beginn Eures Weges steht. Ihr, die ihr in den Kindergarten geht. Ihr, die ihr das erste Mal die Schule besucht. Einen Beruf erlernt oder an einer Universität inskribiert seid. Ihr seid es, die die Welt neu bauen werden. Ihr seid es, die Europa neu bauen werden. Und wir brauchen Euch. Eure Leidenschaft. Eure Ideen. Euren Respekt und Euren Widerspruch. Eure Talente. Und nicht zuletzt Eure Zuversicht. So wird dieses Europa bestehen. (Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg am 14. 2. 2017).
-
Korrekte Information? Dafür müssen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen im Journalismus passen. Und deshalb sollten wir als Gemeinschaft, als Staat, Medien als wesentliche Säule unserer Demokratie sehen und für eine entsprechende Finanzierung sorgen. Denn liberale Demokratie gibt es nicht ohne korrekte Information. (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).
-
Lassen wir uns also nicht von der Angst das Bild unserer Zukunft diktieren. Sondern von der Zuversicht: "Wir kriegen das hin" - das sind keine leeren Worte. (In seiner Rede nach der Angelobung vor der Bundesversammlung am 26. 1. 2023).