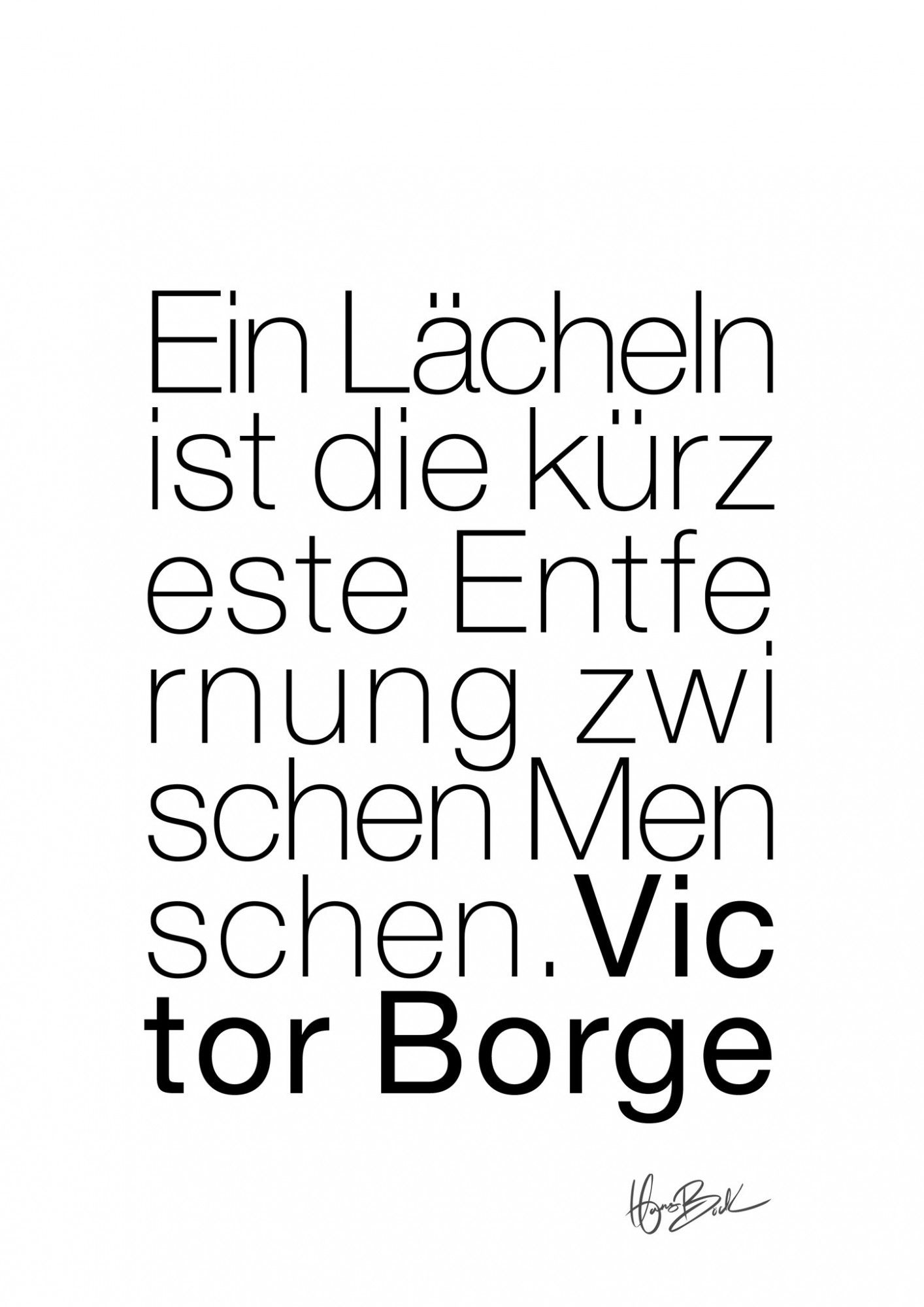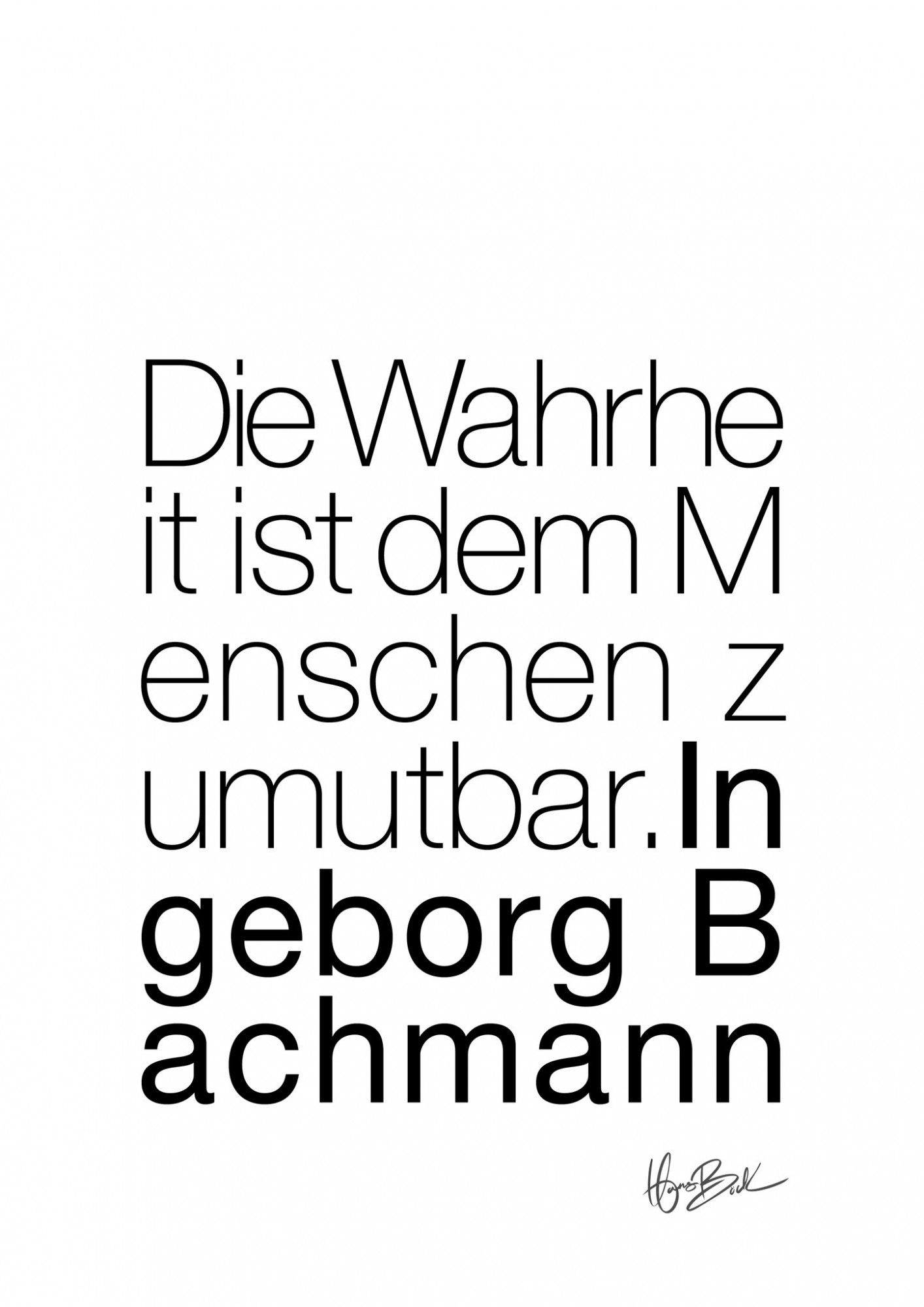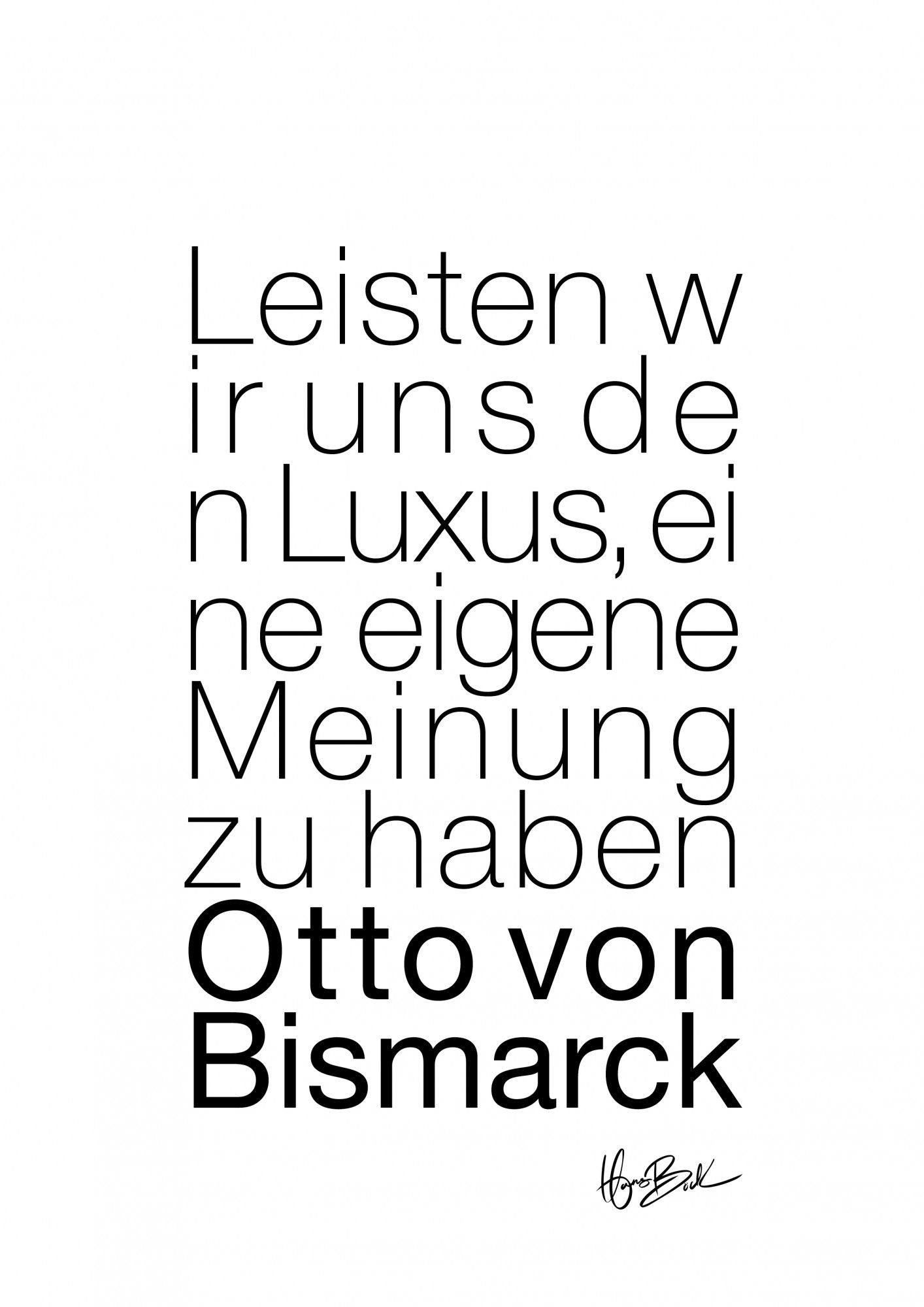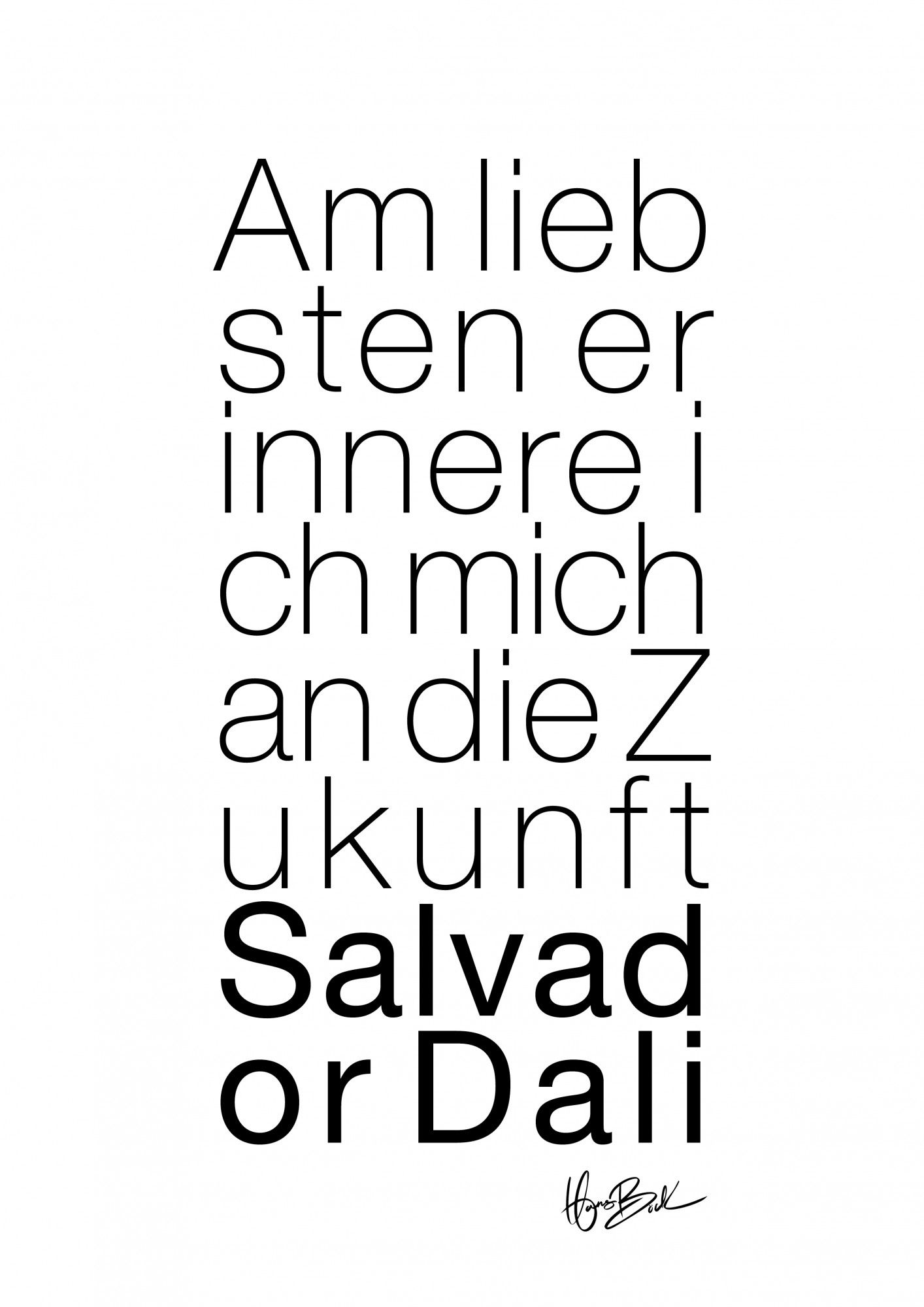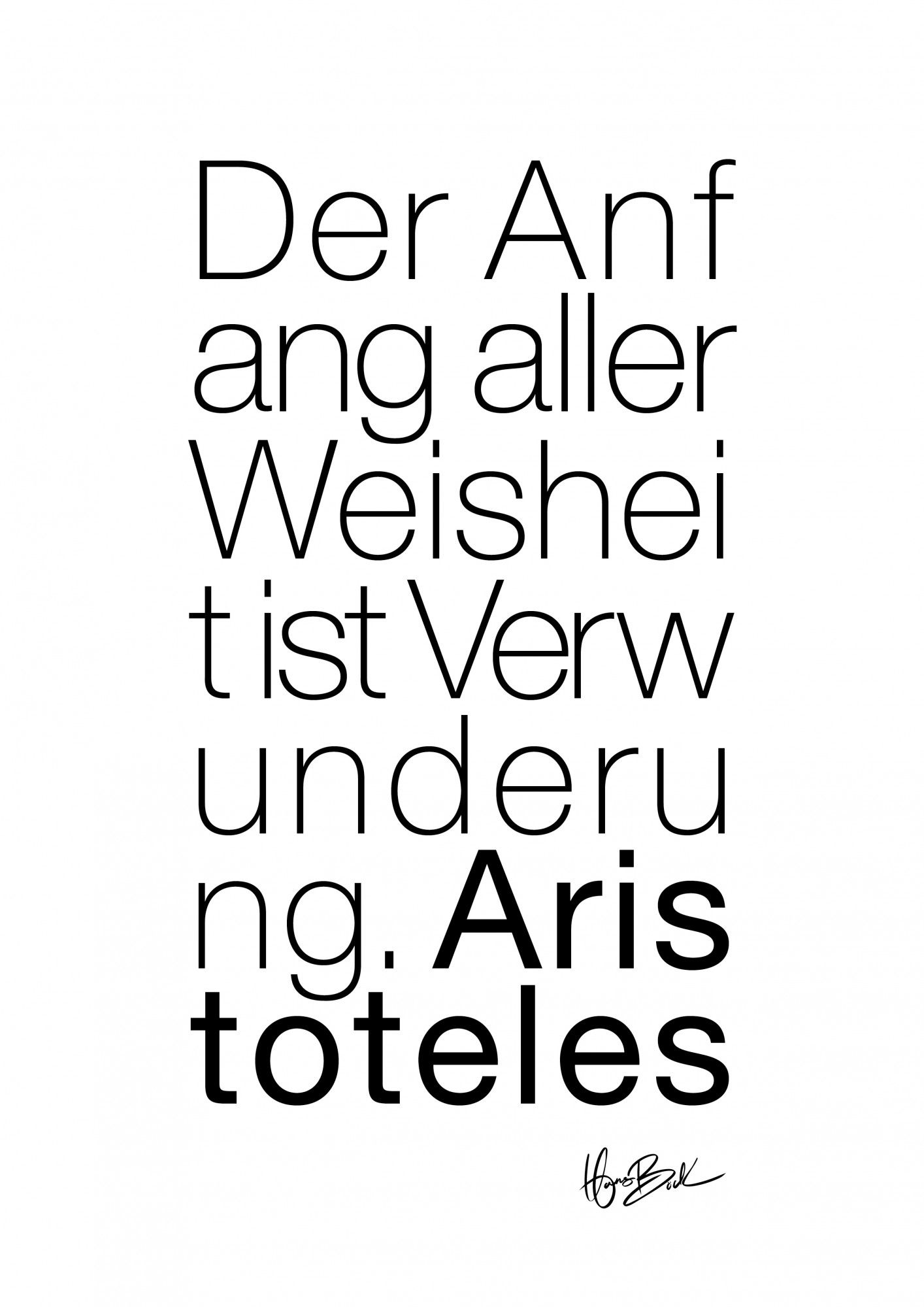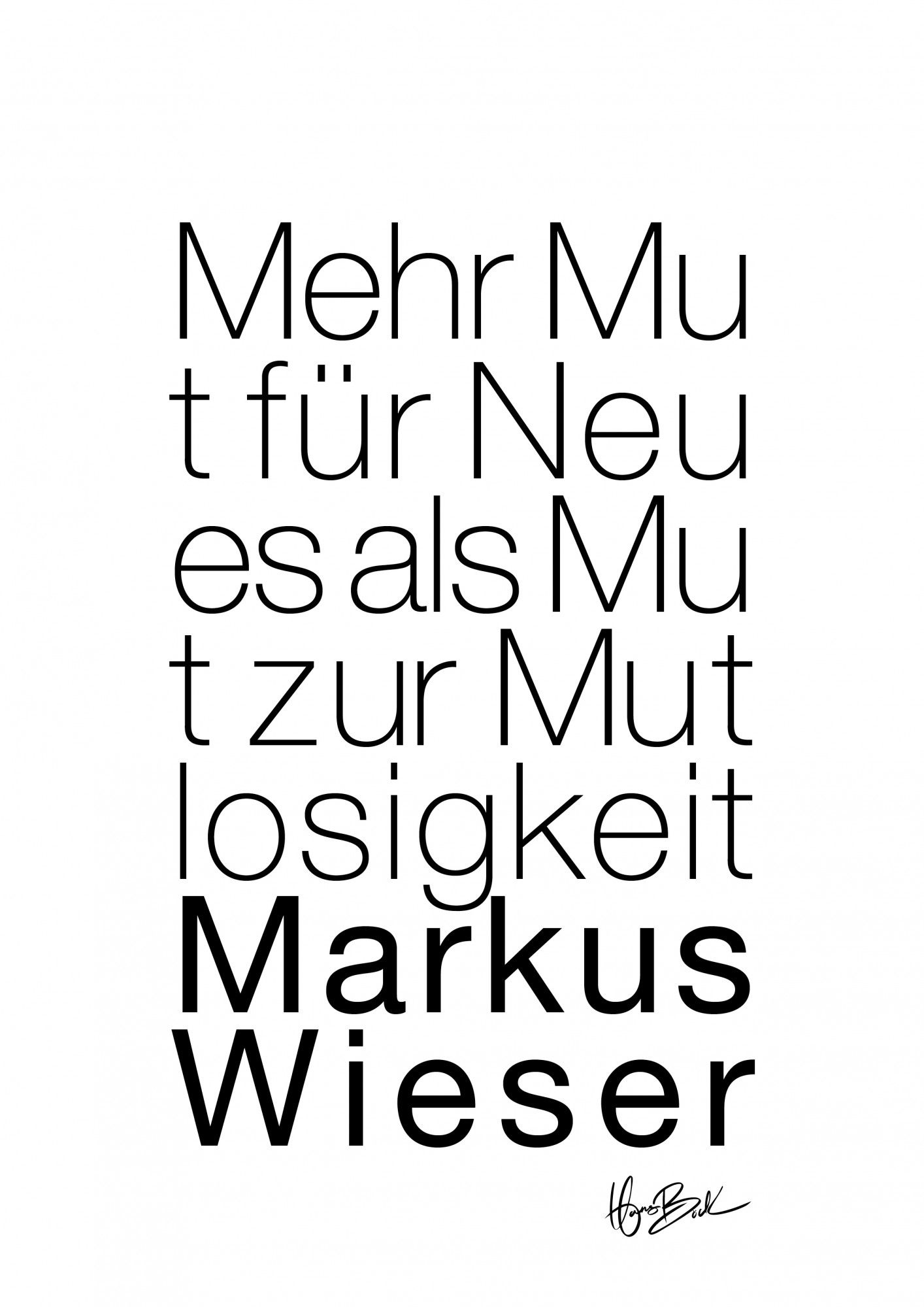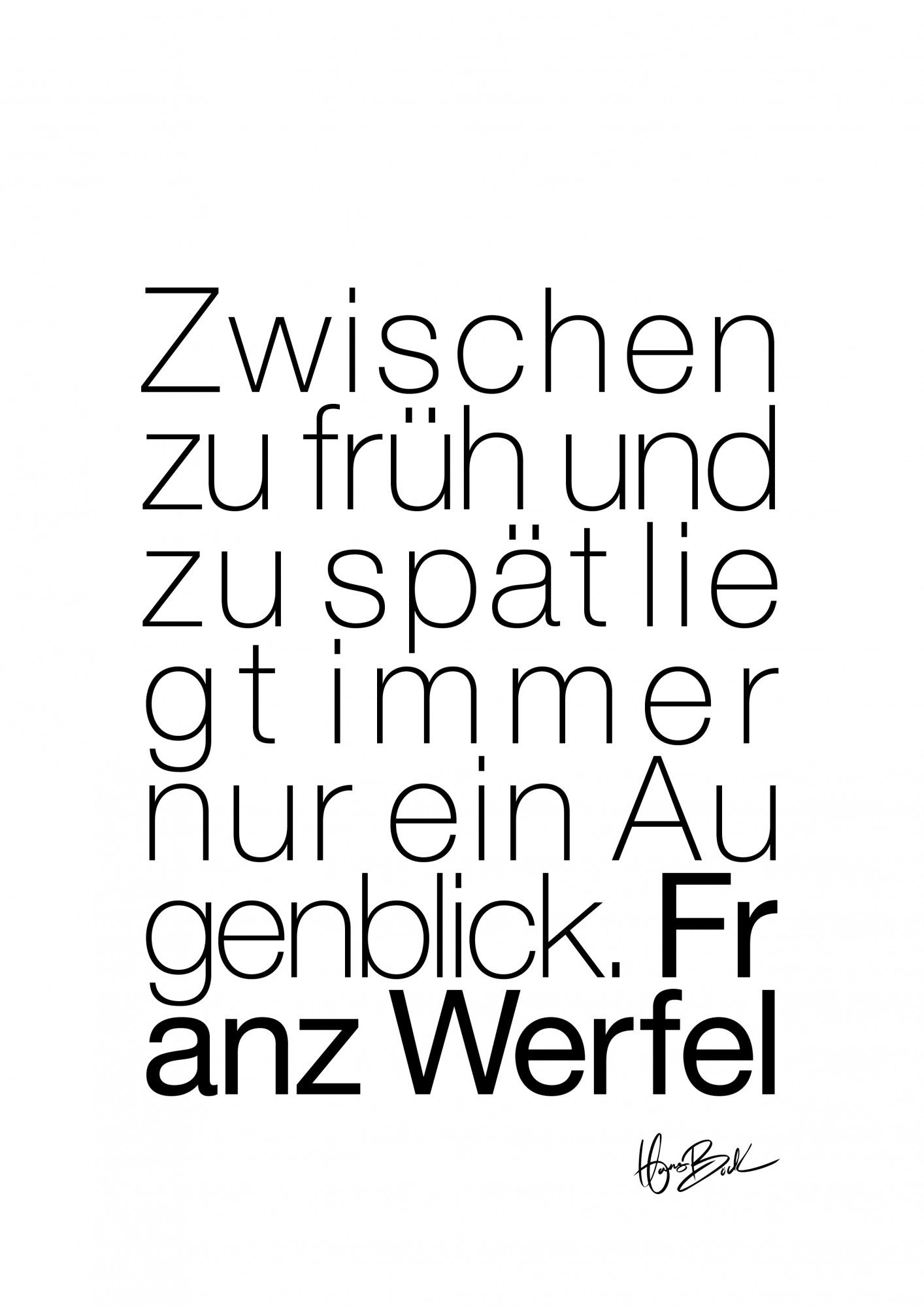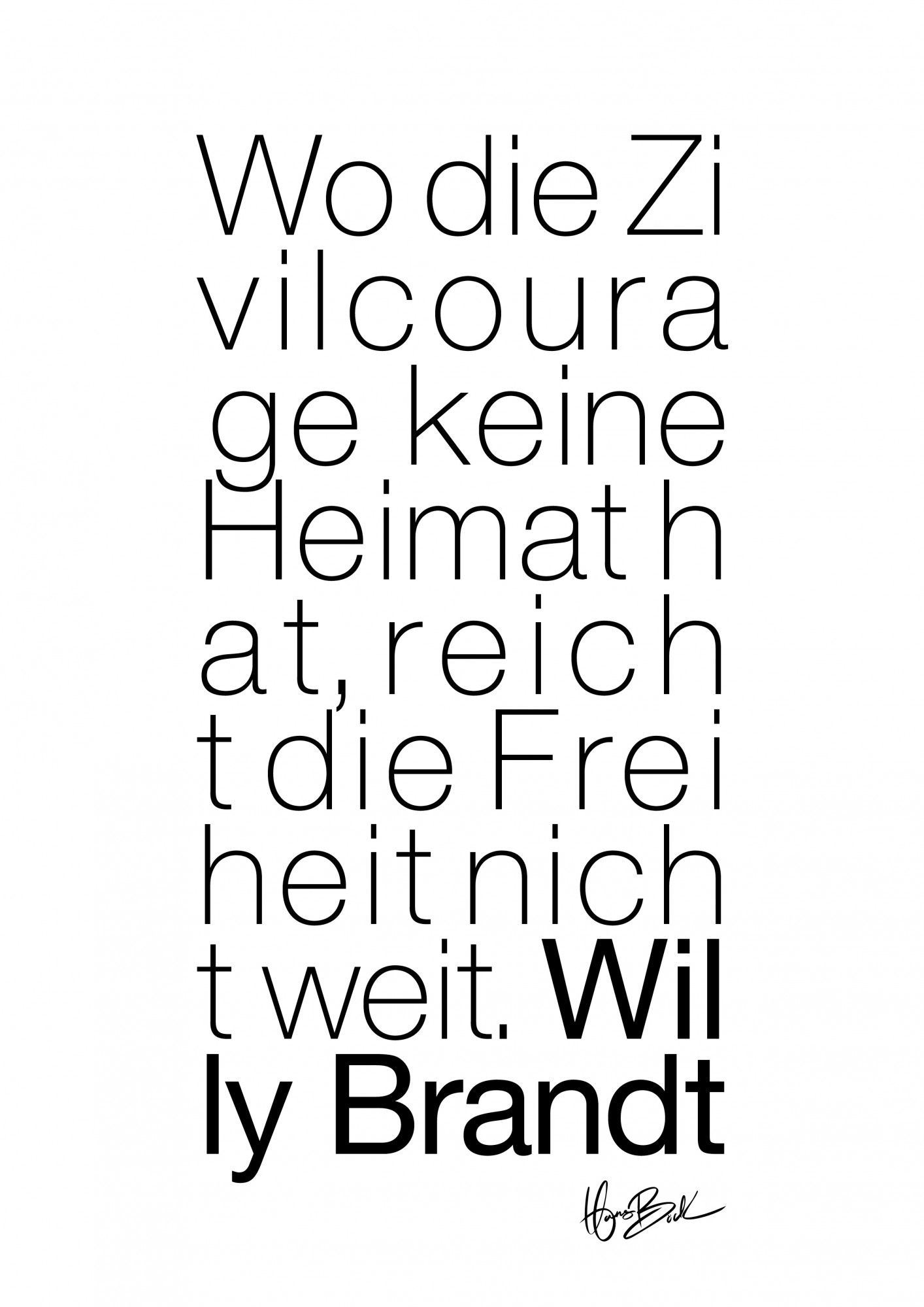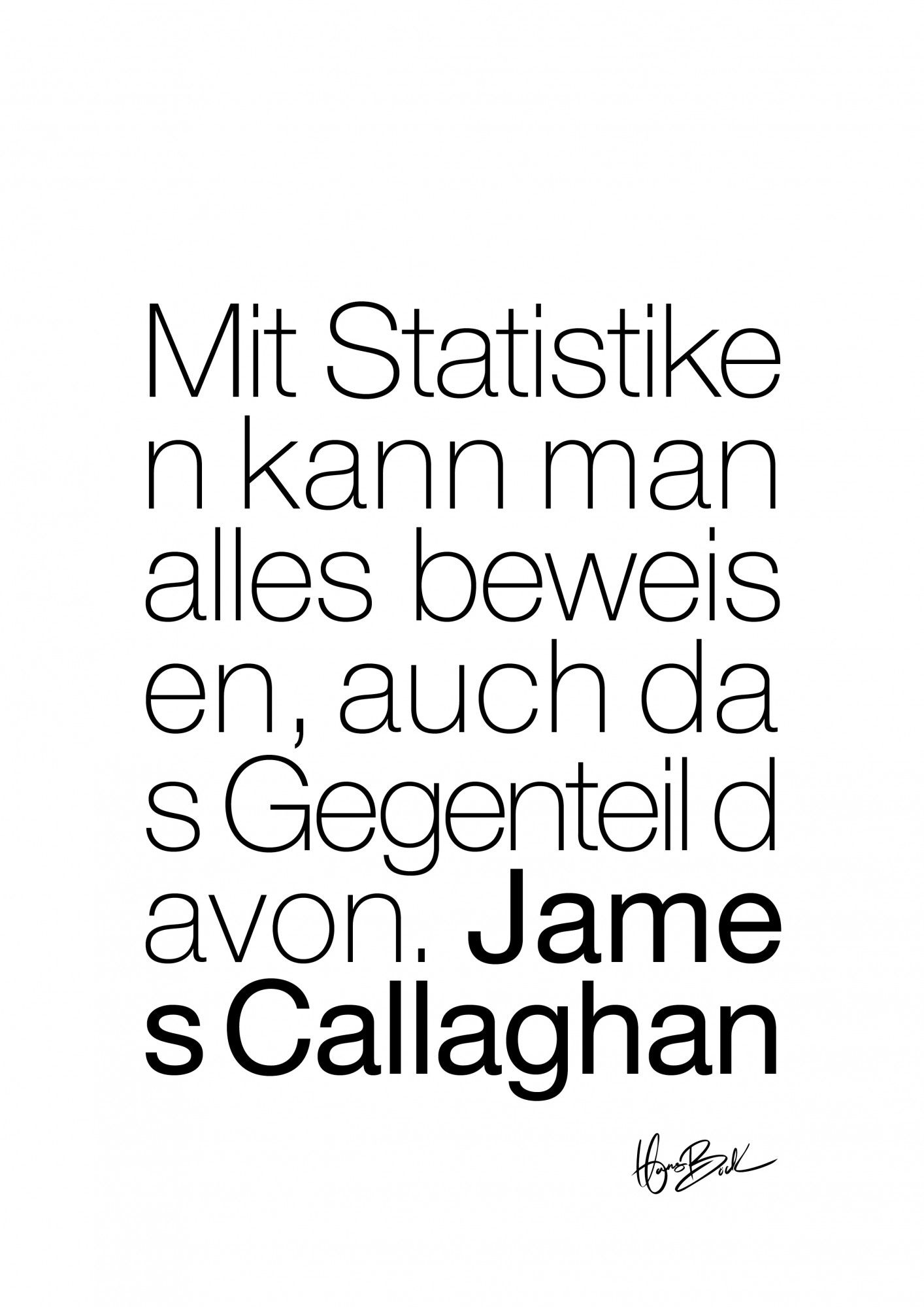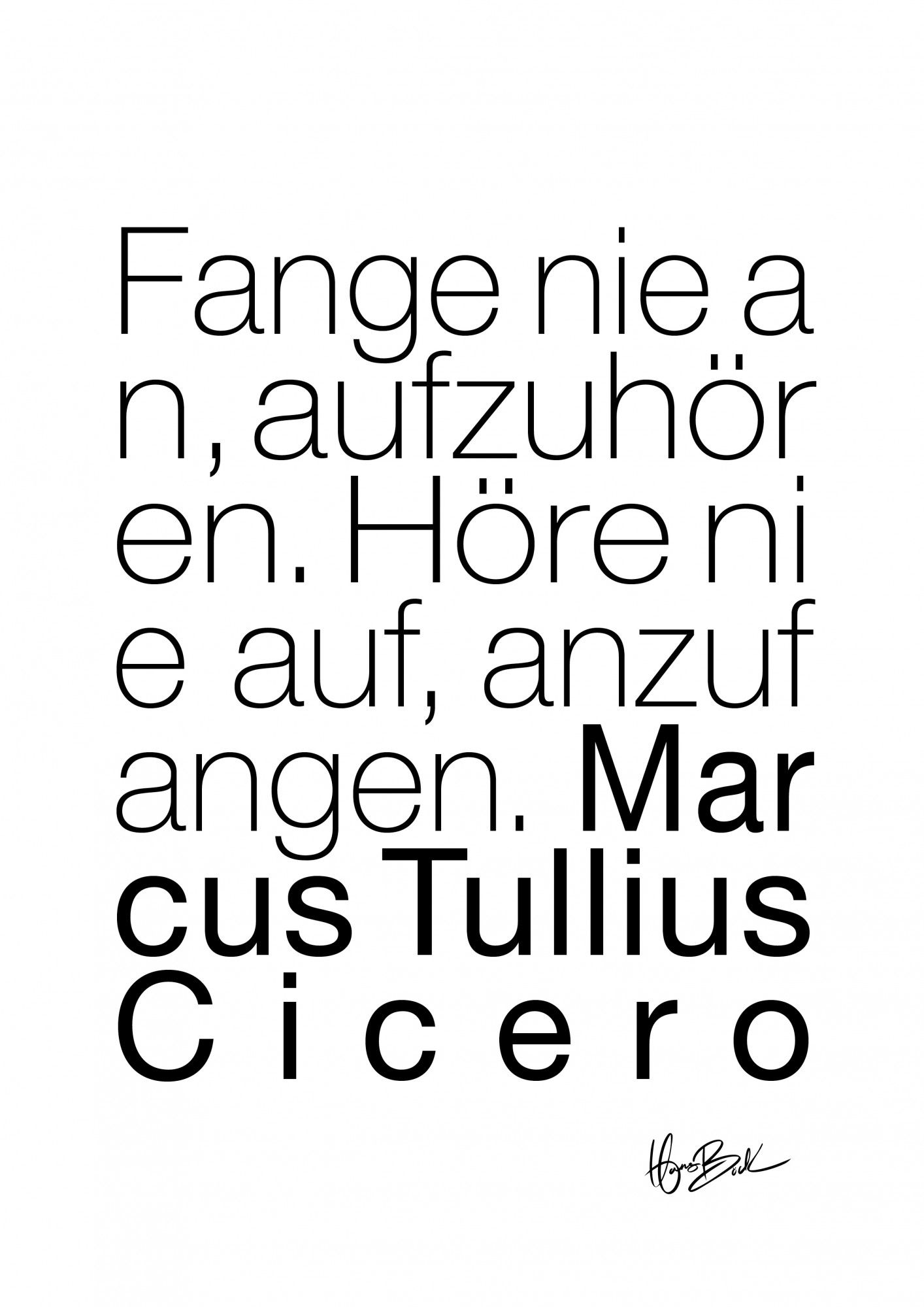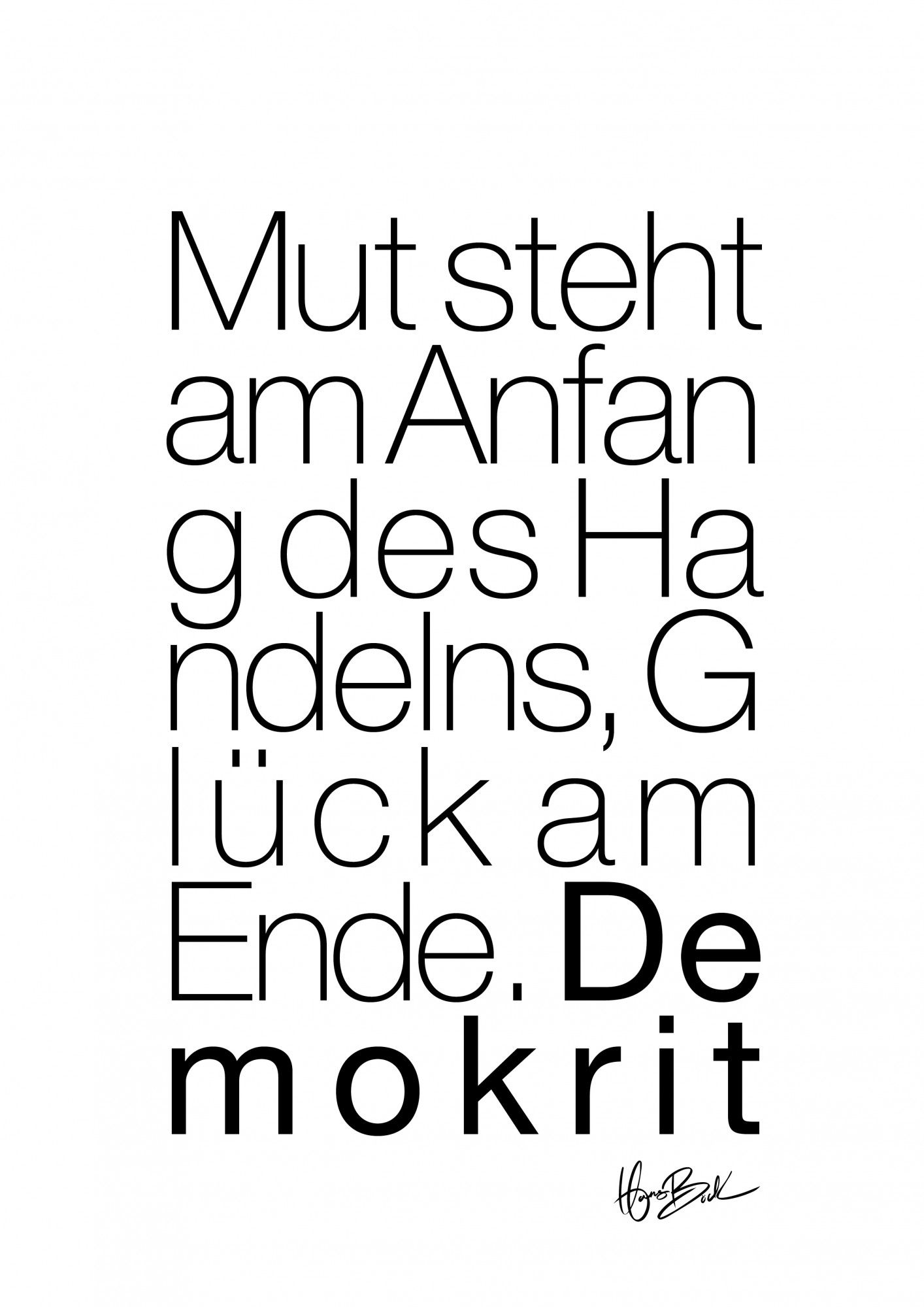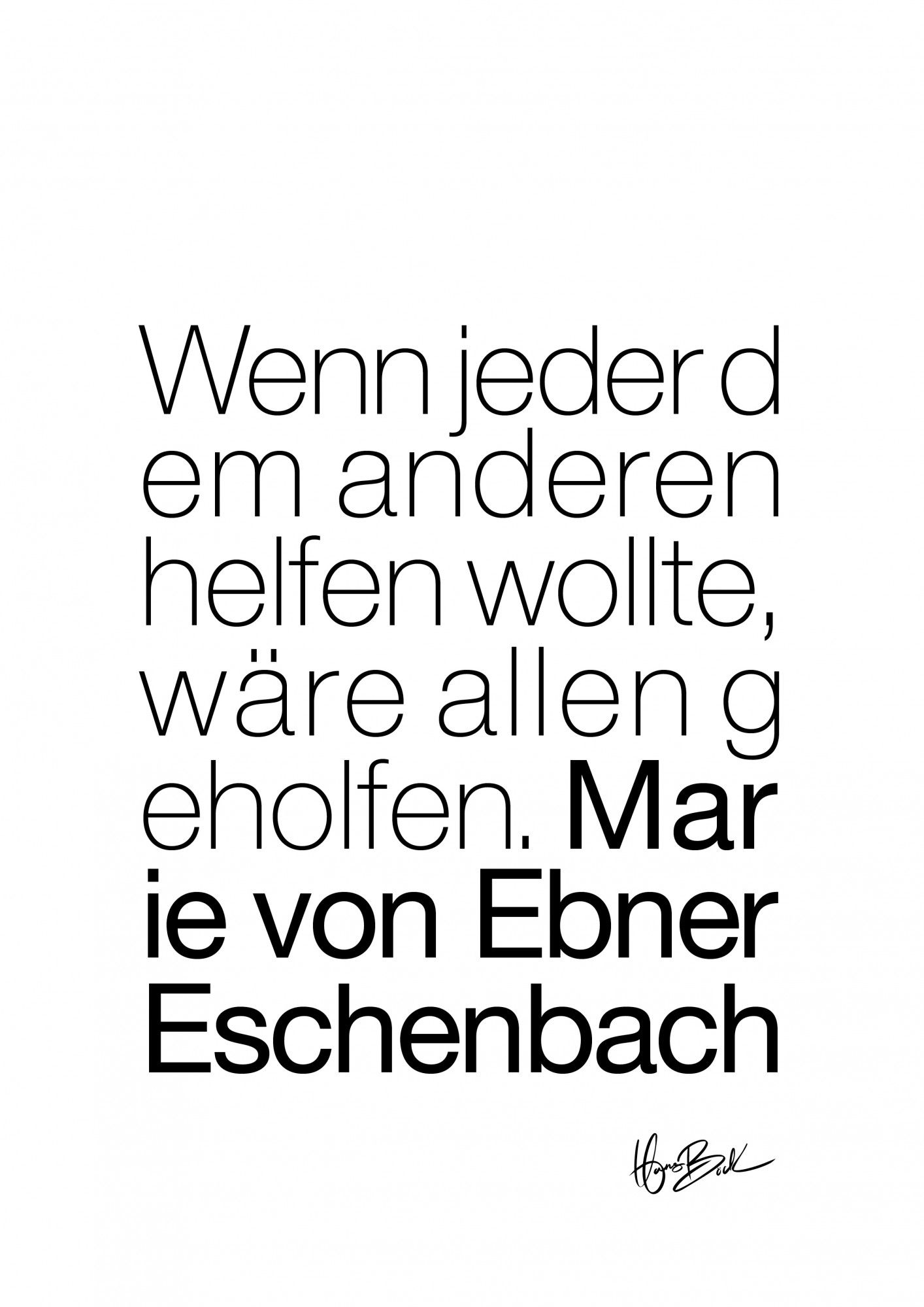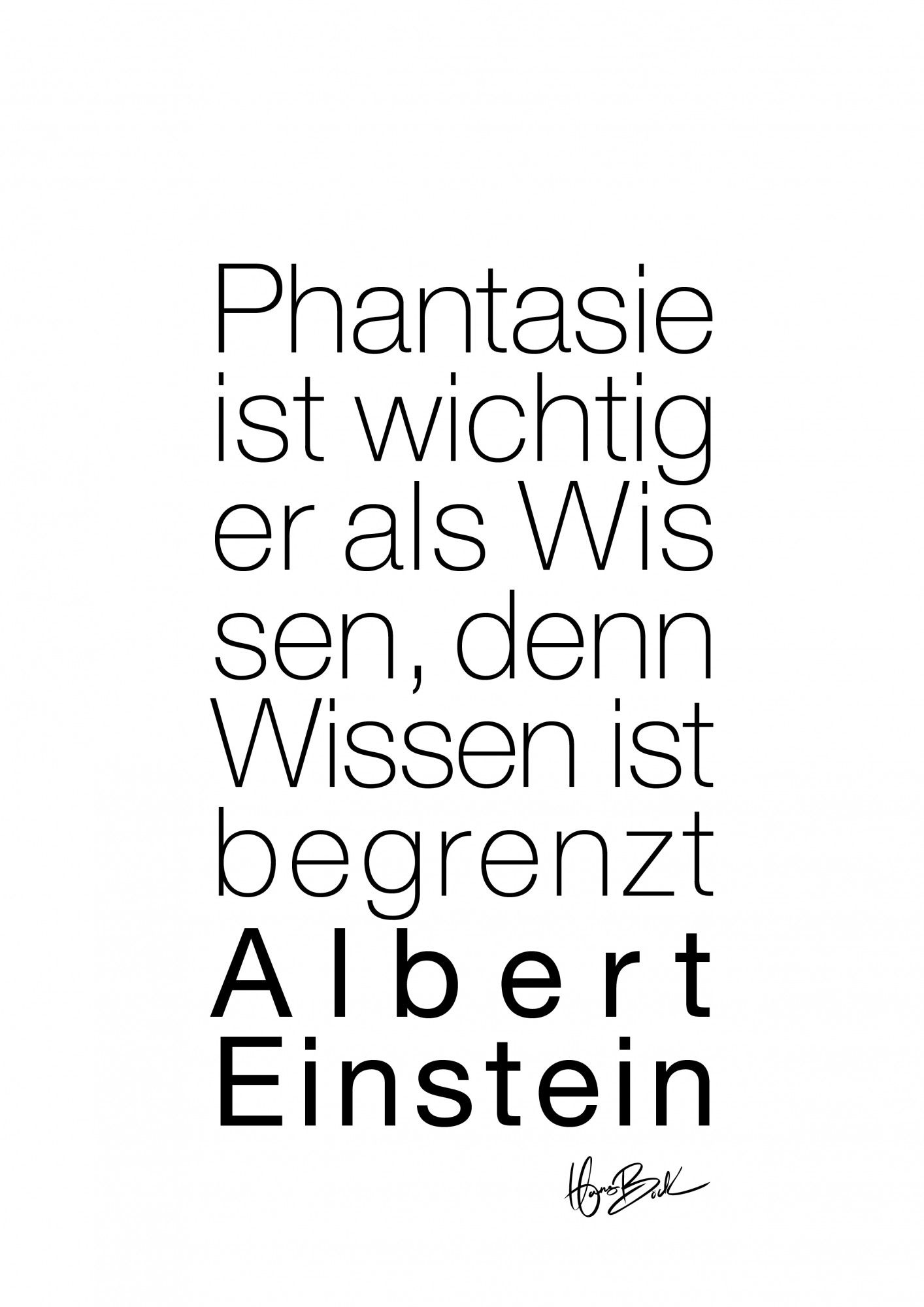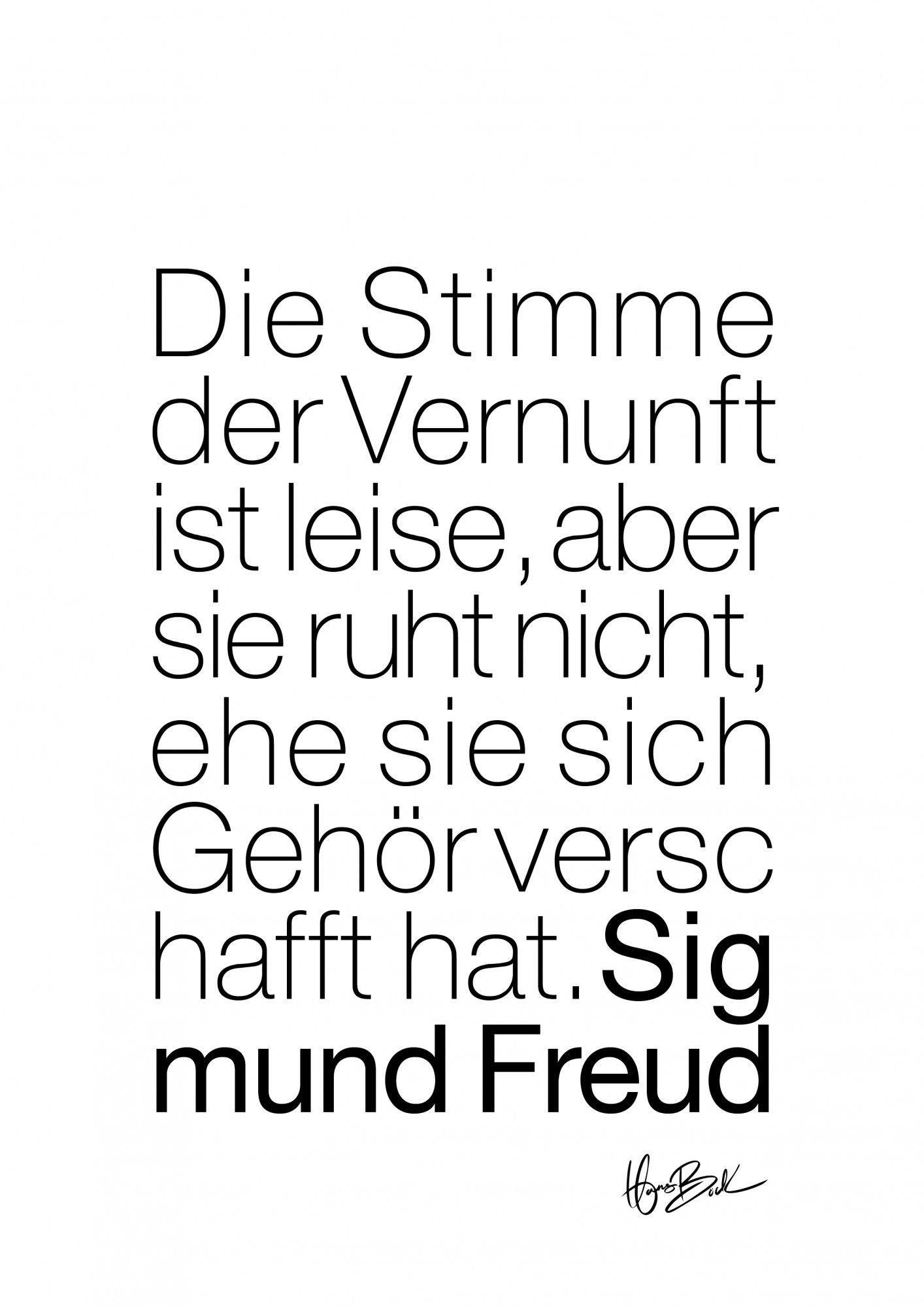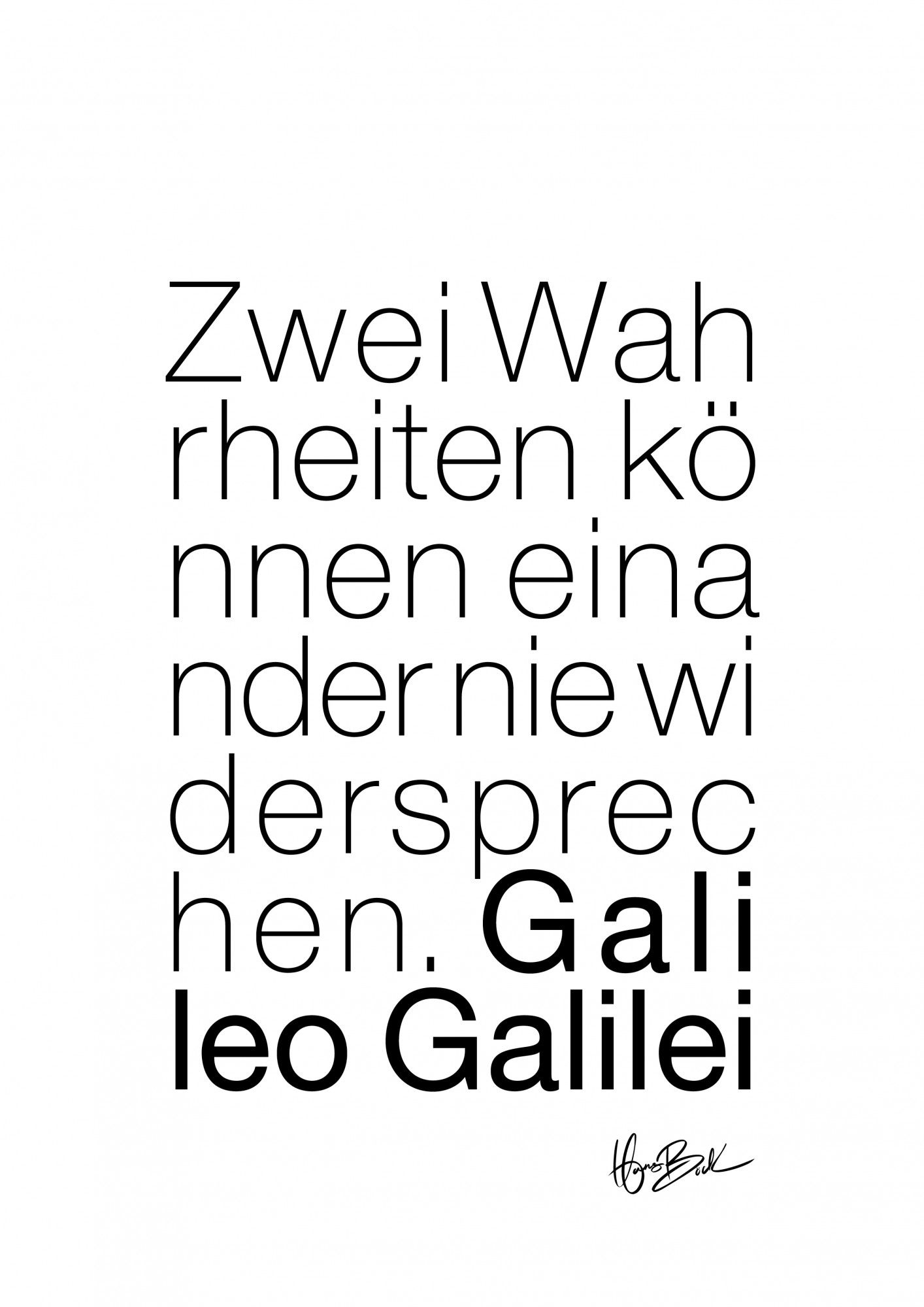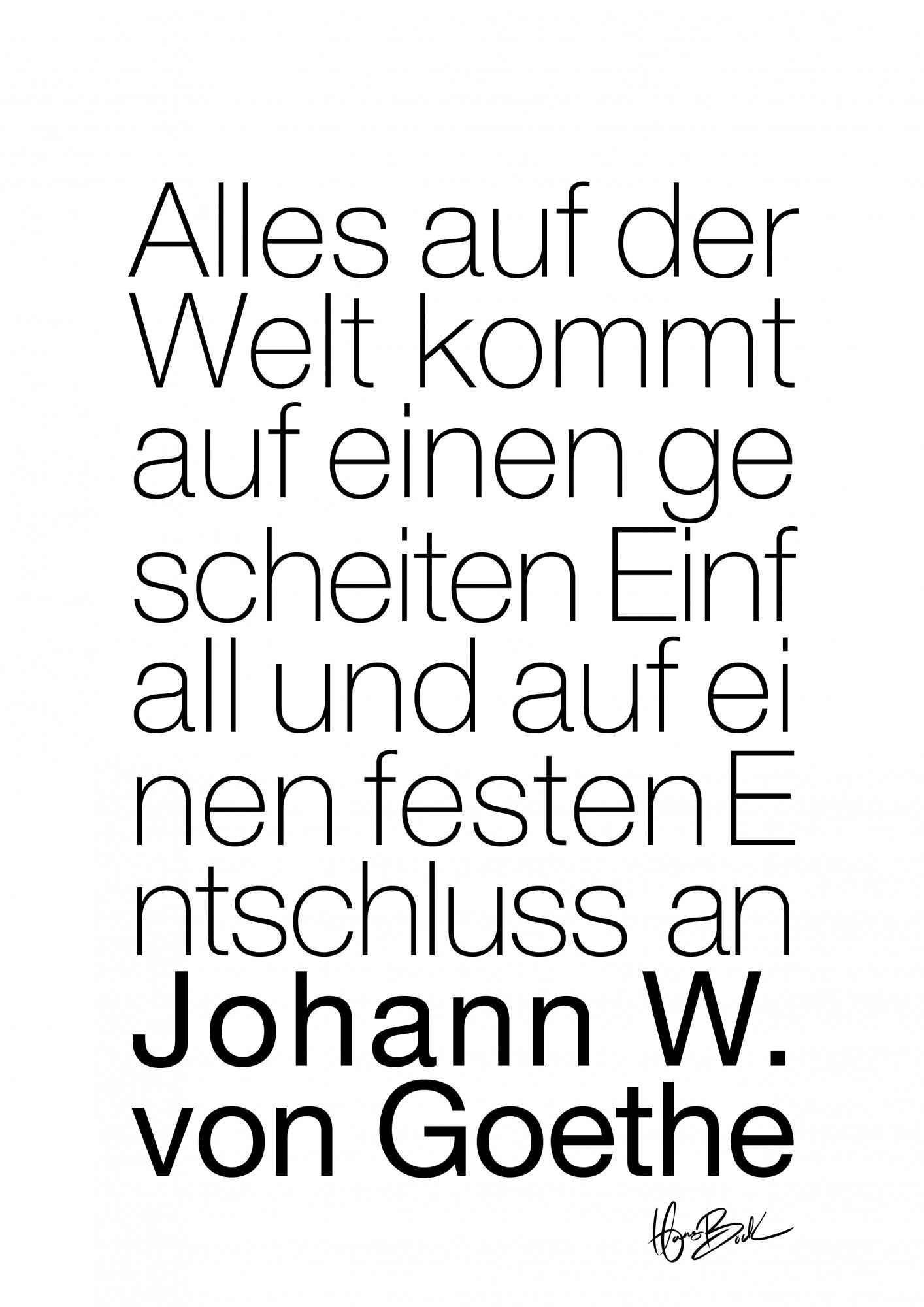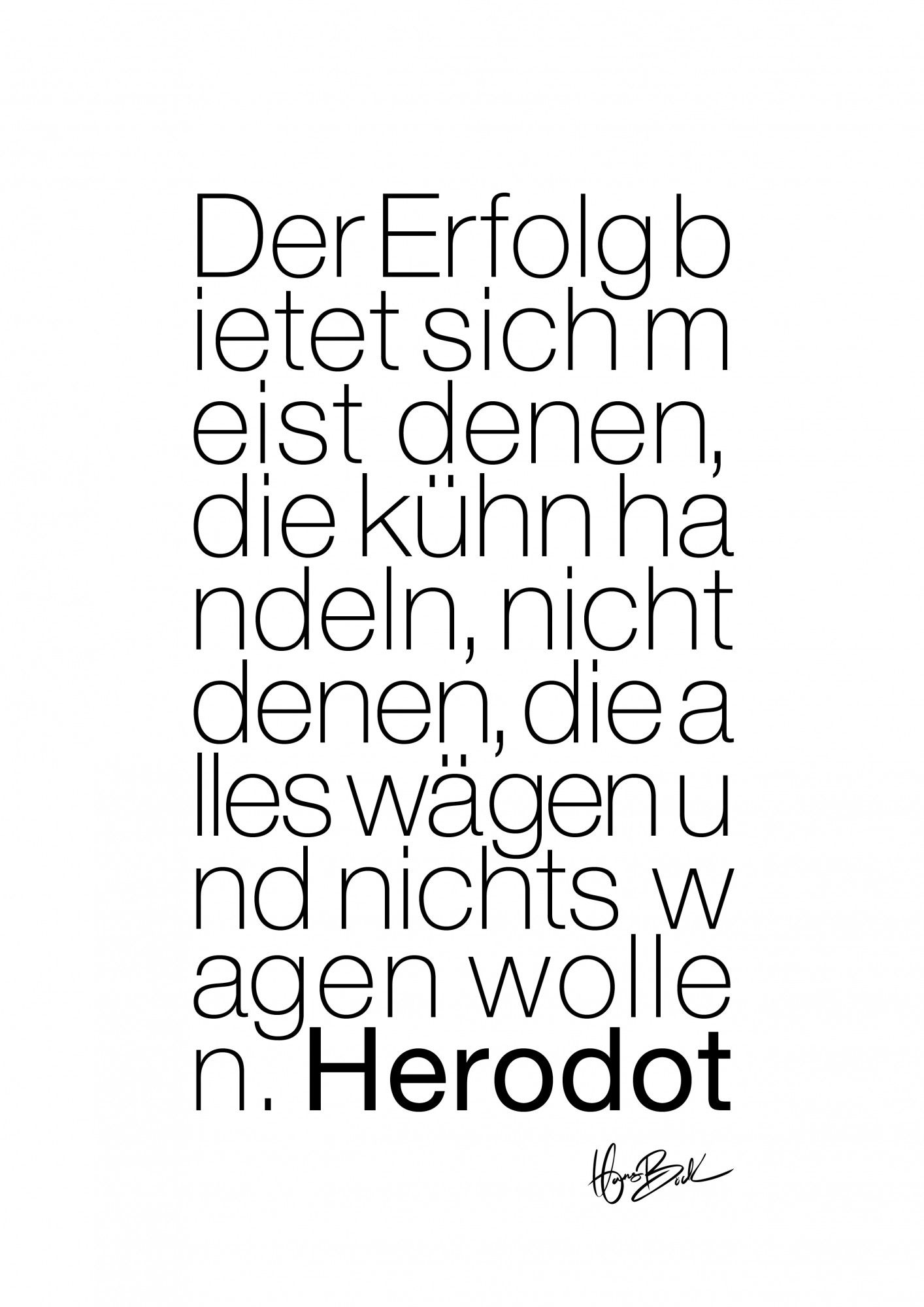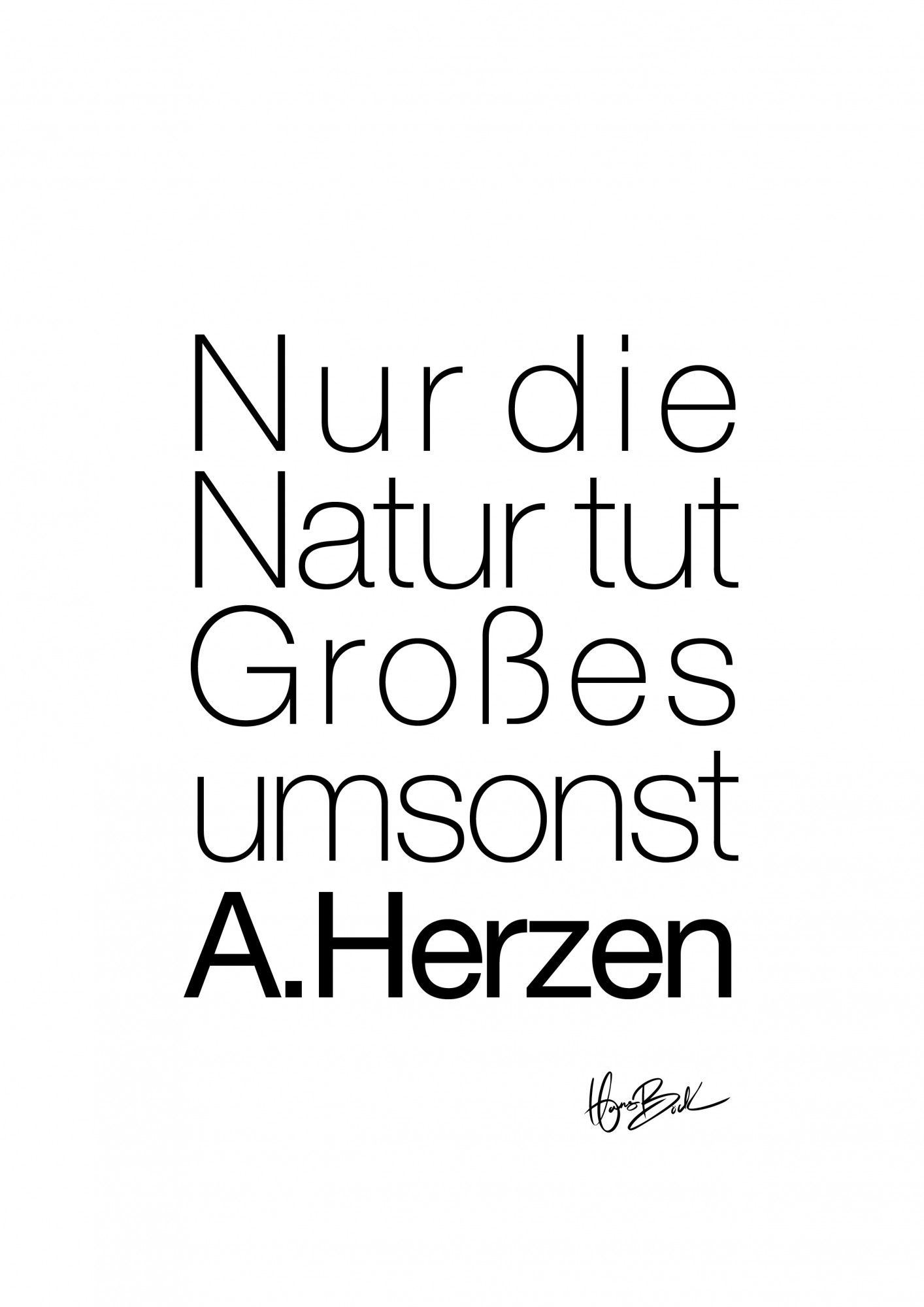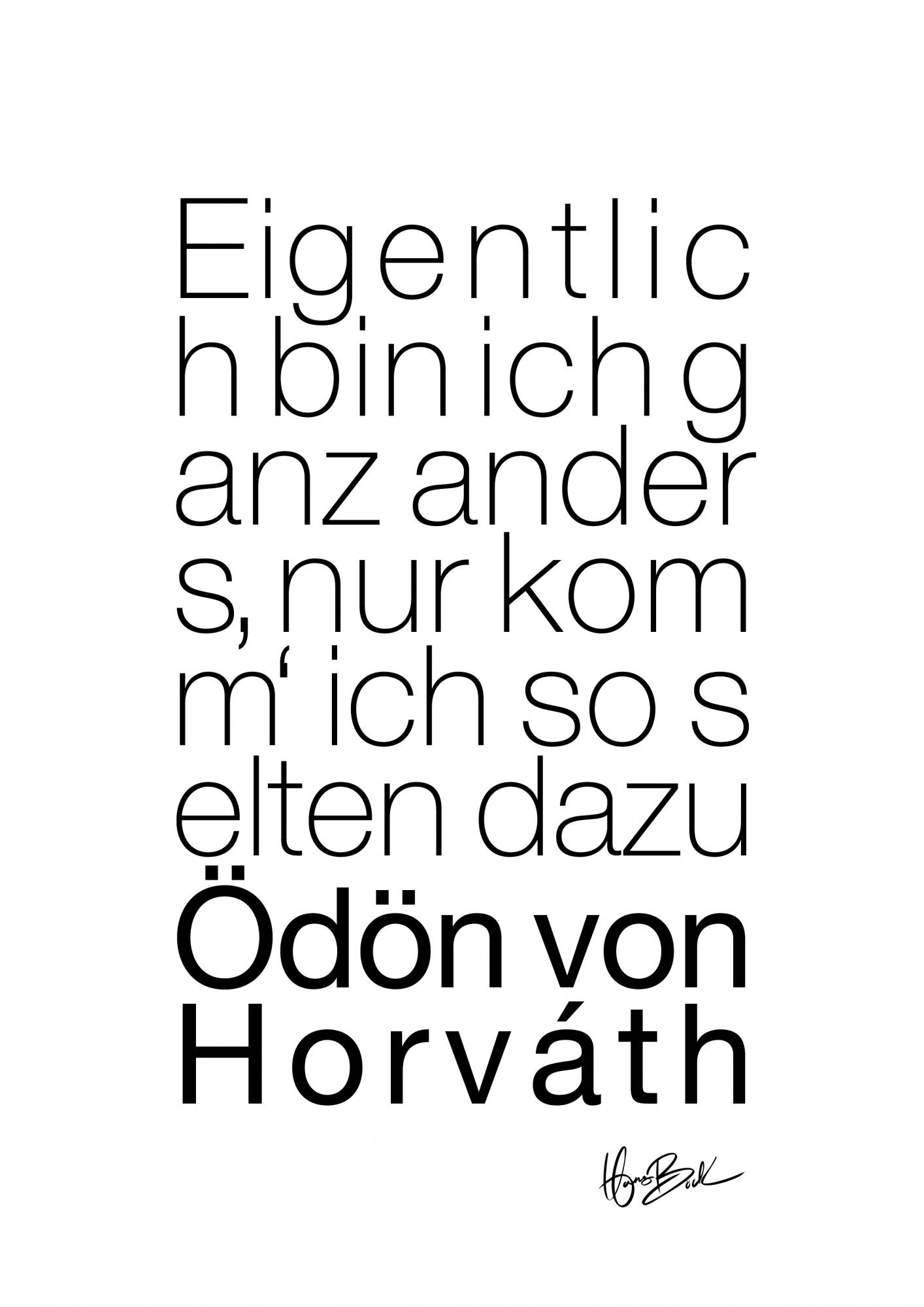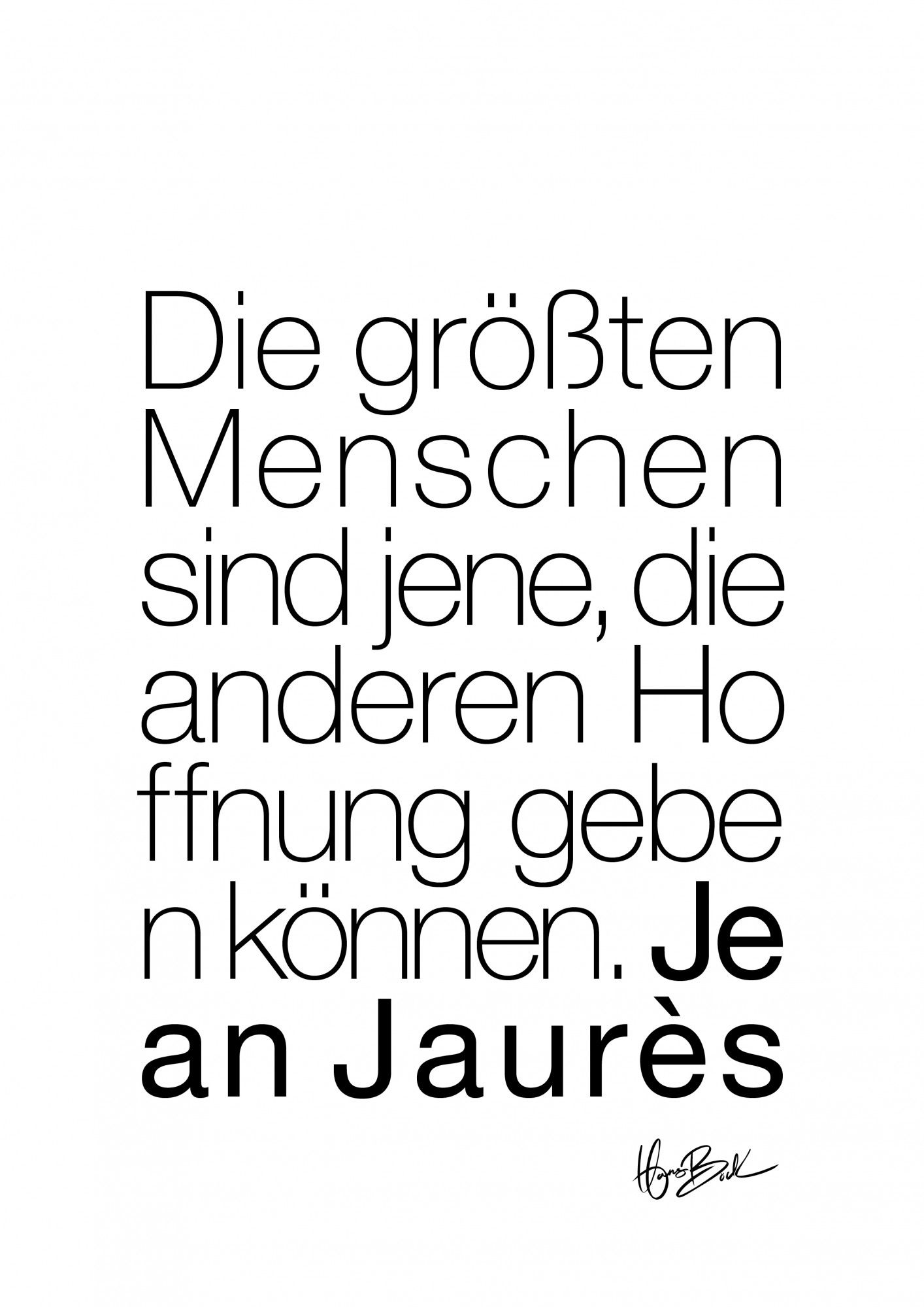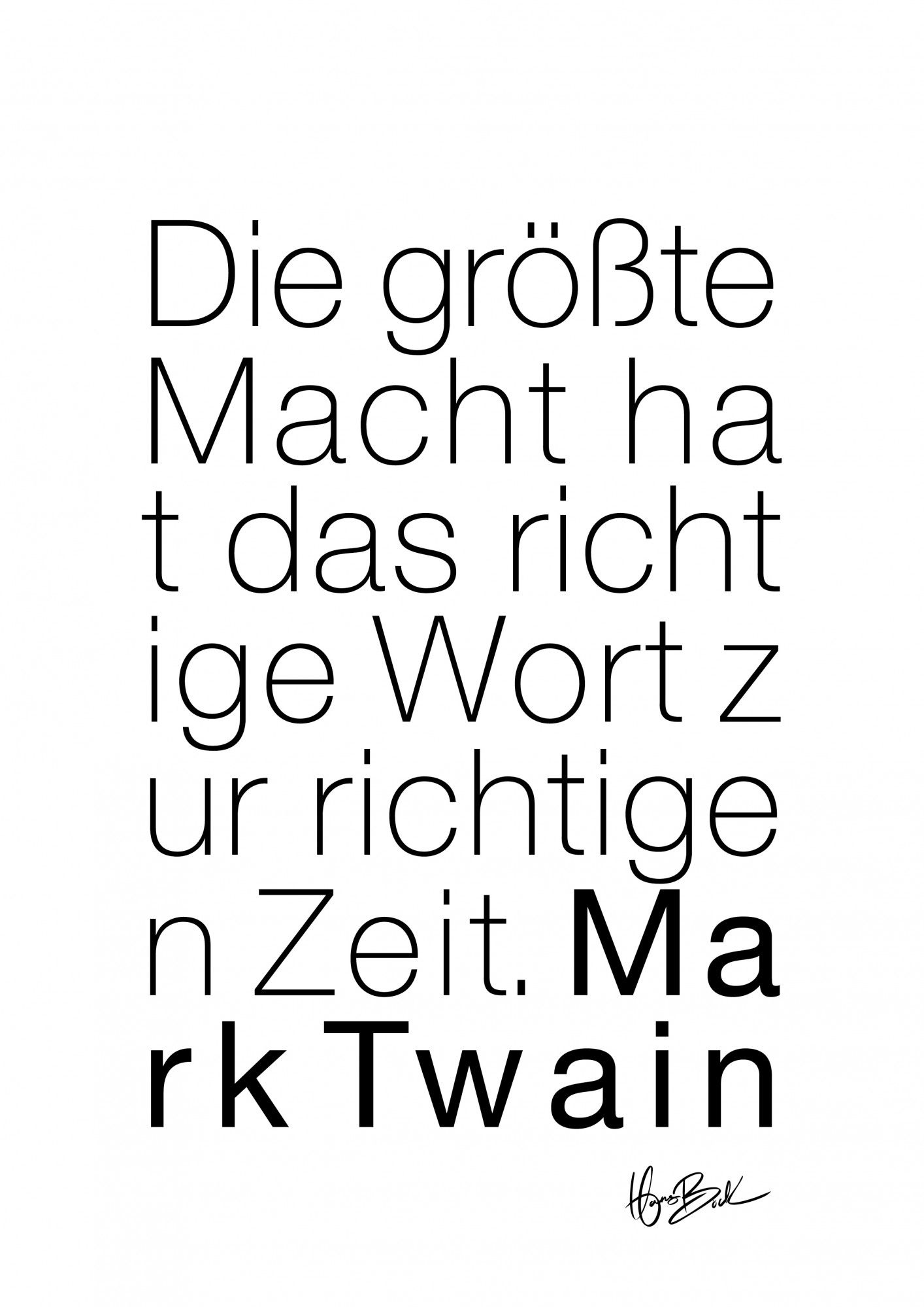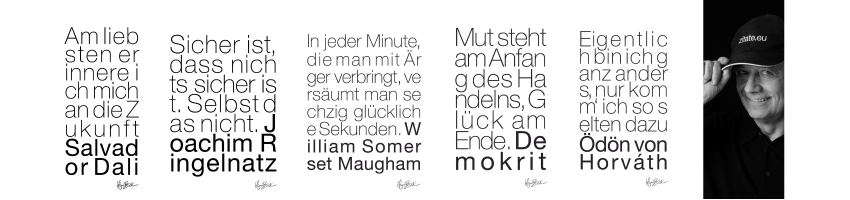Zitate zu "Stolz"
-
Joachim Gauck
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit dieser Anrede gebe ich die Begrüßungsformel an Sie zurück, Herr Bürgermeister. Sie haben gemeint, stolz und glücklich sein zu sollen, weil ich Sie besuche. Nein, es ist anders. Ich bin stolz und glücklich, dass es Sie gibt, Sie und Ihre Bürgerinnen und Bürger. // Ich bin hierher gekommen, weil ich einmal exemplarisch in der Nähe von gelösten und ungelösten Problemen sein möchte. Wir alle in Deutschland, ob wir Wähler oder Gewählte sind, wir alle wissen: Wir stehen vor schweren Herausforderungen, und landauf, landab wird nun gerätselt - hoffentlich auch geplant und nicht nur gerätselt und geklagt -, was zu tun ist. Und das Erste, was ich nicht nur Ihnen, sondern allen Deutschen sagen möchte, ist: Zu einer Zeit von Herausforderungen gehören Debatten und Kontroversen, aber sie gehören in die Mitte der Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass auf der einen Seite die guten Menschen mit den weiten Herzen stehen und auf der anderen Seite die Engherzigen. Die einen dürfen jammern und klagen, und die anderen dürfen schaffen und umsorgen und sich freuen, dass wir so solidarisch sind. So wird das alles nicht funktionieren. // Sie haben sich ja an die Landesregierung gewandt, an die Bundesregierung, manchmal wenden Sie sich auch an die Gebietskörperschaft, und Sie bitten um Verständnis oder um Solidarität und um Hilfe. Wir müssen begreifen, dass wir beides tun können. Wir können solidarisch handeln und gleichzeitig eine Problemanalyse betreiben und Sorgen und Besorgnisse benennen. Wenn wir in der Mitte der Handelnden und der Solidarischen aufhören, die Probleme zu besprechen, die unsere Mitbürger betreffen, dann werden am rechten Rand genug Verführer und Nutznießer sein, die sich dieser Probleme bemächtigen und so tun, als wären sie die Einzigen, die darüber sprechen. So darf das natürlich nicht sein. Und darum müssen wir in der Mitte der Gesellschaft auch ertragen, dass es gesellschaftliche Debatten und manchmal auch Streit gibt. So ist das in der Demokratie. Die offene Gesellschaft kommt ohne diese Form der Kommunikation gar nicht aus. Und dann dürfen auch Abgeordnete mal unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist auch noch normal. Und wir, in den Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, die vor der Situation stehen, dass die Turnhalle ihrer Kinder gerade belegt ist oder dass eine benachbarte Liegenschaft genutzt wird in einer Weise, wie es nicht geplant war, die dürfen das Maul aufmachen. Die dürfen sagen "Bürgermeister, was machst du gerade mit uns?" Und der Bürgermeister ist gut beraten, wenn er rechtzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, was er zu tun gedenkt. Und dann kann er die Bürgerinnen und Bürger auch fragen: "Ja, was soll ich denn sonst machen? Soll ich die Leute unter Brücken schlafen lassen oder am Fluss oder an der Landstraße liegen lassen?" Und dann wird er hören, was für Antworten er bekommt. // Und deshalb bin ich froh darüber, dass ich in einer Stadt bin, wo es eine ganz herausragende Qualität von Engagement gibt, in der es so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt, in den Vereinen, in den Verbänden, unseren Hilfsorganisationen, einfach überall. Ob es die freiwillige Feuerwehr, die Polizei oder welche Organisation auch immer ist. Diese Unmenge von freiwilligen Helfern, die überall im ganzen Land sind. Ich bin dankbar und glücklich, dass dieses Land sich so selbst erkennt in seinen Potentialen, in seiner Fähigkeit, nicht wegzuschauen, sondern hinzusehen und helfen zu wollen. Wunderbar. Wir haben es so nicht erwartet. Wir könnten unser Land, wenn es eine Person wäre, so ansprechen: "Du, das hätte ich von dir nicht erwartet. Das gefällt mir." Und indem wir unser Land so ansprechen, erkennen wir uns auch in unseren Potentialen, in unseren Möglichkeiten. Und jetzt kommt noch etwas hinzu: So wie Sportler, die Höchstleistungen erbringen, oder Musiker, die wunderbare Werke schaffen, so erkennen wir uns oft erst dann, wenn wir an die Grenzen des uns Möglichen gehen. Wenn wir in uns Fähigkeiten entdecken, von denen wir vorher nicht geglaubt hätten, dass wir sie haben. Und deshalb habe ich eben gesagt, wenn unser Land eine Person wäre, würde ich sagen: "Gut gemacht". // Bei diesem "gut gemacht", das will ich jetzt auch mal mit aller Deutlichkeit sagen, damit meine ich auch alle diejenigen, die beamtet, die angestellt sind, nicht nur die Ehrenamtlichen, die haben wir jetzt in den letzten Wochen dauernd gelobt. Ich will heute auch einmal diejenigen loben, die Überstunden machen, die, wie ich es heute von Ihrem Bürgermeister gehört habe, nachts um drei senkrecht im Bett stehen, um sich Gedanken zu machen und zu fragen: "Wo bringe ich die Leute unter?" Ich hoffe, er macht es nicht jede Nacht, dann haben Sie ihn nicht mehr lange. Aber dieses Bild eines engagierten Mitarbeiters, eines engagierten Bürgermeisters, eines engagierten Abteilungs- oder Referatsleiters, einer engagierten Mitarbeiterin am Computer - für alle die, die bei uns im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sind das ja auch großartige Zeiten. Und für sie gilt, was ich eben für das ganze Land gesagt habe. Sie lernen sich neu kennen mit ihrer Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und großartig zu sein. Das stärkt sie. // Und warum brauchen wir diese Stärke? Weil sich um uns herum an den Rändern eine Angstkultur entwickelt, die bedrohlich ist. Ängste sind oft etwas anderes als eine Problemanalyse. Sie sind diffus. Es werden Vermutungen geäußert, es werden Stereotypen bedient. Das ist gefährlich. Es werden Horrorszenarien für die Zukunft entwickelt. Und diese Horrorszenarien und diese negativen Stereotypen, sie haben alle eins gemeinsam: Sie entmächtigen uns, sie suggerieren uns, wir seien nicht im Stande, den Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu entsprechen. // Aber, meine Damen und Herren, wir sind die, die wir geworden sind. Wir sind aus einer Nation, die zutiefst danieder lag, moralisch diskreditiert war, zu einer Nation geworden, die sich selber etwas zutraut. Wir sind die, die sich etwas zutrauen. Und indem wir uns das bewusst machen, fürchten wir uns auch nicht mehr vor einer Problemdebatte in der Mitte unserer Gesellschaft. Ich wiederhole mich da, aber das tue ich ganz bewusst, weil ich diese Aufteilung der Gesellschaft in diejenigen, die gutwillig und gutmütig und aufnahmebereit und aktiv sind, und diejenigen, die böswillig und fremdenfeindlich sind, die akzeptiere ich nicht. Ich weiß, dass es böswillige und fremdenfeindliche Menschen gibt, ich finde sie unerträglich. Auch wie sie mit den Ängsten von Menschen manipulieren, um sich selber Einfluss zuzueignen, der ihnen gar nicht zukommt. Das weiß ich. Aber so wenig wie wir diesen Angstmachern die Zukunft unseres Landes überlassen, ja, auch nur eine Rolle bei dieser Zukunft des Landes maßgeblich mitzuwirken, so wenig überlassen wir ihnen die Deutungshoheit über unsere Probleme, auch über unsere ungelösten Probleme. // Und deshalb meine Bitte an Sie und an alle anderen, die sich in der Mitte der Gesellschaft Sorgen machen, ob wir das schaffen: Reden Sie mit Ihrem Bürgermeister. Reden Sie mit Ihren Abgeordneten. Behalten Sie Ihre Befürchtungen nicht für sich. Konfrontieren Sie Ihre Abgeordneten und Minister mit Ihrer Problemanalyse und erwarten Sie von den Politikern, dass sie Handlungsfähigkeit zeigen. Die versuchen es doch. Aber was ihnen zurzeit schwer gelingt, ist Planungssicherheit herzustellen. Ja, wie auch? Wissen wir denn, wie viele Flüchtlinge übermorgen zu uns kommen? Wir wissen es nicht. Und darum brauchen unsere politischen Akteure neben unserer Fähigkeit zur Kritik, neben unseren Anregungen, auch ein gewisses Maß an Verständnis. Ich gehe mal davon aus, meine Damen und Herren, dass die wenigsten von Ihnen es besser machen könnten als Ihre Ministerpräsidentin und die Bundeskanzlerin. Es mag ja sein, dass sich der eine oder andere hier befindet, der fest davon überzeugt ist. Ich nehme dann einen Zettel und schreibe mir Ihre Namen auf. Ja? // Also es gibt Gründe, das haben wir vom Bürgermeister gehört. Es gibt Gründe, dass wir manchmal die Regierung fragen: "Ja, wieso so und nicht anders? Ich habe viel bessere Ideen". Wunderbar wenn es so ist. Und wunderbar, wenn Sie aus der Mitte der Gesellschaft, aus dem Kreis der Engagierten, dieser positiven Netzwerke heraus diese Frage stellen. Das ist eine lebendige, offene Gesellschaft, die solche Debatten nicht fürchtet. Wir haben es nicht nötig, uns vor dem, was uns als ungeklärtes Problem noch vor den Füßen liegt, weg zu laufen. Menschen, die sich bewährt haben, indem sie Solidarität als eine Lebensform der Gesellschaft entwickelt haben, die laufen nicht einfach weg wegen diffuser Ängste. Ein gutes Beispiel ist dieser Bürgermeister oder viele andere Aktive. Wir können ihm gut zuhören, wenn er die Regierung kritisiert, weil wir an ihm genau merken, er steht nicht irgendwo im Abseits und meckert nur an den gesellschaftlichen Verhältnissen herum. Sondern er beteiligt sich intensiv, bringt seine Gaben ein, und dann hat er jedes Recht der Welt, mit all denen, die über ihm sind, auch kritisch zu sprechen und ihnen kritische Fragen zu stellen. // Jetzt haben wir uns, denke ich, miteinander verständigt. Ja, ich spüre das. Ich weiß, ich habe vorhin schon ein paar Leute getroffen, so eine kleine Blütenlese hier aus Ihrer Gesellschaft. Und ich habe gespürt, ich bin in einem Stück Europa, von dem ich einmal geträumt habe. Ich bin unter Menschen, die sich selber anschauen, und sich fragen: Was kann ich eigentlich tun, um diesen Raum, in dem ich lebe, zu einem lebenswerten und schönen zu machen, zu einem gastfreundlichen? Und ich will die Gelegenheit nutzen, ein herzliches, bürgerschaftliches wie präsidiales Dankeschön zu sagen: all den Lehrerinnen und Lehrern, den Pfarrern und Pfarrerinnen in den Kirchgemeinden, in Diakonien. All den Menschen, die sich sorgen um unser Miteinander, die es gestalten, auch den Menschen, die jungen Leuten in den Sportvereinen beibringen, was Fairness ist und was Regeln sind, all denen, die in irgendeiner Weise aktiv sind. Es ist gut, dass ich Sie erlebe, es ist gut, dass ich dieses Land so erlebe. Und weil ich Sie so erlebe, weiß ich, dass die Probleme, die mit Sicherheit auf uns zukommen, und angesichts derer wir auch mit Sicherheit noch nicht alle Lösungswege wissen, dass diese Probleme uns nicht überwältigen werden. Wir sind die, die sich verpflichtet haben zu stehen und nicht zu fliehen. Und wir haben das Gefühl, genauso soll unser Leben sein. So möchten wir es, auch wenn wir an einen fremden Ort kämen: dass es dort Menschen geben möge, die diese Gesinnung haben. // Indem ich mich vorhin bedankt habe bei den unterschiedlichsten Menschen, bin ich auch bei denen gelandet, die uns - etwa in den Kirchen und in den Schulen - etwas vom Sinn unseres Lebens beigebracht haben. Denken wir daran, das ist eine geprägte Kulturlandschaft. Und zu unserer Kultur gehören nicht nur die Einrichtungen des Wissens, unsere Universitäten, der Kultur, unsere Theater und Museen, gehören auch nicht nur unsere wunderbaren Produktionsstätten, sondern es gehört eine Kultur der Mitmenschlichkeit dazu, die achtsam ist und am anderen nicht vorbei geht, wenn er ohnmächtig und geschlagen am Straßenrand liegt. Viele von uns haben in der Kindheit das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört. Und sie haben begriffen, dass Barmherzigkeit eine Form des Miteinanders ist. Barmherzigkeit heißt in der Sprache der Politik: Solidarität. Beides hat miteinander zu tun. Und die Gesellschaften der Solidarität sind erwachsener - auf dem Boden eines solchen tiefen menschlichen Wissens, dass Zuwendung und Zueinandergehören der Kern dessen sind, was uns miteinander verbindet. // So kommt eine lange kulturelle, religiöse und politische Tradition zusammen. Und all das hat dazu geführt, dass Sie leben, wie Sie hier leben: als Verbundene und nicht jeder als ein Wolf für den Anderen. Als miteinander Verbundene im Streit und in der Solidarität, in der Gestaltung und in der Geduld. Und so soll es bleiben. Und wenn es so bleibt, dann komme ich wieder und bin wieder dankbar und stolz, dass ich unter Ihnen sein kann.
-
Joachim Gauck
Manche von Ihnen sind nicht zum ersten Mal hier. Ihnen allen aber sagt Ihr Land heute auf besondere Weise "Dankeschön". Sie erhalten das Silberne Lorbeerblatt, sie erhalten das, was andere Menschen in Form des Bundesverdienstkreuzes für ihre Verdienste erhalten. Das Silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche Auszeichnung, die wir für unsere Sportler haben. Und viele von Ihnen haben es schon einmal erhalten: nämlich für den dritten Platz bei einer Weltmeisterschaft - das war schon weit mehr als ein Achtungserfolg. // Jetzt aber sind Sie Weltmeister und Sie sind hier, und wir alle freuen uns darüber. Fußballweltmeister - das ist in allen Ländern, die fußballbegeistert sind, das Allergrößte. Kein Mannschaftstitel zählt mehr als dieser, so populär andere Sportarten auch sein mögen. In den fußballbegeisterten Ländern ist es einfach so: Fußballweltmeister zu werden und zu sein, das ist noch einmal etwas ganz Besonderes, das ist nicht zu toppen. Das kann natürlich in unserem Land überhaupt nicht anders sein. // Dass Spieler, Trainer, Betreuer, der Verband Weltmeister geworden sind, das ist ja nur die halbe Wahrheit, die kleinere Hälfte der Wahrheit sogar. Was ist die ganze? Die ganze Wahrheit ist doch, dass wir uns in Deutschland gefühlt haben, als wären wir alle Weltmeister. Das kann man nun gut oder schlecht finden: Manche wünschen sich, die Gelehrsamkeit oder die besondere Fähigkeit, andere Künste auszuüben, möge dieses allumfassende Wir-Gefühl erzeugen. Aber das erleben wir gerade im Fußball. Darum ist Fußball auch, in diesem Land jedenfalls, immer etwas mehr als nur Sport - eine Gesellschaft lebt auch davon, dass in ihr tatsächlich Wir-Gefühle existieren. Und so eigentümlich es klingt, kann man manchmal, ohne dass man an das Große und Ganze einer Gesellschaft denkt, doch tatsächlich für dieses Große und Ganze der Gesellschaft etwas tun. Das meine ich, wenn ich diese Fähigkeit rühme, ein Wir-Gefühl hier in unserem Land zu erzeugen. // Dies mit dem Wir-Gefühl hat eine lange Geschichte, jedenfalls wenn man älter ist als unsere Helden hier. Ich war 14 Jahre alt, als Deutschland zum ersten Mal Weltmeister wurde, es war in Ihrem Land, Herr Blatter, in der Schweiz - wir Älteren werden das nie vergessen und die Jüngeren kennen das inzwischen auch. 1954 Weltmeister zu werden, das war schon ein großartiges Gefühl. Auch wenn Deutschland getrennt war damals - trotzdem sage ich Deutschland, weil 1954 auch die Menschen in Ostdeutschland sagten,"wir sind Weltmeister geworden". Wir waren damals für jene, die für Deutschland Fußball spielten, und das waren Westdeutsche. Das durfte man im Osten nicht so laut sagen, obwohl es doch von 1956 an eine gesamtdeutsche Olympiamannschaft gab. // So kam es, dass in all den Jahren, in denen in Deutschland kaum oder nur ganz, ganz vorsichtig von der "Nation" gesprochen wurde, ganz selbstverständlich von der "Nationalmannschaft" die Rede war. Im Fußball war die Erinnerung daran, eine Nation zu sein, immer wach geblieben. // Wenn man so will, markieren die Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaften auch den Weg unseres Landes nach dem Krieg: 1954 wurde allgemein als Chance für Deutschland empfunden, sich internationale Anerkennung zu erwerben, und dass die Deutschen einen Weg entdeckten, auf friedliche und fröhliche Weise ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln. // 1974 entsprach der erfolgsorientierte, vielleicht weniger elegante als pragmatische Fußball, mit dem im Finale Holland geschlagen wurde, der innen- und außenpolitischen Ausrichtung unseres Landes. Übrigens haben damals bei diesem berühmten Turnier bei weitem nicht alle in der DDR den Sieg in der Vorrunde über die Bundesrepublik bejubelt. Denn auch 1974 waren wir im Osten wie selbstverständlich mit Weltmeister geworden, denn - trotz eigener Mannschaft bei der WM und trotz einer eigenen Oberliga - gab es immer so etwas wie "Fußballdeutschland", ein Zusammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen hinweg. // Dann 1990: Das war in jeder Hinsicht ein denkwürdiges Jahr. Die Weltmeisterschaft kam genau in dem Moment zwischen der Friedlichen Revolution und dem Vollzug der Deutschen Einheit im Oktober. Was für ein Jahr! Die ganze Welt schaute seit Monaten auf Deutschland und auf das, was sich atemberaubendes bei uns tat. Und der Weltmeistertitel, der letzte, den die alte Bundesrepublik alleine errang, passte genau dazu. // Und nun 2014. Was für ein souveräner Titelgewinn, was für eine überzeugende Leistung, die neidlos auch von allen anderen Gegnern anerkannt wird. Was für eine starke, was für eine sympathische, sportlich und menschlich rundum begeisternde Mannschaft. Zum ersten Mal ist das wiedervereinigte Deutschland Weltmeister geworden: In diesem Jahr feiern wir ein Vierteljahrhundert Friedliche Revolution und im nächsten Jahr ein Vierteljahrhundert Deutsche Einheit - also wieder ein Weltmeistertitel, der einen für unser Land wichtigen Zeitabschnitt markiert. // Wo stehen wir heute? 2014 ist ein Land Weltmeister geworden, das schon seit einiger Zeit zu einem entspannten, zu einem aufgeklärten Patriotismus gefunden hat, sichtbar spätestens seit dem Sommermärchen von 2006. Deswegen dürfen wir uns darüber freuen, dass uns niemand den Titel neidet, und die Welt konnte sich ehrlich mit uns freuen. Das ist vielleicht die schönste Erfahrung mit diesem vierten Weltmeistertitel. Für mich ist dieser vierte Stern ein besonderer. Nicht nur, weil ich mit Ihnen zusammen, Frau Bundeskanzlerin, dabei sein konnte. Aus diesen genannten Gründen leuchtet dieser Stern für mich besonders. Wir haben uns eben erinnern lassen, wie groß die Freude und Begeisterung in unserem Lande war, ohne dass sich überhebliche und falsche Töne in den Vordergrund spielen konnten. Diesmal haben wir mit friedlicher Freude den Titel und Sie, die Mannschaft, gefeiert. // Apropos Mannschaft: Wenn ein Wort in eine andere Sprache übernommen wird, ohne dass man es übersetzt, dann deswegen, weil sich in diesem Wort etwas ganz Besonderes und ganz Eigenes ausdrückt, das man gar nicht richtig übersetzen kann. Und eine solche Übernahme drückt dann oft großen Respekt und tiefe Achtung aus. Darum darf ich Sie und alle im DFB, die für das Auftreten und den Erfolg verantwortlich sind, ruhig mit etwas Dankbarkeit anreden und Ihnen sagen: Sie dürfen auch ein bisschen stolz darauf sein, dass man auf französisch jetzt das deutsche Team einfach "La Mannschaft" nennt und auf englisch "The Mannschaft". // Hier drückt sich Respekt aus vor einer Spielweise, Respekt vor einem Gemeinschaftsgeist und dazu vor einer fein ausgeklügelten Balance zwischen individuellen Stärken und dem Team. Diese in Brasilien unbezwingbare Kombination hat dann zum verdienten Titel geführt. Mit Fußball, der oft meistens begeisternd war, der Freude und Spaß ausgelöst hat und der meilenweit davon entfernt war von einer verbissenen Erfolg-um-jeden-Preis-Mentalität, die meist nur freudlose und verkrampfte und dann auch oft sieglose Spiele bringt. // Wir wissen: Dieser Erfolg kam nicht über Nacht. Er hatte viele Väter. Da ist die seit Jahren verbesserte Jugendarbeit in den Vereinen zu nennen, die konsequente und auch entschiedene und entschlossene individuelle Nachwuchsförderung. Verband und Vereine wissen sich in gemeinsamer Verantwortung - und zwar nicht nur für den Erfolg, sondern auch für die ganze Entwicklung des jungen Menschen. Zu danken haben wir sicher also auch den vielen Jugendtrainern, die überall im Land aktiv sind, die Talente fördern und Talente entdecken. // Was die Mannschaft nun auch schon eine ganze Weile ausmacht, das ist die ganz selbstverständliche Spiegelung der Einwanderungsgesellschaft, die wir längst geworden sind. Was in den Jahren zuvor schon festgestellt werden konnte, das wird nun mit dem Weltmeistertitel erst recht klar: Der Fußball und gerade diese Mannschaft können zeigen, wie die Einheit der Verschiedenen gelingen kann und zu welchen Erfolgen sie dann fähig ist. Wir gehören zusammen und wir gewinnen zusammen - das ist die große Botschaft dieser Mannschaft. // Die Ausschreitungen von Hooligans in den vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Sport einigen Menschen als Feigenblatt für rohe Gewalt dient, manchmal auch für Fanatismus und Hass. Aber unser Sport, nicht nur der Fußball, sondern generell der Sport, kann auch ein Gegenmittel sein und kann eine Atmosphäre fördern, in der Toleranz und Offenheit vorgelebt werden - und zwar von Spielern wie auch von Fans. Deshalb danke ich allen hier im Saal, die sich unermüdlich gegen Rechtsextremismus und Gewaltorgien stark machen. Und vor allem bitte ich die, die das tun, und Sie alle: Setzen Sie dieses Engagement fort! // Liebe Fußballer, wenn Sie mir diese familiäre Anrede erlauben, die Welt schaut auf das, was Sie auf und auch neben dem Platz leisten. Mit dem Titelgewinn 2014 haben Sie sich, Ihren Freunden und Fans, und dem ganzen Land ein bleibendes Geschenk gemacht. Dem großen Buch des Fußballs mit seinen legendären Helden und Mannschaften haben sie ein besonders schönes schwarz-rot-goldenes Schmuckblatt hinzugefügt. // So, wie damals das Team um Fritz Walter und Helmut Rahn 1954 ebenso Geschichte geschrieben hat wie das Team von Franz Beckenbauer und Gerd Müller 1974 und das Team um Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann 1990, gehören auch Sie jetzt in diese ruhmvolle Reihe. // Alle, die die Spiele verfolgt haben, werden sich noch lange an vieles erinnern. An einzelne Szenen, an den Turniersieg, an glückliche Momente, an traurige oder lachende Gesichter, an große Emotionen. Und vielen von uns, die das erlebt haben, werden einige dieser Szenen für immer im Gedächtnis bleiben. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Und ich freue mich auch nochmal, dass ich persönlich dabei sein durfte, damals in Rio, und die unvergesslichen Augenblicke so hautnah miterleben konnte. Es war und ist schon immer etwas ganz Besonderes, als Bundespräsident Weltmeister zu werden. // Jetzt haben wir genug davon gesprochen, dass wir alle und das Land und somit auch die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und der Bundespräsident Weltmeister geworden sind. Indem ich Ihnen, und nicht dem ganzen Land jetzt das Silberne Lorbeerblatt überreiche, wird noch einmal deutlich, wem eigentlich die Ehre gebührt, wer durch seine Leistung zu unser aller Freude Weltmeister geworden ist: Sie sind es, die Mannschaft von 2014, der wir hier und heute noch einmal feierlich, ernsthaft und fröhlich "Danke" sagen: Danke!
-
Joachim Gauck
Vielleicht sollte ich mit einer kleinen Geschichte beginnen um Ihnen zu verdeutlichen, warum ich gerne heute rede und eine Rede über die Rolle und die Freiheit der Presse so wichtig ist. Als meine Großmutter in den 1960er-Jahren starb, wollte ich das Psalm-Wort "Meine Zeit steht in Deinen Händen" in der Todesanzeige unterbringen. Es gelang mir nicht. Der Verlagsleiter der in Rostock erscheinenden Ostsee-Zeitung erklärte mir, man mache eine kommunistische Zeitung. Da sei ein solcher christlicher Text nicht möglich. Selbst die Todesanzeige wurde zensiert. // Das ist lange her, und diese Zustände sind bei uns überwunden. Aber es geht mir durch den Kopf, wenn ich heute über die Freiheit der Presse rede. // Der Deutsche Presseclub hat mich zu seinem 60-jährigen Bestehen eingeladen. Was für ein schöner Anlass, um über die Freiheit der Presse, über die Verantwortung der Presse, über Meinungsfreiheit und das Verhältnis von Politik und Journalismus zu sprechen. // Darüber soll aber nicht der Anlass des heutigen Abends aus dem Blick geraten: Ich gratuliere dem Deutschen Presseclub auf das Herzlichste zu seinem 60-jährigen Bestehen. Meine Gratulation enthält Wünsche für Sie und Ihren Club. Meine Gratulation enthält aber auch Wünsche, die wir alle - mündige Staatsbürger wie Politiker - an Sie, an die Presse insgesamt haben. Denn so stolz wir auf unsere vielfältige Presselandschaft schauen: Es gibt auch Dinge zu besprechen, die uns allen weniger gefallen können. Dazu will ich nachher noch kommen. // Bei einer Feier zu Ihrem 60-jährigen Bestehen schwirren Anekdoten durch den Raum. Die machen den Club auch aus, aber nicht nur. Das Wichtigste ist, dass der Deutsche Presseclub der Presselandschaft in der noch jungen Bundesrepublik einen elementaren Baustein hinzugefügt hat - das vertrauliche Gespräch zwischen Politik und Presse. Der Deutsche Presseclub etablierte einen Ort für das Hintergrundgespräch, einen Ort für das legendäre "Unter drei". // Ihre "Clubregeln" sagen: "Über Club-Veranstaltungen darf nicht berichtet werden. Ausnahmen von dieser Regel werden vom amtierenden Vorsitzenden bekanntgegeben." // Es mag für Außenstehende schwer verständlich sein, dass Journalisten sich in einem Club zusammenfinden, über dessen Veranstaltungen sie nicht berichten dürfen. Ihre Hauptaufgabe ist es doch gerade, zu berichten. Aber hinter jeder Nachricht stehen Überlegungen, Strategien. Hinter der Nachricht stehen Akteure, die ihr Anliegen befördern, oder auch die Strategien Dritter durchkreuzen wollen. Wenn Sie Politiker in Ihren Club einladen, geht es Ihnen genau darum: Sie wollen Zusammenhänge und Haltungen besser verstehen. Sie wollen wissen, wie es zu dieser oder zu jener Entscheidung kommt, was die Protagonisten bewegt. // Sie müssen es wissen, denn ohne dieses Hintergrundwissen können Sie politische Prozesse nicht vollständig erfassen, nicht profund genug analysieren und kommentieren. Und das wiederum erwartet man von Ihnen: Dass Sie mit Ihrer Analyse, mit Ihrem Kommentar einen Diskussionsbeitrag liefern, mit dem die Leser, Zuhörer und Zuschauer Ereignisse und politische Akteure besser einschätzen können. Dafür muss man ja Ihren Kommentarstandpunkt nicht teilen. Aber die Menschen wollen Ihren Debattenbeitrag. Sie unterstützen Orientierung und Urteilsfähigkeit der Vielen. Es gibt nicht so viele Aufgaben, die schöner und reizvoller wären. Ich darf Ihnen also auch dazu gratulieren. // Wenn wir heute auf unsere Presselandschaft schauen, können wir jederzeit darüber reden, ob wir uns gut informiert fühlen, ob das, was wir im Fernsehen sehen oder was morgens aus dem Autoradio schallt, das ist, was dem Informationsauftrag entspricht. Es gibt fabelhafte Zeitungen, gute Online-Medien und es gibt leider auch andere. // Aber, ob gut, ob weniger gut, spielt in einer Hinsicht keine Rolle: Der Artikel 5 unseres Grundgesetzes schützt die Presse und ihre Freiheit. Nehmen Sie es als eine Garantie für Ihre Arbeit. Der Staat und die Bürgergesellschaft wollen die offene Diskussion, wollen die Argumente für und wider. Und um sich ein Urteil bilden zu können, braucht es auch Erklärungen und Hintergründe. In einer freien und unabhängigen Presse finden die Bürgerinnen und Bürger sie. Das ist ein Grund, warum wir die Freiheit der Presse schützen. Ein anderer Grund für den besonderen Schutz Ihrer Arbeit ist die Erwartung an die Kontrollfunktion. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich, dass die politisch Handelnden integer sind und sich voll und ganz dem Gemeinwohl verpflichten. Aber sie können nur schwer kontrollieren, ob es so ist, wie sie es erhoffen. // Es gehört zu Ihren Aufgaben, die politischen Abläufe und die Akteure zu kontrollieren und zu kritisieren. Sie verschaffen auch Gegenargumenten öffentliches Gehör. Und das hat Folgen: Lobbygruppen müssen damit rechnen, dass ihre Einflussnahme kritisch beleuchtet wird. Ein Minister muss damit rechnen, dass seine Erklärung mit der von vor einem Jahr verglichen wird. Der Oppositionspolitiker kann niemals sicher sein, dass seine 180-Grad-Wenden unkommentiert bleiben. Sie recherchieren und Sie kritisieren Staat, Gesellschaft, Parteien oder Organisationen. Nicht aus Freude am Schwarzmalen, sondern weil es Ihre Aufgabe ist. // Zur Berichterstattung, zu fairer Information, darf dabei durchaus auch die Vermittlung dessen gehören, was gelungen ist! Aber öffentliche Kritik schafft Kontrolle über die kritisierten Zustände. Schon die Veröffentlichung - manchmal auch die Furcht davor - kann Folgen haben, kann zu Verhaltensänderungen führen. Die Republik kennt genügend Beispiele. // Man bezeichnet Ihren Berufsstand deshalb auch als die vierte Gewalt im Staat. Sie sind Teilnehmer am politischen Prozess, Sie nehmen in der Meinungs- und Willensbildung eine wichtige Stellung ein - und übernehmen zugleich auch eine sehr große Verantwortung. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieser Verantwortung gerecht werden. Sie sind nicht nur frei von staatlichen Eingriffen, von Zensur, Sie sind ebenso frei in Ihrem Ja zu dieser Verantwortung. Sie ist Teil unserer tagtäglich gelebten Pressefreiheit. Sie ist uns selbstverständlich, gehört einfach zu unserer Demokratie. // Schauen wir allerdings auf die Alltagswirklichkeit im Medienbetrieb, so ist durchaus nicht alles in Ordnung. Es gibt durchaus auch Situationen, in denen Ihre Arbeit behindert wird. Es gibt Fehlverhalten und es gibt vermeintliche Sachzwänge. Darüber müssen wir offen reden. Bezogen auf das Ethos von Journalisten könnten wir als erstes fragen: Können Sie Ihren Leserinnen, Lesern, Zuhörern, Usern, Zuschauern, können Sie den Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass Sie sich Ihrer Verantwortung immer bewusst sind bei Ihrer täglichen Arbeit? Arbeiten Sie an jedem Tag des Jahres daran, mit Ihren Artikeln, Beiträgen und Kommentaren den politischen Diskurs, von dem unsere Demokratie lebt, zu befördern und zu bereichern? Können Sie guten Gewissens versichern, dass Ihre Recherchen immer so tief sind, dass Ihre Veröffentlichungen und Kommentare die Sachkenntnis atmen, die den Themen gerecht wird? Was bedeutet Ihnen Fairness? Darf man darauf vertrauen, dass es keine Kumpeleien, keine Kumpaneien mit den Mächtigen gibt? Sehen Sie Ihre Arbeit jederzeit so selbstkritisch wie Sie es von denen erwarten, die Sie kritisieren? // Lassen Sie uns einen Blick werfen auf die Bedingungen, unter denen Journalisten mitunter zu arbeiten haben; eine heile Medienwelt existiert doch wohl eher nicht! Wo einzelne Medien eine Monopolstellung einnehmen, kommt die Meinungsvielfalt schnell unter die Räder. Aber auch ökonomische Zwänge setzen der Pressefreiheit im Alltag heftig zu. Wenn der Kostendruck den Redaktionsalltag bestimmt, wenn die gerade mühsam akquirierte Anzeige den redaktionellen Text auf der Seite halbiert oder den Kommentar aus dem Blatt kickt, werden tiefe Recherche, sachkundige Berichterstattung und ausgewogene Kommentierung schnell zu Wunschdenken. // Und jeder von uns kennt auch Journalisten, die wie Kumpane agieren, die sich zuweilen mit Politikberatern verwechseln und damit alles andere als unabhängig sind. Wir kennen auch Presseberichte, die fahrlässig Beihilfe zu Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit leisten. // Auch kritische Berichterstattung darf doch Positives wahrnehmen, muss zum Beispiel die sogenannten Hinterbänkler, die in den Ausschüssen versuchen, auch die trockensten Sachverhalte zu meistern, die sich auf die Sitzungen intensiv vorbereiten und so parlamentarische Entscheidungen erst möglich machen, würdigen können. // Diese Kärrnerarbeit der Demokratie scheint keine Schlagzeile wert zu sein. Aber darf sie deshalb einfach aus der Berichterstattung herausfallen beziehungsweise bestenfalls ironisch kommentiert werden? // Ich bin mir dennoch sicher und will darauf vertrauen, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten ihre Aufgabe als Chronisten und Beobachter der Politik sehr ernst nehmen und nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen. Ihre Recherchen sind nicht immer angenehm, Ihre Kommentare nicht immer bequem, aber sie atmen Sachkenntnis und Sorgfalt. Das ist keine Ausnahme sondern Regel. Und darüber darf man sich dann auch einmal freuen und dankbar sein! // Journalisten bekommen Feedback auf ihr Tun. Leserbriefe. Neu-Abos. Abo-Kündigungen. Sie werden angerufen - nicht nur aus Pressestellen. Man spricht Sie auf der Straße an, in der Parlamentskantine. Im Internet wird der Like-Button gedrückt - oder auch nicht. Man könnte auch sagen, Ihre Arbeit wird wahrgenommen und in gewisser Weise auch kontrolliert. Gut so. // In Deutschland gibt es ein außerordentlich dichtes System von Anerkennung einerseits, Kontrolle und Sanktion andererseits. Darin zeigt sich, dass es uns nicht einerlei ist, von welcher Qualität unsere Presse ist. // Und deshalb wollen wir diese auch würdigen. In unserem Land werden viele Journalistenpreise verliehen. Einige können es in Sachen Renommee mit einer hohen Auszeichnung im Sport aufnehmen. Aber zur Kontrolle Ihrer Arbeit gehört nicht nur das herausgehobene Lob für Gelungenes. Sie sehen sich auch mit Sanktionen konfrontiert für Misslungenes und besonders für Regelverstöße. // Hinzu kommt: Wo Regeln verletzt werden, wo die Presse behindert oder gar belogen wird, aber auch wo der Anspruch auf faire und wahrheitsgemäße Berichterstattung nicht eingelöst wird, wo die Privatsphäre verletzt wird, wo neben journalistischem Spürsinn Jagdinstinkte treten, greifen die Gesetze, auch die Pressegesetze. Das ist gut zu wissen. Aber es ist fast noch besser zu wissen, dass sich die Presse mit dem Deutschen Presserat, mit Satzungen und Kodizes ihrerseits Instrumente zur Selbstkontrolle geschaffen hat, dass Sie eigenverantwortlich die Regeln überwachen und dass die Systeme der Selbstkontrolle anschlagen. // Bundespräsident Gustav Heinemann nahm am 12. Dezember 1973 den von den Presseverbänden beschlossenen Pressekodex entgegen. Darin verpflichten Sie, die deutschen Journalisten, sich zur Achtung vor der Wahrheit, zur Wahrung der Menschenwürde und zur wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit. Sie verpflichten sich darin zur journalistischen Sorgfalt, zur Trennung von Werbung und Redaktion. Sie geben den Bürgerinnen und Bürgern die Zusicherung - und nicht nur so nebenher - dass Sie sich Ihrer Verantwortung als vierter Gewalt sehr wohl bewusst sind und danach arbeiten. // Indem Sie sich solche Standards setzen, indem Sie sich selbst als wahrhaftige Beobachter definieren, indem Sie in Ihrer täglichen Arbeit beweisen, dass Sie unabhängig und hartnäckig recherchierend den politischen Prozess begleiten, sind Sie bei aller Unabhängigkeit auch Teil eines politischen Gesamtsystems, das Ihnen mit der Sicherung der Pressefreiheit erst den Freiraum garantiert, den Sie für Ihre Arbeit brauchen. // Fragen wir zum Schluss noch einmal nach der Rolle der Institution, deren Jubiläum wir heute feiern. Selbst Ihnen, den Mitgliedern des Deutschen Presseclubs, wird es mitunter schwer fallen, politische Entscheidungen einzuordnen. Politik ist in aller Regel ein sehr komplexes Gebilde, ein kompliziertes Geflecht aus Interessen, Sachzwängen und Personen. // Das haben auch die Gründer des Deutschen Presseclubs gesehen und deshalb ganz bewusst einen Ort geschaffen, an dem es eben nicht um die Sensation, nicht um die Nachricht als solche, sondern um die Zusammenhänge hinter der Nachricht geht. // Nur scheinbar besteht ein Widerspruch zwischen der Vertraulichkeit im Hintergrund und der Transparenz, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten dürfen. Ich glaube im Gegenteil, dass es auch der Vertraulichkeit im Hintergrundgespräch bedarf, um mehr Transparenz in politische Abläufe und Entscheidungswege zu bringen. // Gerade weil Ihre Gesprächspartner wissen, dass nicht jeder Satz am kommenden Tag die Morgennachrichten eröffnet, sprechen sie mit Ihnen offen und ernsthaft über Politik und deren Hintergründe. Sie wiederum brauchen diese Offenheit, um den politischen Prozess kundig begleiten zu können. Sie brauchen diese Offenheit, um ihn gegebenenfalls auch kritisch kommentieren zu können. Sie erkennen leichter, wem Sie vertrauen können, wem die Öffentlichkeit etwas zutrauen darf. // Die Politik braucht derartige Begegnungen ebenfalls, um ihr Handeln besser erklären zu können. Und das wiederum wollen mündige Staatsbürger bekommen: eine Erklärung für Politik und ihre Auswirkungen. Denn ohne dass Politik erklärt wird, schwindet über kurz oder lang die Akzeptanz für Politik, für Politiker und letztlich schwindet die Akzeptanz für unsere Demokratie. Indem unsere Presse dazu beiträgt, Politik zu analysieren, zu erklären, zu kommentieren und auch zu debattieren, indem unsere Presse den Argumenten dafür und den Argumenten dagegen Gehör verschafft, indem unsere Presse zum Meinungsstreit beiträgt, trägt sie ganz selbstverständlich und in gewichtiger Weise bei zum Funktionieren unserer Demokratie. // Das ist gut und das soll so bleiben. Noch einmal gratuliere ich dem Deutschen Presseclub, der seit 60 Jahren mit dafür sorgt, dass wir eine freie, eine informierte und eine gute Presse haben. // Herzlichen Glückwunsch!
-
Joachim Gauck
Vor genau vier Wochen - einige haben mich schon darauf angesprochen - stand ich auf dieser Bühne. Damals feierten wir den Jahrestag der friedlichen Wiedervereinigung unseres Landes. Ein festliches Ereignis - ähnlich wie heute. Denn heute ist ein besonderer Tag, weil wir eine Organisation feiern, die nach Jahrzehnten der Teilung in Ost und West 1991 selbst eine Wiedervereinigung erlebt hat. Eine Organisation, die über 150 Jahre hinweg Deutschland und die Deutschen durch ihre so wechselvolle Geschichte begleitet hat: das Rote Kreuz. // Ein rotes Kreuz auf weißem Grund steht für Schutz und Hoffnung in Zeiten der Not. Es steht für den Schutz von Schwachen und Bedürftigen. Es ist eines der bekanntesten - und bemerkenswertesten - Symbole, die es überhaupt gibt. Denn am Anfang der Geschichte der Bewegung des Roten Kreuzes stand das Mitgefühl eines Mannes für das Leid der Soldaten im 19. Jahrhundert, als der Krieg - an der Krim und schließlich in Oberitalien - nach Europa zurückgekehrt war. Die Schlacht von Solferino im Jahr 1859 und ihre über 40.000 Verwundeten und Toten erschütterten den Genfer Geschäftsmann Henry Dunant so sehr, dass er sofort Hilfsmaßnahmen für die verwundeten Soldaten in die Wege leitete. Immer wieder begründete er seinen Einsatz mit den italienischen Worten: tutti fratelli - wir sind doch alle Brüder! Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl entstand dann eine neue Bewegung, die beispielhaft für das steht, was wir heute humanitäre Hilfe nennen. // Natürlich gab es dafür Vorzeichen und Vorläufer: Dass verwundete Soldaten des Schutzes bedurften, diese Vorstellung hatte sich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aber mit dem Rotkreuzgedanken setzte Henry Dunant entschlossen dem Grauen des Krieges tätige Mitmenschlichkeit und christliche Nächstenliebe entgegen. Die Rotkreuzbewegung steht so nicht nur für die beflügelnde Kraft des Mitgefühls, sondern auch für die Macht eines Einzelnen. Und diese Kraft verbreitete sich aus Genf in ganz Europa und später in der Welt. // Schon im November 1863 - vor 150 Jahren also - wurde der erste Rotkreuzverein auf deutschem Boden, hier in Stuttgart gegründet: der Württembergische Sanitätsverein. Deshalb sind wir hier versammelt, um diese wirkmächtige Idee, die auch in unserem Land sich so kraftvoll entfaltet hat, zu würdigen: Tutti fratelli, alle sind Brüder - e sorrelle, und Schwestern! Natürlich! Ja, gerade hier in Deutschland knüpfte die Rotkreuzbewegung auch an die Tradition der Frauenvereine aus der Zeit der Befreiungskriege an. // In Deutschland hat das Rote Kreuz einen historischen Beitrag dazu geleistet, dass sich eine bürgerliche Gesellschaft entwickelte, die ihre Geschicke selbst in die Hand nahm und nicht alles dem Staat überließ. Das Deutsche Rote Kreuz steht damit in einer Reihe mit anderen Institutionen des bürgerschaftlichen Engagements, der bürgerschaftlichen Selbstorganisation: den freien Wohlfahrtsverbänden, den freien Gewerkschaften und den eigenständigen Industrie- und Handelskammern. // Gerade mit den Erfahrungen der deutschen Vergangenheit erkennen wir heute den Wert eines freien zivilen Mitgliederverbands für unsere Demokratie: Nach der "Gleichschaltung", wenn wir an die NS-Zeit erinnern, und auch nach der Freiheitseinschränkung - und ich sage dies trotz einiger innerer Freiräume - in der DDR wurde im wiedervereinigten Deutschland das ganze Rote Kreuz ein aktives Bündnis freier, verantwortungsbewusster Bürger. // Tätig werden, statt untätig zu verharren - die Dinge in die Hand nehmen, statt sie klaglos hinzunehmen - das ist die Handlungsmaxime des Deutschen Roten Kreuzes: Ob in der Pflege oder in der Betreuung älterer Menschen, in der sozialen Arbeit mit Jugendlichen oder in der Beratung von Zugewanderten - das Deutsche Rote Kreuz ist für alle da. Vielen begegnet es bei Erste-Hilfe-Kursen oder bei freiwilligen Blutspenden. Es leistet Notfallhilfe und Katastrophenschutz. Ein Beispiel: Als die Flüsse in diesem Jahr erneut über die Ufer traten und große Teile Deutschlands überschwemmten, da war das Deutsche Rote Kreuz wie selbstverständlich zur Stelle. Damit trägt das Rote Kreuz dazu bei, dass wir uns sicher fühlen. Wir wissen: Ich erhalte Hilfe in der Not oder in der Krise. So stiftet das Deutsche Rote Kreuz gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist zu einem Markenzeichen für die soziale Dimension in unserem Land geworden. // Welchen Stellenwert das Deutsche Rote Kreuz hier hat, das zeigt uns auch die Zahl seiner Mitglieder: fast vier Millionen sind es. Besonders freue ich mich darüber, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger im Roten Kreuz ehrenamtlich engagieren - es sind über 400.000. Ihnen, den Ehrenamtlichen, möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen. Als Bürger helfen Sie Bürgern. Sie sind stets dort zur Stelle, wo Sie gebraucht werden. Eine vitale Bürgergesellschaft lebt von diesem Engagement. // Das Deutsche Rote Kreuz spielt, auch dies sei erwähnt, eine bedeutende Rolle für das Gesundheits- und Sozialwesen. Es betreibt Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Pflegeheime, steht dabei im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen und bringt seine Stimme ein in die Diskussionen, wie unser Sozialstaat auch künftig jedem medizinische Versorgung auf dem Stand der Wissenschaft und menschenwürdige Pflege garantieren kann. Das bedeutet für eine Organisation wie das Rote Kreuz auch besondere Herausforderungen - nämlich das Gemeinnützige und das Ehrenamtliche in eine Balance mit dem Geschäftlichen und den Hauptamtlichen zu bringen. Das setzt ein klares Leitbild voraus und Transparenz - wie Sie beim Deutschen Roten Kreuz sich das vorgenommen haben. Bei Ihrem Wirken für das Soziale in unserem Land helfen Sie so, die ideellen Werte des Deutschen Roten Kreuzes zu bewahren. // Weltweit ist das DRK humanitärer Botschafter unseres Landes. Als ich vor vier Wochen hier in diesem Saal sprach, habe ich auch über die Verantwortung Deutschlands in der Welt geredet. Dass das wiedervereinigte Deutschland als international angesehener und verlässlicher Partner gilt, dazu hat übrigens auch die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes einen wichtigen Beitrag geleistet. // Humanitäre Hilfe - das bedeutet, mit Henry Dunant im Kern daran zu glauben, dass wir im Stande sind, die Welt aus eigener Kraft zu verändern, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Heute geht es in der internationalen Politik nicht mehr nur um die Sicherheit von Staaten. Es geht auch um die Sicherheit des Einzelnen oder von den Vielen. Das ist eine wesentliche Errungenschaft der Weltgemeinschaft. Und wir sollten es ruhig aussprechen: Es ist ein Erfolg auch unserer Wertegemeinschaft, es ist auch ein Erbe der europäischen Aufklärung in einer Welt, die entgegen mancher Erwartung nach 1989 nicht friedlicher geworden ist. Tatsächlich erleben wir seither doch eine Fülle neuer Konflikte: zunehmend nicht nur zwischen Staaten, sondern innerhalb von Staaten zwischen unterschiedlichen Interessengruppen oder politischen, ethnischen und religiösen Gruppierungen. Einzelne fragile Staaten können die Sicherheit ihrer eigenen Bürger überhaupt nicht mehr gewährleisten. Oftmals haben sie auch gar kein Interesse daran. Dies stellt die weltweite humanitäre Hilfe vor ganz neue Herausforderungen. // Was das bedeutet, das habe ich auch bei meiner Begegnung mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Peter Maurer, erfahren. Das Internationale Komitee mit seinem ganz besonderen Mandat im Völkerrecht ist ein unverzichtbarer Partner der Bundesregierung in ihrer humanitären Hilfe - denken wir allein an die humanitäre Krise in Syrien. Deutschland gehört dort zu den größten Geldgebern und arbeitet eng mit dem Roten Kreuz zusammen. // In Syrien wie an vielen anderen Brennpunkten müssen wir uns fragen: Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Frieden möglich ist und in dem die Ursachen von Gewalt und damit von individuellem Leid verschwinden oder doch zumindest eingehegt werden? // Durch seine Prinzipien steht das Rote Kreuz beispielhaft für gelungene internationale Kooperation - nicht nur über Landesgrenzen hinweg, sondern auch zwischen den Weltreligionen. Die Rotkreuz- und die Rothalbmondgesellschaften genießen gleiche Rechte und Pflichten und sind in vielen Krisenregionen die einzigen Organisationen, die von allen Konfliktparteien anerkannt und respektiert werden. // Es ist entscheidend, dass das Rote Kreuz - ebenso wie der Rote Halbmond - auch weiterhin als Schutzsymbole akzeptiert werden, die eine unüberwindbare Grenze für Gewalt und Aggression darstellen. Übergriffe, welcher Art auch immer, auf Mitarbeiter des Roten Kreuzes können wir nicht hinnehmen. Nur wenn dieser Schutz gewährleistet ist, können Hilfsorganisationen ihrer Aufgabe nachkommen. Nur dann kommt eben die Hilfe bei den Bedürftigen an. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds setzen Leib und Leben aufs Spiel, um anderen Menschen zu helfen und das verdient doch unsere Unterstützung - und zwar unsere volle Unterstützung. // Nun könnte man sagen: Der humanitäre Gedanke, wie wir ihn heute kennen, hat sich in Europa entwickelt, auch weil der Kontinent so zahlreiche und so grausame kriegerische Auseinandersetzungen erlebt hat. Die Staaten Europas haben sich nach diesem schmerzvollen Weg miteinander versöhnt. Humanitäre Hilfe war nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wesentlich für den Aufbau des Kontinents - das Rote Kreuz hat einen besonderen, einen ganz besonders "menschlichen" Beitrag in dieser Zeit geleistet, indem es half, Familien zusammenzuführen, die in den Wirren des Krieges auseinandergerissen worden waren. Ich habe noch in Erinnerung, wie wir, als ich ein Junge war, an den Radiogeräten saßen und ganze Namenslisten verlesen wurden. Der Suchdienst hat hier unglaublich dabei geholfen, Menschen zusammenzuführen, die durch Krieg und Kriegsfolgen auseinandergerissen waren. Aus dieser Zeit erinnere ich mich auch an die humanitären Aktionen, die Deutschland geholfen haben nach dem Krieg, etwa an die Schwedenspeisung im Hungerwinter 1946/47. Mit Lebensmittelpaketen, Kleidung und Schuhen halfen Schweden, Dänen, Schweizer, Briten und viele andere über die Rotkreuzorganisationen den Deutschen in ganz existenzieller Not. Ich möchte nicht, dass Deutschland vergisst, wie ihm einst geholfen wurde. Das war schließlich über die Hilfe für das schiere Überleben hinaus eine große Geste der Humanität, in der sich wieder Henry Dunants kraftvoller Gedanke zeigte: tutti fratelli e sorrelle - wir sind Schwestern und Brüder. An diese Erfahrung der Deutschen möchte ich heute dankbar erinnern. // Humanitäre Hilfe bedeutet, auf der Grundlage von Werten und Überzeugungen zu handeln. In diesem Grundsatz, den man auf Vieles übertragen kann, sehe ich eine Zukunftsaufgabe für uns in Europa. Wir als Europäer müssen unsere eigenen Werte ernst nehmen und ihnen auch in unserem praktischen Handeln folgen. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den vielen Versuchen überall in der Welt, den Geltungsbereich der Menschenrechte etwa einzuschränken. Das geschieht beispielsweise unter Verweis auf distinkte "kulturelle Konventionen" oder "traditionelle Werte", die angeblich nicht mit den Menschenrechten übereinstimmen würden. Aber das ist immer unrichtig. Das ist immer taktisches Kalkül von Menschen, die sich davor fürchten, allen Menschen Menschenrechte und Bürgerrechte zuzuerkennen. Es gibt nicht zwei Arten von Menschenrechten. Die Vereinten Nationen haben sich auf eine Liste, auf einen Katalog geeinigt. Deshalb sind Menschenrechte nicht verhandelbar. Sie sind universell. Sie gelten überall und für jede Frau, für jedes Kind, für jeden Mann. // Bei der Durchsetzung der Menschenrechte sind wir ein großes Stück vorangekommen. Doch auch diese Geschichte, die Geschichte dieser Rechte, ist noch nicht zu Ende. Sie ist es schon deshalb nicht, weil Menschenrechte offensichtlich immer wieder aufs Neue erstritten werden müssen. // Und da sind wir alle gefordert: Wir erleben gerade zutiefst schockierende Tragödien an den Außengrenzen der Europäischen Union. Dazu können wir doch nicht schweigen, wenn wir unsere eigenen Werte ernst nehmen. Wir müssen uns fragen: Wie begegnen wir jenen, unseren Schwestern und Brüdern menschlicher, die sich aus Leid und Verzweiflung auf den Weg nach Europa gemacht haben und vor unseren Grenzen in akute Not geraten sind? Wie gehen wir mit denen um, die bei uns Schutz suchen? Wie gestalten wir die notwendigen Verfahren schnell und fair? Und ich möchte die Frage hinzufügen: Wie gestalten wir auch die oft notwendige Ablehnung von Asyl menschlicher? Welche Perspektiven bieten wir Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind? Gewiss, wir wissen es doch alle, wir werden nicht alle Menschen aufnehmen können, die auf der Welt in Not sind. Aber wir können mehr tun, und wir können es menschlicher tun. // An einer gesamteuropäischen Verantwortung für die Sicherheit in den Gewässern des Mittelmeers darf kein Zweifel bestehen. Der Schutz jedes einzelnen Menschenlebens geht allem voran. // Wir sollten uns von dem Idealismus, mit dem die Mitarbeiter des Roten Kreuzes ihre Aufgaben angehen, inspirieren lassen. Wir müssen zugleich abwägen, was realistischer Weise möglich ist - auch das gehört zu verantwortungsvollem Handeln. Doch mit Toleranz, ehrlichem Mitgefühl und einem offenen Auge für die Nöte anderer Menschen, ob nah oder fern, wird es uns gelingen, noch weiter auf diesem Weg zu einer friedlicheren und gerechten Welt voranzukommen. // Sie, meine Damen und Herren, bitte ich: Führen Sie Ihre Arbeit zum Wohl der Menschen, die Hilfe benötigen, auch weiterhin mit Energie, mit Hingabe und mit Weitsicht fort. Ich danke allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihren großen Einsatz. // Aber einen Satz muss ich noch hinzufügen: Heute, da dürfen Sie auch einmal stolz sein, in dieser großartigen Institution mitzuarbeiten. Ich danke Ihnen.
-
Joachim Gauck
Vor ziemlich genau zwei Monaten saß ich in einem Flüchtlingslager, in einem Zelt, es war in Kahramanmaras, an der türkisch-syrischen Grenze. Ich saß mit Vater, Mutter, Großvater zusammen, und die erzählten von dem Krieg, der sie vertrieben und zu Opfern von Terror gemacht hatte. Sie waren ängstlich, aber sie waren geborgen. Sie hatten vier Kinder. Das jüngste war dort im Lager geboren. Und jetzt warteten sie. // Ich frage mich manchmal, ob die Menschen, die ich dort getroffen habe, überlebt hätten, wenn sie über das Mittelmeer geflüchtet wären? Hätten die Kleinen es geschafft, wäre das Jüngste geboren worden, wer hätte überlebt, wären alle gestorben? // In Situationen wie diesen merkt jeder: Menschen zu begegnen, das ist etwas anderes, als nur Zahlen zu begegnen oder Statistiken. Man blickt in Gesichter - verstörte, verängstigte -, hört die dramatischen Geschichten, spürt die Hoffnung auf Hilfe aus der Ferne, aus der Fremde. Irgendwoher muss sie doch kommen. // Aber natürlich müssen sich Fachleute, die sich mit dem Thema Flüchtlinge befassen, auch über Statistiken beugen, müssen Zahlen kennen, sie verfolgen. Müssen erkennen, wie groß der Druck ist, der von diesem Teil der Weltbevölkerung ausgeht, die nicht beheimatet ist. Wenn wir Zahlen und Statistiken sehen, erkennen wir, was wir tun können, wo wir stehen. Also muss man auch ein paar Zahlen nennen. // Sie alle hier im Raum wissen: Bund und Länder haben beschlossen, weitere 10.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Das empfinde ich als richtig, wichtig und wertvoll. 5.400 Syrer haben dank der ersten beiden Kontingente auf gefahrlosem Wege Schutz in Deutschland gefunden. // Aber der Bürgerkrieg dauert nun schon seit 2011. Die Toten, kann keiner mehr zählen, von mehr als 150.000 ist die Rede. Und auch wenn kein anderer europäischer Staat mit vergleichbaren humanitären Programmen auf den dramatischen Konflikt reagiert hat, auch wenn die, die in Deutschland aufgenommen werden, bessere Bedingungen vorfinden als in den meisten anderen Ländern der Welt: Der überwiegende Teil der rund 32.000 Syrer, die seit Beginn der Gewalt nach Deutschland kamen, hat sich auf anderen Wegen durchschlagen müssen, auch auf dem illegalen und lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer. // Millionen sitzen in der Krisenregion fest, als Flüchtlinge im eigenen Land oder in Lagern in der Türkei und in Jordanien. Was dort geleistet wird, haben Daniela Schadt und ich mit eigenen Augen gesehen. Im Libanon leben derzeit mehr als eine Million Flüchtlinge. Das ist, gerechnet auf die Bevölkerung, als wären unter uns in Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge anwesend. // "Tun wir wirklich alles, was wir tun könnten?" Das habe ich immer wieder gefragt, auch in der Weihnachtsansprache habe ich das getan. Sie, liebe Gastgeber, zitieren es in der Ankündigung zu diesem Symposium. Zahlen und Statistiken geben auch hier einen Eindruck. // In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland insgesamt 54.956 Erstanträge auf Asyl gestellt - mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum im vergangenen Jahr. In absoluten Zahlen kommen in kein anderes Land Europas mehr Asylbewerber. Gemessen an der Bevölkerungszahl aber liegt Deutschland in Europa längst nicht an der Spitze, sondern auf Platz 9, deutlich hinter Schweden, auch hinter Österreich, hinter Ungarn und Belgien. // Blicken wir nur auf uns selbst, dann neigen wir nicht selten zur Selbstgerechtigkeit. Ziehen wir aber auch in Betracht, wie viele andere dieselben oder ähnliche Probleme lösen, dann werden wir wohl zwangsläufig demütiger. // Wer macht sich bewusst, dass sogenannte Binnenflüchtlinge den absolut größten Teil der Flüchtlinge in der Welt ausmachen? Wer weiß schon, dass insgesamt nur ein kleiner Teil der weltweit mehr als 51 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen Schutz in Europa sucht - und ein noch kleinerer tatsächlich findet? Dass meistens die ärmsten Länder für die Armen aus ihrer Nachbarschaft aufkommen? Setzt man die Zahl der Flüchtlinge ins Verhältnis zur Wirtschaftskraft der Länder, so sind nach der aktuellen Statistik des UNHCR die drei größten Aufnahmeländer Pakistan, Äthiopien und Kenia. // "Tun wir alles, was wir tun könnten?" Eine Antwort liegt - nach den genannten Zahlen - nahe: Wir, das heißt Deutschland und auch Europa, tun viel. Aber nicht so viel, wie es selbst manchmal scheint. // Nun hat sich Politik leider nie allein am humanitär Gebotenen zu messen, sondern immer auch am politisch Machbaren. // Das ist ein Satz, der mir schwer über die Lippen geht. Ich möchte es eigentlich anders. Aber wir leben in einem Land, in dem wir es mit Menschen zu tun haben, die ihrerseits mit vielen Begrenzungen leben müssen. Und deshalb richtet Politik ihr Augenmerk eben immer auch auf das Machbare. In diesem Satz steckt so etwas wie eine doppelte Abgrenzung: Abgrenzung gegenüber denen, die wünschen, wir sollten unsere Tore weit aufmachen für alle Mühseligen und Beladenen. Aber auch gegenüber denen, die meinen, die Grenze des Machbaren sei doch längst erreicht und wir müssten uns noch viel besser abschotten als wir es bisher getan haben. // Flüchtlingspolitik wird immer eine schwierige Politik bleiben. Und ich sehe nirgendwo eine Patentlösung. Wir werden nie allen Bedrohten und Verfolgten Zuflucht und Zukunft bieten können. // Der Asylkompromiss von 1993 hat den dramatisch gestiegenen Antragszahlen damals nach dem Ende der Teilung Europas Rechnung getragen, allerdings auf eine bis heute umstrittene Weise. Und ich will nicht verhehlen, in mir klingt eine Feststellung von Burkhard Hirsch aus dem Jahr 2002 nach, die ich als Warnung empfinde: "Die Geschichte des Asylrechts ist auch eine Geschichte der Abwehr von Zuwanderung." // Vielleicht ist es diese Befürchtung, die mich vor einiger Zeit veranlasst hat zu sagen: Wir könnten mehr tun. Wir könnten manches besser tun. Wir müssten es tun in Achtung der Rechte, zu denen wir uns doch verpflichtet haben. Vor allem sollten wir es gemeinsam tun, als Europäer. // Viele Ältere von uns haben selbst noch erlebt, wie Europa ein Kontinent der Flüchtlinge und Vertriebenen war. Dieser Kontinent hat durch eine Geschichte von Gewalt und Kriegen zu den Werten gefunden, auf die wir heute unsere Gemeinschaft in Europa gründen: Menschenrechte und Demokratie, Solidarität und Offenheit - nicht Ängstlichkeit und Abwehr. // In der Flüchtlingspolitik stellt uns das vor ein Dilemma: Einerseits hat die Europäische Union ein legitimes Interesse daran, ihre Außengrenzen zu überwachen und sich vor unkontrollierter Zuwanderung zu schützen. Andererseits muss sie sich fragen lassen, inwieweit sie dadurch die Rechte oder sogar das Leben derer gefährdet, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung Schutz suchen. // Das Jahr ist nun gerade zur Hälfte herum - und schon jetzt sind mehr als 50.000 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeerraum angekommen, mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Darin spiegelt sich auch der bewaffnete Konflikt in Syrien, der zu den anderen, weiter bestehenden Krisenregionen hinzugekommen ist. Ein neuer Konflikt im Irak existiert, wir alle wissen es. // Die wachsende Zahl der Bootsflüchtlinge ist aber auch eine Reaktion auf die zunehmende Abschottung der südöstlichen Landgrenzen der Europäischen Union. Mehr und mehr Fluchtwillige suchen also den Weg, der lebensgefährlich ist, über das Mittelmeer. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten sind vermutlich rund 23.000 Menschen beim Fluchtversuch übers Meer umgekommen. Sie sind verdurstet, ertrunken oder gelten als vermisst. // Und kaum ein Tag vergeht, ohne dass von neuen Flüchtlingen die Rede ist. Auch der heutige nicht. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist heute Morgen eine Nachricht herumgegangen, die uns erschüttert hat: Wieder ist ein Boot mit 30 Toten vor der Küste Siziliens entdeckt worden. // Ich kann mich an solche Nachrichten nicht gewöhnen. Niemand in Europa sollte sich daran gewöhnen. Wir sind doch stolz darauf, dass zwei Dutzend Staaten - darunter solche, die über Jahrhunderte hinweg miteinander im Krieg lagen - ihre Grenzkontrollen untereinander abgeschafft und einen "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" geschaffen haben. Der europäische Gipfel von Tampere, auf dem 1999 über ein gemeinsames Asylsystem verhandelt wurde, war sich übrigens einig: "Es stünde im Widerspruch zu den Traditionen Europas, wenn diese Freiheit den Menschen verweigert würde, die wegen ihrer Lebensumstände aus berechtigten Gründen in unser Gebiet einreisen wollen." So heißt es dort. // Und nun die Bilder der Särge im Hangar des Flughafens von Lampedusa, die Bilder der kletternden Menschen am Stacheldrahtzaun der Exklaven Ceuta oder Melilla - sie passen doch nicht zu dem Bild, das wir Europäer von uns selber haben. // Was können, was müssen wir also tun? // Die Bundesrepublik hat bei ihrer Gründung einen fundamentalen Satz in ihre Verfassung geschrieben: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht" - ein damals noch ganz nahes und ganz uneingeschränktes Echo auf die Leidensgeschichten ungezählter Deutscher, die vor der nationalsozialistischen Diktatur fliehen mussten. Wir sollten uns an Hannah Arendt erinnern, die nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts von Staaten- und Schutzlosigkeit von Menschen das Recht, Rechte zu haben, einforderte. // Sowohl unsere Verfassung als auch die Genfer Flüchtlingskonvention halten uns dazu an, Menschen Zuflucht zu gewähren, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werden. Mögen sich die Gründe für die Flucht in den vergangenen Jahrzehnten auch verändert haben, so bleiben die Kernpunkte der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bis heute gültig. // Für mich gilt daher: Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hat sicherzustellen, dass jeder Flüchtling von seinen Rechten auch Gebrauch machen kann - nicht zurückgewiesen zu werden ohne Anhörung der Fluchtgründe, gegebenenfalls auch Schutz vor Verfolgung zu erhalten. Auch die Hohe See ist kein rechtsfreier Raum, auch dort gelten die Menschenrechte. Dabei beziehe ich mich nicht zuletzt auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. // Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hat also nicht nur die europäischen Grenzen zu schützen, sondern auch Menschenleben an den Grenzen Europas. Solange Asylsuchende nur in Deklarationen, nicht aber in der Realität in allen Mitgliedsländern die gleichen Bedingungen von Schutz und Hilfe erleben, werden sich alle europäischen Regierungen fragen lassen müssen, was sie tun, um die Aufnahme-, Verfahrens- und Anerkennungsstandards auch tatsächlich in allen Ländern anzugleichen. // Und schließlich haben wir unter Europäern die entstehenden Lasten der Solidarität gerechter, transparenter und solidarischer zu teilen. Ich höre mit Interesse, dass Sie hier beim Symposium auch darüber debattieren werden, wie Lösungen aussehen könnten, die etwa Druck von den Grenzländern nehmen könnten und auch darüber, wie wir als Deutsche Teil einer fairen Lastenteilung sein können. // Eines sollten wir nicht tun: einander vorrechnen, was erst der andere tun muss, bevor wir uns selbst bewegen. Denn die Flüchtlinge, die an Italiens oder Maltas Küsten landen, sind nicht allein die Flüchtlinge Maltas oder Italiens. Es sind nicht allein die Flüchtlinge von Lampedusa. Es sind Flüchtlinge, die in unserem Europa Schutz suchen. Sie haben Rechte, die zu achten wir uns als Europäer gemeinsam verpflichtet haben. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung als Europäer, sie menschenwürdig zu behandeln. // Unser Land hat angefangen - etwa mit den Kontingenten für syrische Flüchtlinge -, auch auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, als Teil unserer Verantwortung in der Welt. Die Bürgerkriegsflüchtlinge brauchen vor allem vorübergehenden Schutz, den wir ihnen mit humanitären Aufnahmeprogrammen bieten können. Die meisten von ihnen wollen doch zurück, wenn es nur irgend geht. // Jene Flüchtlinge aber, die nicht zurückkehren können, weil sie sonst verfolgt oder gar getötet würden, oder weil die Gewalt in ihrem Heimatland einfach nicht beendet ist, sie brauchen eine dauerhafte Lebensperspektive im Exil. Gut, dass Deutschland seit zwei Jahren in einem Resettlement-Programm besonders Schutzbedürftige aufnimmt. Wer mit Menschen spricht, die - oft nach quälenden Jahren der Ungewissheit - endlich ankommen können, der weiß, wie sehr man sich wünschen muss, noch mehr von ihnen würden diese Chance erhalten. Es ist gut, dass die Große Koalition bereit ist, das Resettlement-Programm auszubauen. Die Zahlen sprechen für sich: gesucht werden aktuell Plätze für 170.000 Flüchtlinge. Deutschland nimmt derzeit 300 pro Jahr auf, die gesamte EU ungefähr 5.000, dieUSA alleine hingegen mehr als 50.000. // Insgesamt geht es meines Erachtens darum, die Verfahren für die Flüchtlinge gerechter und effektiver zu gestalten. Schnellere Prüfungen, wie sie im Koalitionsvertrag verabredet wurden, bringen, wenn sie fair bleiben, allen Seiten schneller Klarheit. Zu einer effektiveren Flüchtlingspolitik gehört aber auch, dass wir diejenigen auf humane Weise zurückweisen, die nach den gültigen Kriterien keine Fluchtgründe haben, die zur Aufnahme, jedenfalls bei uns in der Bundesrepublik, berechtigen würden. Ich wünsche mir eine Solidarität, die wir auch leben können. // Es ist gut, dass sich in Bereichen, die lange umstritten waren, inzwischen etwas bewegt: bei der Lockerung der Residenzpflicht etwa oder beim Arbeitsverbot für Asylbewerber. Ich habe vor etlicher Zeit das Übergangswohnheim in Bad Belzig besucht. Und dort habe ich gesehen, dass viele, die dort untätig bleiben müssen, darunter leiden, sich nicht selbst ein besseres Leben erarbeiten zu können. Sie müssen einfach sitzen und warten. Das legt sich schwer auf ihr Gemüt. Die allermeisten von ihnen wollen doch keine Almosenempfänger sein. Gut also, wenn die Zeit des Arbeitsverbots gekürzt wird. Schwierig, wenn die bleibenden Beschränkungen weiterhin die Chance auf einen Arbeitsplatz erschweren. // Grundsätzlich sollten wir überlegen, wie mehr Durchlässigkeit zwischen den Zugangswegen "Asyl" und "Arbeitsmigration" geschaffen werden kann. Denn wer einmal vergeblich um Asyl gebeten hat, wird kaum noch durch ein anderes Tor Einlass finden, auch wenn er oder sie Qualifikationen hat, die hierzulande durchaus gebraucht werden. Viele der Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland geschafft haben, sind hochmobil, flexibel, mehrsprachig, leistungs- und risikobereit. // Wir wissen: Die Grenzen sind oft fließend zwischen politisch erzwungener, wirtschaftlich erzwungener oder tatsächlich freiwilliger Migration. Zwar können und wollen wir die Unterscheidung nicht aufgeben, wer schutzbedürftig ist und wer nicht. Das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar. Wohl aber sollten wir - im nationalen wie im europäischen Rahmen - versuchen, unterschiedliche Zuzugsmöglichkeiten vom Studium bis zum Familiennachzug zu gewährleisten. // Erlauben Sie mir eine kleine Abschweifung: Wir sind hier in der Französischen Friedrichstadtkirche, an einem Ort, der - wie auch viele Familiennamen in unserem Land - an eine der berühmtesten Flüchtlingsgruppen der Vergangenheit erinnert: an die Hugenotten. Unser Bundesminister des Inneren hat also einen - ich gebe zu: sehr weit zurückreichenden - Migrationshintergrund. Als seine Vorfahren in diese Gegend kamen, hatten sie eine lange Geschichte von Verfolgung, Bürgerkrieg und Duldungen hinter sich. Damals gab man den Neuankömmlingen die Möglichkeit, sich durch eigene Arbeit einen Platz in der neuen Heimat zu erarbeiten - durchaus zum Vorteil des Aufnahmelandes. Auch daran sollten wir denken in einer Gesellschaft, in der viel über den demografischen Wandel, Bevölkerungsrückgang und drohenden Fachkräftemangel diskutiert wird. // Migration, das haben Studien längst erwiesen, kann ein starker Entwicklungsmotor sein, übrigens auch für die Herkunftsländer. Oder, wie es der berühmte Ökonom John Kenneth Galbraith formulierte: "Migration ist die älteste Maßnahme gegen Armut". Darauf sollten wir bauen, im besten Fall zum allseitigen Nutzen: mit Programmen, die so gestaltet sind, dass sie sowohl den Migranten selbst helfen als auch den Gesellschaften, von denen sie aufgenommen werden - und auf längere Sicht auch den Gemeinschaften und Gesellschaften, die sie verlassen haben. Wir wissen inzwischen zum Beispiel, dass Migranten dreimal so viel Erspartes in ihre Herkunftsländer überweisen wie öffentliche Entwicklungsgelder fließen. Schwerer zu berechnen, aber nicht minder wichtig sind die Kenntnisse und nicht zuletzt die Werte, die sie in ihre Heimat bringen, wenn sie zurückkehren. // "Tun wir wirklich schon alles, was wir tun sollten?" Die Antwort auf diese Frage hängt nicht allein von finanziellen Ressourcen ab oder von politischen Programmen, sondern mindestens ebenso von der Art und Weise, wie ehrlich, pragmatisch und nüchtern die Politik und die Gesellschaft die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik diskutiert. Dabei würde deutlich, dass die Zahlen und Proportionen, die ich eingangs nannte, keineswegs so erschreckend sind, dass unsere Hilfsbereitschaft schon überfordert wäre. Solidarität ist zuerst und vor allem eine Grundlage unseres menschlichen Miteinanders und im Übrigen ist sie Kennzeichen unserer Demokratie. // Diejenigen, die kommen, sind Menschen, die oft Schlimmes erlebt und Unterstützung nötig haben. Ich bin den zivilgesellschaftlichen Organisationen dankbar, auch den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden, den Anwälten, all den Ehrenamtlichen, die sich seit vielen Jahren für humane Verbesserungen in der Asylpolitik einsetzen und sich immer wieder gegen diejenigen wenden, die gegen Zuwanderer hetzen oder gar Brandsätze auf Asylbewerberheime werfen. Bewundernswert ist auch das Engagement vieler Kommunen, der Bürgerinnen und Bürger für die ganz konkreten Bedürfnisse von Flüchtlingen. Viele Gemeinden begreifen diese nicht länger als lästige Gäste auf Zeit, sondern als Menschen, denen - egal, wie lange sie bleiben wollen - Brücken in unsere Gesellschaft gebaut werden müssen, weil das auch im Sinne unserer Gesellschaft ist. Es gibt ungezählte Initiativen, die auf die unterschiedlichste Weise Begegnungen fördern und damit auch das Verständnis für die Situation von Asylsuchenden. // Das macht Mut. Wir wollen doch offen sein und offen bleiben für den Wunsch von Menschen, frei zu sein so wie wir das wollen: frei zu sein von Verfolgung, von Gewalt, von Tod. Wir wollen doch dieser ihrer Sehnsucht folgen und wir können dennoch in unserer Politik geerdet bleiben. Mit Verständnis für die Gründe, die Menschen haben, ihre Heimat zu verlassen. Mit Rücksicht, auch auf die Grenzen der Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft. Aber vor allem mit Weitsicht bezüglich der Chancen von Zuwanderung. Wir müssen es sehen wollen. Und wir sehen all dies im Bewusstsein unserer gemeinsamen Verantwortung als Europäer. // Wir wissen: Es wird nie möglich sein, genug zu tun. Aber wenn wir das uns Mögliche nicht tun, versagen wir nicht nur vor unserem Nächsten, sondern wir verlieren auch die Neigung zu uns selbst, unsere Selbstachtung.
-
Joachim Gauck
Wie sollte man eine Rede an der Universität, die Johann Wolfgang von Goethe im Namen führt, anders beginnen, als mit dem wohl berühmtesten Seufzer der deutschen Literaturgeschichte: "Habe nun ach! Philosophie, / Juristerei und Medizin / Und leider auch Theologie / Durchaus studiert mit heißem Bemüh'n." // Zugegeben, ein ziemlich überraschungsfreier Start in diese Rede. Und wahrscheinlich hätte ich mir das "ach!" verkniffen, wenn nicht vor kurzem in einem Blog der Brief einer Hochschulabsolventin an ihre Universität zu lesen gewesen wäre, der den Monolog des Faust mehr als 200 Jahre später gewissermaßen in unsere Gegenwart übersetzt: // Ich zitiere: "Liebe Uni, ich habe Dich mir anders vorgestellt, jahrelang hatte ich von dir geträumt. Von Diskussionen, von Austausch, von dem Gefühl der Freiheit . Ich hatte mir vorgestellt, wie wir an der Universität wilde Debatten führen. Keynes! Marx! Weber! Liebe Uni, ich dachte Du wärst ein Ort zum Streiten [ ] Diese Leidenschaftslosigkeit war unerträglich " // Nun, es gab natürlich eine Menge leidenschaftlicher Antworten auf diesen vehementen Klagebrief, dem eigentlich nur noch die Faustische Beschwerde fehlte: "Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor". Viele stimmten der Autorin zu, viele widersprachen aber auch und berichteten von guten Erfahrungen mit ihrer Universität, ihrem Studium und ihren Professoren. // Ich hatte an dieser Stelle das Gefühl, wonach sehnt sich wohl diese Schreiberin? - hoffentlich nicht etwa nach den wilden Zeiten von 1970, als eine der merkwürdigen Seiten dieser Universität geschrieben wurde. Auf Vorschlag von Jürgen Habermas sollte der Adorno-Lehrstuhl neu besetzt werden, und man kam auf einen der wohl bedeutendsten Marxismus-Forscher der Zeit, auf Leszek Kolakowski. Aber Kolakowski war gerade von seiner kommunistischen Führung in Polen gemaßregelt worden. Nun passierte das Merkwürdige: An dieser schönen freien Universität gab es linke, linksextreme und marxistische Mehrheiten, die ihn wegen fehlender marxistischer Linientreue abwiesen. Der arme Mann musste dann in die akademische Wüste nach Oxford. Soviel zum Zeitgeist. // Die Universität und ihr Zustand, sie lassen die Gemüter nicht kalt. Und das ist gut so. Denn wenn es um die Bildung kommender Generationen geht, steht immer die Zukunft einer ganzen Gesellschaft auf dem Spiel. Deshalb sollen Universitäten blühen und gedeihen, und zwar zuallererst im Interesse der Studierenden. Hier in Frankfurt sind es 46.000, die durch bestmögliche universitäre Bildung entscheidende Chancen für einen gelingenden Lebensweg erhalten, die aber auch als gut gebildete und gut ausgebildete Absolventen Leistungen erbringen sollen, die dann für die ganze Gesellschaft wertvoll sind. Umgekehrt gilt übrigens das Gleiche: Wenn es um die Zukunft der Universität geht, steht immer auch die Frage zur Debatte, was eine Gesellschaft von ihren Hochschulen erwartet und was sie deshalb bereit ist, für ihre Hochschulen zu tun. Aber dazu kommen wir später. Nur Gutes! // Die Frankfurter Universität, zu deren 100. Geburtstag ich heute von ganzem Herzen gratuliere, sie scheint mir ein gutes Beispiel zu sein, um dieses Wechselspiel zwischen einer Gesellschaft und ihren Hochschulen ein wenig näher zu beleuchten. Diese Universität ist nämlich aus verschiedenen Gründen herausragend: einer davon ist, das wissen wir fast alle oder alle hier im Raum, ihre Entstehungsgeschichte, die sich von anderen Universitäten nun doch deutlich unterscheidet. Zur Gründung der älteren Universitäten in Deutschland führte meist der Wille eines Landesherrn, den Ruhm seines Fürstentums und manchmal auch seinen eigenen zu mehren und die Wirtschaftskraft des Territoriums zu stärken - letzteres durchaus ehrenwerte Motive. // Zur Gründung der Universität Frankfurt vor 100 Jahren aber führte nicht Fürsten-, sondern Bürgerwille. Frankfurts Bürger, zumindest hinreichend viele, waren der Überzeugung, dass höhere Bildung das Beste ist, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Als"Bildungsbürger" ein rundum positiver Begriff war, "Bürger" im vollsten und eigentlichen Sinne nur der gebildete Bürger war, da begriff man in Frankfurt, dass die Gründung einer Universität so etwas wie eine selbstverständliche Bürgerpflicht war. Mit Recht sind deshalb die Frankfurter Universität und mit ihr die Stadt Frankfurt stolz darauf, dass diese Hochschule eine Bürgeruniversität ist. // Eine Bürgeruniversität lebt vom Engagement. Das war und ist hier in Frankfurt in reichem Maße zu finden, weil man weiß, was eine Universität, eine sehr gute und sehr gut ausgestattete Universität einer Stadt und einer Gesellschaft geben kann, in geistiger wie auch in materieller Hinsicht. Zum einen hilft Bildung, die Welt zu verstehen und zu deuten, und damit auch, in der Gemeinschaft freier Bürger miteinander zu leben. Zum anderen aber bietet sie auch schlicht handfeste Vorteile. // Machen wir uns nichts vor: Wissenschaftliche Bildung wurde schon vor 100 Jahren auch als ein Wirtschaftsfaktor verstanden. Und das war auch richtig so, das müssen wir nicht bekritteln. Darüber hinaus war aber auch die Vorstellung lebendig, dass Bildung durch Wissenschaft der Schlüssel zur Entfaltung der Persönlichkeit sei, zum selbständigen Denken, zum Gebrauch des eigenen Verstandes und damit zur Emanzipation, zur Befreiung von alten Autoritäten und von den Zwängen der Natur. // Bildung und Emanzipation, oder anders ausgedrückt, vielleicht umfassender: Bildung und Freiheit gehörten und gehören zusammen. Deshalb finde ich es schön, dass wir heute dieses Gründungsjubiläum hier an dieser Stätte, hier in der Paulskirche feiern, einem der vornehmsten Orte der deutschen Demokratie- und Freiheitsbewegung. // Die Geschichte der Universitäten, die Geschichte auch der Frankfurter Universität, ist ein Teil der europäischen Freiheitsgeschichte und ein Teil der europäischen Wahrheitsgeschichte. // Wahrheit und Freiheit sind Geschwister. So wie Forschung und Lehre Freiheit brauchen, um sich zu entfalten und ungehindert nach Wahrheit zu suchen und zu streben, so ist die politische Freiheit darauf angewiesen, dass die Wahrheit zugelassen, dass um sie gerungen und dass sie unzensiert öffentlich gemacht werden kann. Dass die Wahrheit frei macht, das gilt auch für die Bildung, die uns - gemäß dem berühmten Wort von Immanuel Kant - dazu frei macht, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, ohne die Anleitung eines anderen. // So sind, seit ihrer Erfindung im Mittelalter, Universitäten urbane Orte der Emanzipation. Einer der ersten, die man als Professor fast im modernen Sinne ansprechen kann, ist der Theologe und Philosoph Petrus Abälard. Er entwickelte am Anfang des 12. Jahrhunderts an der jungen Pariser Universität eine wissenschaftliche Methode, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat. // "Sic et non" heißt seine bedeutendste Schrift. Darin wird die Methode der kritischen, wissenschaftlichen Befragung aller Autoritäten erstmals systematisch begründet und durchgeführt. Abälard listet in 158 Abschnitten Widersprüche in den Texten der Kirchenväter auf, die zuvor einfach unhinterfragte und unhinterfragbare Autoritäten waren. Und er zeigt, dass alleine die vernunftgeleitete Interpretation zur Wahrheit führt. Zitat: "Indem wir nämlich zweifeln, gelangen wir zur Untersuchung und durch diese erfassen wir die Wahrheit." // Freiheit von Vorurteilen, kritische Befragung aller Autoritäten, genaue Analyse und Interpretation der Quellen, Vernunft als oberste Instanz: Das ist sozusagen die erste "kritische Theorie" des Abendlandes, und sie bleibt wesensbestimmend für jegliche wissenschaftliche Arbeit, überall bis heute. Dass sie keineswegs leicht durchzusetzen war, zeigt nicht nur, aber auch die Geschichte Abälards, die von Kämpfen, Verurteilungen, Verbannungen geprägt ist. So wird es immer sein: Emanzipation und die Befreiung von Autoritäten, sie werden nie als Geschenk verteilt. Sie müssen immer erkämpft werden. // Die Kontinuität akademischen Denkens, wie es unsere Hochschulen geprägt hat, ist vor allem eine Kontinuität des kritischen Bewusstseins. Was in Paris mit "Sic et non" beginnt, das führt über die großen "Kritiken" des Königsbergers bis zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. // Wir wissen allerdings auch und wir dürfen das auch heute an einem solchen Festtag nicht verschweigen, dass die Universität nicht automatisch und nicht immer die aufgeklärte Stimme der Vernunft gewesen ist. Nicht immer hat der Geist die wichtigste Rolle gespielt und nicht immer die interesselose Suche nach der Wahrheit. Auch der Ungeist, ja, die bewusste Lüge, Rassismus, Antisemitismus sind in Universitäten in Deutschland zu Hause gewesen. Intellektualität, wir wissen es leider, ist noch kein wirksamer Schutz gegen Barbarei. Das ist eine der bitteren Lehren aus den Erfahrungen des Dritten Reiches. Auch die Frankfurter Universität hat sich in diesen finsteren Jahren sehr schnell und sehr gründlich von ihren jüdischen Lehrenden und Lernenden getrennt. "Säuberung" nannte man das damals. Dabei verdankte sie doch ihre Gründung zu einem guten Teil dem jüdischen Bürgertum dieser Stadt. Und ein großer Teil des akademischen Glanzes speiste sich aus den Leistungen der Juden, die hier lehrten. // Aus allen deutschen Städten übrigens verschwanden mit den Juden doch Säulen der Gesellschaft: Philanthropie, kultureller Glanz, wissenschaftliche Exzellenz, auch ein aufgeklärter Patriotismus, Verluste ohne Gleichen. Und dazu die Gejagten und all die getöteten Menschen. Im Bewusstsein dieser Verluste und des verzögernden Erkennens und des Benennens der Schuld, die zu diesen Verlusten führte, hatte nun die Gesellschaft eine große Aufgabe nach dem Krieg. Und hier in Frankfurt hat die Frankfurter Universität nach dem Dritten Reich und nach dem Krieg versucht, an ihre glanzvollen Zeiten anzuknüpfen. Ich stelle mir das äußerst schwierig vor, in diesen Zeiten, in denen äußere und innere Zerstörung das Land prägte. Aber es gelang. Einige Gelehrte sind sogar aus dem Exil zurückgekehrt, um beim geistigen Aufbau eines besseren Deutschlands von Frankfurt aus mitzuhelfen. Jeder kennt noch die Namen von Adorno und Horkheimer, die die Kritische Theorie der Frankfurter Schule entwickelten, die fast zur Überschrift für eine geistige Grundhaltung, ja, für eine wichtige Phase in der Geschichte der jungen Bundesrepublik wurde. All das war eng mit Frankfurt verbunden. // Die Geschichte der Frankfurter Bürgeruniversität ist eine Erfolgsgeschichte. Aber auf Erfolgen kann man sich nicht ausruhen. Jede Zeit stellt die Universitäten vor neue Herausforderungen, aber auch vor neue Chancen. // Die ungeheure Steigerung der Studierendenzahlen seit den 1960er Jahren, damit auch die steigende Zahl von Dozenten und Professoren, all das hat einen anderen Typ von Universität geschaffen, als man sie noch bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts kannte. // Das ist ein beispielloser bildungspolitischer Sprung: Wo früher eine akademische Laufbahn nur einer schmalen Elite eines Jahrgangs vergönnt war, sind es heute mehr als ein Drittel. Der Anteil der jungen Menschen eines Jahrgangs, die ein Studium aufnehmen, stieg seit Anfang der 1950er Jahre von etwa fünf auf etwa fünfzig Prozent. Ich weiß um die damit verbundenen Probleme, die gelegentlich auch zu besprechen sind. Das will ich aber an dieser Stelle nicht tun. Diese Steigerung hat den Charakter der Hochschulen grundlegend verändert, und sie musste natürlich auch gestaltet und sie musste finanziert werden. Um die Frage der Hochschulfinanzierung wird bis heute gerungen. Viele Dozenten und Professoren klagen, dass sie sich angesichts der Fülle der Aufgaben vom Kern ihrer Profession, von Forschung und Lehre, entfernen, ja, manchmal entfernen müssen. Es galt und gilt also, eine neue Balance zu finden zwischen Forschung und Lehre, zwischen Spitze und Breite. // Eine Herausforderung, die die Gründer der Frankfurter Universität vor 100 Jahren ebenfalls noch nicht in dieser Deutlichkeit vor Augen hatten, war der Beitrag, den Bildung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum sozialen Aufstieg jeder und jedes Einzelnen leisten kann und soll. Jetzt fällt mein Blick auf unsere Gesellschaft, wie sie sich heute darstellt. Wir leben heute in einer Einwanderungsgesellschaft. Mehr als ein Drittel der in Deutschland lebenden unter Fünfjährigen verfügt über einen Migrationshintergrund. Das gesamte Bildungssystem muss - sollte ich sagen: müsste - sich dieser Aufgabe stellen. Es gibt inzwischen viele Initiativen, die diese Herausforderung angenommen haben. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit stand ich hier an derselben Stelle, um die Teilnehmer der Start-Stipendien-Initiative zu begrüßen und zu beglückwünschen. Eine große deutsche Stiftung hat der Tatsache Rechnung getragen, dass wir eine besondere Förderung dieser Gruppe von Auszubildenden brauchen, die - mit einem Migrationshintergrund ausgestattet - nicht dieselben Startmöglichkeiten haben wie Kinder aus dem deutschen Bildungsbürgertum. Wir müssen verstehen, dieser Realität von Einwanderung gerecht zu werden, sie als praktische Aufgabe zu sehen. Und ich bin dankbar für die Initiativen und die Personen, die sich hier auf diesem Feld engagieren, Hilfe in der Sprachförderung oder durch kulturelle Beiträge. Im Sport haben wir inzwischen gelernt, dass jedes Talent Förderung verdient und dass diese Förderung alle bereichert. Die gleiche Einsicht wünsche ich mir auch in der Bildung und in der Wissenschaft: von der Kita über die Schule bis zur Universität. An jeder dieser Stationen können wir noch viel mehr tun, um allen jungen Menschen in diesem Land ein gelingendes Leben zu ermöglichen. // Nach meinem Verständnis kann und muss die Universität eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft spielen, vielleicht sogar eine aktivere Rolle als gegenwärtig schon üblich. Ausländische Studierende und junge Menschen mit Migrationsgeschichte brauchen Hilfe. In manchen Fällen ist finanzielle Unterstützung notwendig, etwa durch spezielle Stipendienprogramme. Am wichtigsten aber sind Vorbilder und Ermutigung, und zwar schon lange vor der Immatrikulation. Es darf nicht sein, dass die Herkunft eines Menschen - sei es die soziale oder die ethnisch-kulturelle - darüber entscheidet, welche Zukunft dieser Mensch hat! Der Schlüssel, um solche Herkunftsbarrieren zu überwinden, der heißt Bildung. Die Geschichte von Bildung als Emanzipation, sie geht also weiter. Und sie muss weitergehen. // Ist die alte "Bürgeruniversität" auch diesen neuen Herausforderungen gewachsen? Hier in Frankfurt haben Sie eine klare Antwort auf diese Frage gefunden. Sie haben das Prinzip der Bürgeruniversität neu für sich entdeckt, Sie haben sich ganz bewusst zu Ihren Wurzeln bekannt. Denn seit 2008 ist die Goethe-Universität wieder Stiftungsuniversität. Das Modell soll dazu dienen, Hochschulen und Bürgergesellschaft stärker zu verbinden. Es eröffnet großherzigen und weitblickenden Stiftern und Förderern die Möglichkeit, Verantwortung für die Universität zu übernehmen. Der Umbau zur Stiftungshochschule stärkt die Eigenverantwortung der Institution. Die Stiftungshochschule kann zugleich ein Wir-Gefühl und eine Identität entwickeln, die Lehrende und Lernende verbindet und eine starke Verbindung zum gesellschaftlichen Umfeld herstellt. // Es zeigt sich immer wieder: Bildung und wissenschaftliche Spitzenleistung brauchen so eine förderliche Umgebung. In Frankfurt gibt es dieses bildungsfreundliche Umfeld. Kooperation und Austausch sind damit wesentliche Erfolgsfaktoren dieser Universität, die sich nie als Elfenbeinturm, sondern immer als bürgerschaftliches Forum begriffen hat. Auch dazu kann man heute wahrlich gratulieren. // Eines will ich aber an dieser Stelle auch deutlich sagen: Das Lob der Förderer und der Stifter und der Ruf nach weiterem bürgerschaftlichen Engagement für gute Bildung darf keineswegs dazu führen, dass der Staat sich aus seiner Verantwortung im Bildungswesen zurückzieht. Stifter sind keine Ausfallbürgen in Zeiten knapper Kassen - sie schaffen einen Mehrwert. // Es ist darüber hinaus richtig und wichtig, an neue Mittel und Wege zu denken, um Kräfte zu bündeln. So überlegen richtigerweise Bund und Länder seit der vergangenen Legislaturperiode, wie sie den Bildungsföderalismus fortentwickeln können, um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen. Das wird am Ende allen nutzen: den Studierenden, die attraktive Studienbedingungen vorfinden, den Hochschulen, die ihre Stärken weiter ausbauen können, und unserem Land als Wissenschaftsnation. // Die Konzentration der Kräfte ist auch deshalb wichtig, weil gute Hochschulen heute in einem weltweiten Wettbewerb stehen. In diesem Wettbewerb wird der Frankfurter Universität ihre Besonderheit als Bürgeruniversität, aber auch die öffentliche Unterstützung, zugute kommen. // Europa, so hat neulich der indische Autor Pankaj Mishra geschrieben, habe seine Leuchtkraft verloren. Es habe früher mit seiner kulturellen und intellektuellen Kraft Vertrauen in die Allgemeingültigkeit seiner Erfahrungen und Lösungen erzeugt. Und dieses Vertrauen sei nun heute verlorengegangen. // Ich teile bei weitem nicht alles, was dieser Autor ausführt. Eines aber, was er sagt, halte ich doch für so wichtig, um es hier vorzutragen: Europa, so schreibt er, müsse die eigene kritische und kosmopolitische Tradition wiederbeleben, es brauche Offenheit, Widerspruch und kein homogenes Weltbild. // Wozu uns ein indischer Autor hiermit aufruft, ist doch nichts weiter als die alte und ewig junge Beschreibung von Aufgabe und Wesen der europäischen Universität, die in ihren guten Zeiten immer weltoffen war und die immer bereit war, auch fremde Erfahrungen aufzunehmen. Gehen wir also ans Werk. Gehen wir daran, diese, unsere europäische Universität wieder so lebendig werden zu lassen, dass es intellektuell gleichermaßen Herausforderung und Freude ist, an ihr zu lehren und zu lernen. // Enden wir, wie wir begonnen haben, mit Goethe: Als er im Alter von 16 Jahren daran ging, ein Studium aufzunehmen, gab es diese Frankfurter Universität noch nicht. So ging er nach Leipzig. Von dort schrieb er am 13. Oktober 1765 an seinen Vater: // "Sie können nicht glauben, was es eine schöne Sache um einen Professor ist. Ich bin ganz entzückt gewesen, da ich einige von diesen Leuten in ihrer Herrlichkeit sah!" Das waren noch Zeiten: Professoren in ihrer Herrlichkeit! Das ist irgendwie endgültig passé. Aber könnte es nicht möglich sein, die Universität als Ganzes, als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, von Stiftern, Förderern und Bildungspolitikern zu einer neuen Herrlichkeit zu führen? Ich wüsste nicht, was ich dieser Goethe-Universität zu Frankfurt am heutigen Tage besseres wünschen könnte.
-
Joachim Gauck
Wir feiern heute Abend eine der schönsten Transformationsgeschichten, die unser Land zu erzählen hat. Das Deutschlandradio ist ja nicht nur ein "Kind der Einheit", sondern es ist noch viel mehr. Gewiss ist dieser Sender - mit seinen heute drei Programmen - vor allem ein Produkt der Einheit. Aber gleichzeitig war und ist er aber auch ein Motor der Einheit. Er hat die Überwindung der Teilung begleitet, reflektiert und kommentiert. Und schließlich war das Deutschlandradio auch ein Labor der Einheit. Wie in nur wenigen anderen Institutionen haben hier Menschen mit Ost- und Westbiografien - ganz unterschiedlichen Ost- und Westbiografien übrigens - zusammen etwas Neues geschaffen. // Heute spiegelt das Deutschlandradio mit seinen Hörfunkprogrammen unser geeintes Deutschland in einem größer gewordenen Europa, in einer Welt, die sich beständig verändert. Darum bin ich gern zu Ihnen gekommen! // Es war keine leichte Geburt, damals, vor 20 Jahren. Es waren heikle Fragen zu klären. Etwa: Was soll mit dem Erbe der Hörfunksender der DDR geschehen, die als Instrumente sozialistischer Propaganda diskreditiert waren? Oder: Was tun mit RIAS und Deutschlandfunk, die mit der Vereinigung unseres Landes ihre ursprüngliche Bestimmung verloren hatten? Oder: Wie verfahren mit den Klangkörpern der Sender, das Bläserensemble des DSO haben wir gerade gehört. Die Konflikte von damals kennen viele von Ihnen natürlich weit besser als ich - Sie waren dabei. Ich will das auch nicht alles im Einzelnen nachzeichnen, das kann ich gar nicht, nur so viel will ich andeuten: Es gab auch mächtig Streit unter den Hebammen, jede hätte das Kind gern allein auf die Welt begleitet. // Am Ende stand eine bis heute einzigartige Konstruktion, die unseren Ehrengästen aus dem Ausland, von BBC und Radio France, vermutlich merkwürdig erscheint: Die ARD, das ZDF und alle 16 Bundesländer wurden per Staatsvertrag gemeinsam Träger von zwei Hörfunksendern unter einem Dach, mit Programmauftrag für ganz Deutschland. // Mindestens ebenso bemerkenswert wie das Kind aber waren die Eltern: Es gab ja deren gleich drei - und jedes Elternteil stand seinerseits für ein Stück deutscher Zeitgeschichte. // Dem Deutschlandfunk bin ich bis heute - wie übrigens viele aus dem Osten - von Herzen dankbar. Er war die bundesdeutsche Antwort auf den Deutschlandsender der DDR und hat - wie wenige andere Institutionen - die Verbindung zwischen Ost und West gehalten, als manche Landsleute im Westen schon nichts mehr über die DDR hören wollten. Der Deutschlandfunk folgte diesem Zeitgeist nicht. "Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden" - diesem Auftrag aus der Präambel des Grundgesetzes fühlte er sich stets verpflichtet. Zugleich aber hat er auch den Blick nach Europa und in die Welt geweitet. // Der Deutschlandfunk sei "Frequenz gewordene Zuverlässigkeit", schrieb die "taz" vor zwei Jahren zum 50. Geburtstag, "so etwas wie der Bundespräsident unter den Radiosendern: politisch engagiert, aber neutral und auf die großen Zusammenhänge bedacht". Das will ich nun nicht kommentieren, nur so viel: In ganz Deutschland - übrigens gerade auch in jenen Regionen, die früher in der DDR als "Tal der Ahnungslosen" bezeichnet wurden - danken es die Hörerinnen und Hörer bis heute mit großer Treue. // Auch der RIAS spielt in meinen Erinnerungen eine wichtige Rolle, eine frühe sogar. Denn damals habe ich dort Ernst Reuter gehört, als Jugendlicher. Ich habe gehört, wie er die Freiheit dieser Stadt beschworen hat, in schwierigen Zeiten. Und in den Tagen um den 17. Juni 1953 hing ich, der 13-Jährige, am Radio und hörte gebannt - wenn das Programm nicht gerade gestört wurde -, was auf den Straßen in Berlin passierte. Der Klang der Freiheitsglocke, bis zuletzt ein Markenzeichen im RIAS, hat sich mir tief eingeprägt - wie schön, dass diese Tradition bis heute fortgeführt wird! // Das dritte Elternteil nun, der Deutschlandsender Kultur, war seinerseits ein Kind der friedlichen Revolution und mit der bin ich nun einmal sehr tief verbunden. Er hatte nach dem Mauerfall Teile des ehemaligen Staatsrundfunks der DDR beerbt und dank der Unterstützung des"Runden Tisches" den 3. Oktober 1990 überlebt. In ihm spiegelt sich der Enthusiasmus der neu gewonnenen Freiheit, auch die Lust aufs Experiment. // RIAS und DS Kultur, diese scheinbar grundverschiedenen Programme aus Ost und West, zum Deutschlandradio Berlin zu vereinen, das war wahrlich eine Herausforderung, ja eigentlich ein Wagnis. Aber war es nicht bei genauem Hinsehen genauso mit der Herstellung der Deutschen Einheit? Und so, wie die Deutsche Einheit im Großen gelang, so gelang auch im Deutschlandradio Berlin die "Einheit im Kleinen": mit Euphorie und Aufbruchstimmung, aber auch mit einer gehörigen Portion Veränderungsskepsis und auch mit mancher Enttäuschung. Es gab Besitzstandsdenken und gegenseitiges Misstrauen - hier einstiger "Klassenfeind", dort Mitarbeiter des Staatsrundfunks. Aber genauso gab es auch Hilfsbereitschaft und Offenheit für das Neue. // Dieser Festakt ist ein schöner Anlass, all jenen "Danke" zu sagen, die damals unvoreingenommen aufeinander zugegangen sind. Die erst einmal gefragt haben: Was ist das für ein Mensch? Oder: Wie finden wir zusammen? Danke an all diejenigen, die gesagt haben: Wie spannend diese Zeiten sind, welch ein Glück, sie gemeinsam gestalten zu dürfen! Die nicht dem Alten nachgetrauert haben, oder auch dem verlorenen Zauber des Übergangs. Es war wichtig und es war wertvoll für das Zusammenwachsen, dass hier an dieser Stelle nicht einfach "abgewickelt" wurde, sondern Ost- und Westdeutsche gemeinsam etwas entwickelt haben, journalistische Standpunkte und Formate nämlich. // So wurde am Berliner Standort die neue Hauptstadt publizistisch vorbereitet, bevor noch Parlament und Regierung vom Rhein an die Spree kamen. So spiegelt sich im Deutschlandradio, worüber wir uns freuen und worauf wir mit Stolz blicken dürfen - das Glück der Wiedervereinigung, die unsere Nachbarn in je eigener Weise unterstützten und die dann in das Zusammenwirken unseres Kontinents einmündete. // Nun ist das Kind der Deutschen Einheit längst volljährig. Im Herbst feiern wir den 25. Jahrestag der großen Demonstrationen des Bürgermuts im Osten und den darauf folgenden Mauerfall. Heute sortiert hoffentlich niemand mehr im Deutschlandradio nach "Ossis" und "Wessis". Doch der Programmauftrag seiner Sender bleibt bestehen: die Deutschen, die politisch wie regional so unterschiedlich geprägt sind, miteinander zu verbinden. Und das in einem aufgeklärten nationalen Diskurs, wie in einer Vermittlung der verschiedenen kulturellen Traditionen. // Wir sind froh über Deutschlands eigenständige und selbstbewusste Länder. Bei uns, das wissen wir lange, ist kulturell nirgendwo "Provinz". Gerade deshalb braucht unser Land beides: Programme, die regionale Identitäten wiederspiegeln und stärken. Und Programme, die föderale Vielfalt bündeln und hörbar machen, mit Korrespondenten in Schwerin und Stuttgart, in München und Magdeburg. // Unser Land ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zusammengewachsen, sondern es ist zugleich erwachsener geworden. Es ist nicht mehr so viel mit sich selbst beschäftigt, sondern schaut mehr und mehr nach draußen, nach Europa und in die Welt. Auch darum brauchen wir ein nationales Hörfunkangebot, das über Ereignisse in Algier und Ankara, in Kiew und Kopenhagen informiert und seinerseits Deutschlands Stimme im Ausland prägt. // Wer heute die Vielfalt unserer Hörfunklandschaft, zu der die Programme des Deutschlandradios gehören, mit fremden Ohren zu hören versucht, der kann keinen Zweifel daran haben, wie wertvoll eine öffentlich-rechtliche, aber dennoch staatsferne Säule unseres dualen Rundfunksystems ist. Die Rundfunkfreiheit des Grundgesetzes gewährleistet deshalb eine Medienlandschaft, die an Vielfalt ausgerichtet ist und eine politische Instrumentalisierung des Rundfunks verhindert. Für die heute gefeierten Programme bedeutet diese grundgesetzliche Gewährleistung: Was für ein Privileg, bundesweit und werbefrei senden zu dürfen! Welch ein Privileg, nicht auf Quote schielen zu müssen! Welch ein Privileg, noch in ganzen Sätzen Radio machen zu dürfen! // Wie alle Privilegien sind auch diese unter scharfer Beobachtung all jener, die sie nicht genießen, und auch derjenigen, die dafür bezahlen. Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren, besteht darum auch darin, diesen Zustand, in dem Sie sich befinden, kontinuierlich zu begründen. Verlangt sind bisweilen Gratwanderungen: innovativ zu sein und neue Technologien zu nutzen - nicht aber um den Preis der Qualitätsminderung. Themen abseits vom Meinungshauptstrom zu finden - ohne dabei in einer Nische zu versickern. Komplexe Zusammenhänge auch komplex darzustellen - aber nicht zum Umschalten zu verleiten. Und wie wichtig Verantwortungsbewusstsein im Journalismus ist, das sehen wir gerade in Zeiten, in denen manche Medien zu Empörungsverstärkern mutieren, die Urteile fällen, bevor ein Sachverhalt überhaupt geklärt ist. // Die Preise, die Ihre Programme und Ihre Macherinnen und Macher in den letzten Jahren bekommen haben, zeigen: Sie werden Ihrer Verantwortung gerecht. Einen ganz frischen Preisträger haben Sie heute Abend mit der Moderation beauftragt - Kompliment, lieber Herr Scheck! // Es gäbe noch vieles zu sagen. Zu den irrwitzigen Veränderungen, die gerade die Art und Weise der menschlichen Kommunikation revolutionieren. Denken wir mal zurück: Im Jahr des Mauerfalls schrieb ein gewisser Tim Berners-Lee am Kernforschungszentrum CERN ein Papier mit dem lapidaren Titel "Informations-Management - Ein Vorschlag". Heute ist die Welt ohne seine Erfindung, das World Wide Web, kaum noch vorstellbar - und der Globus, den hier, oben auf dem Dach dieses Gebäudes, die Giganten stemmen, bekommt eine ganz neue Bedeutung. // So unmittelbar wie das Radio heute, können auch andere Medien sein. Was bleibt, ist das Bedürfnis nach verlässlicher Information, nach verständlicher Einordnung, nach Orientierung in einer Gegenwart, die viele doch als immer unübersichtlicher empfinden. Und genau dies ist ein ungeheuer wichtiger Auftrag. Denn unsere Demokratie ruht auf der Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich in der Unübersichtlichkeit nicht zu verlieren oder zu verirren, sondern sich eine eigene Meinung bilden zu können. // Dem Deutschlandradio, seinen Programmen und allen Verantwortlichen sage ich sowohl als Hörer als auch als Präsident: herzlichen Dank! Sie haben uns in den vergangenen 20 Jahren durch allen Wandel hindurch zuverlässig begleitet. Sie haben mit Verantwortungsbereitschaft Veränderung gewagt. Ich wünsche Ihnen den Mut, sich weiter zu wandeln, wenn es notwendig ist und die Weisheit zu erkennen, wann das notwendig ist. Und damit alles Gute für die kommenden Jahre!
-
Khalil Gibran
Die Unterwürfigkeit ist ein Schleier, der die Gesichtszüge des Stolzes verbirgt - und die Anklage ist eine Maske, die das Gesicht des Unglücklichen bedeckt.
-
André Gide
Leute, die darauf stolz sind, daß sie hart arbeiten, mag ich nicht. Wenn ihre Arbeit sie so hart ankommt, sollten sie sich eine andere suchen. Die Freude an unserer Arbeit ist das Zeichen, daß sie zu uns paßt.
-
Jean Giraudoux
Der große Mann ist gewöhnlich ein Knoten im Taschentuch der Menschheit, der sie an die Unruhe, die Verachtung, den Stolz und an die Phantasie erinnern soll.
-
Maxim Gorki
Der ganze Stolz der Welt ist das Werk der Mütter.
-
Stephanie Graf
Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Wahl, wenn man weiß, wie hoch der Stellenwert des Wintersports in Österreich ist. Ich sehe meinen Erfolg auch als einen des Sommersports.
-
Franz Grillparzer
Stolz gegen Stolz, wie Kiesel gegen Stahl, erzeugt, was beiden feind, den Feuerstrahl.
-
Jacob Grimm
Wer nach jahrelangem Auswandern wieder den Boden seiner Heimat betritt, die mütterliche Erde küßt, in wessen Ohr die altgewohnten Laute dringen, der fühlt, was er entbehrt hatte und wie ganz er wieder geworden ist. Allen edlen Völkern ist darum ihre Sprache höchster Stolz und Hort gewesen.
-
Anastasius Grün
In der Welt fährst du am besten, sprichst du stolz mit stolzen Gästen, mit bescheidenen bescheiden, aber klar und wahr zu beiden.
-
Karl Gutzkow
Der wahre Stolz ergreift für sich nicht selbst das Wort.
-
Hans Habe
Nur Stolz schützt vor Neid.
-
Hans Hauenstein
Man soll seine Ahnen ehren, ja man soll stolz auf sie sein. Trotzdem muß man über die Vergangenheit hinwegschreiten, um in der Gegenwart bestehen zu können, denn wer mit den Erfolgen seiner Ahnen protzt, beweist damit nur, daß er keine eigenen aufzuweisen hat.
-
Hans Hauenstein
Selbstbewußtsein ist der mit Eitelkeit vermengte Stolz auf das eigene Ich, der sich leider nur allzu oft in Hochmut verwandelt.
-
Hans Hauenstein
Wenn ein Mann eifersüchtig ist, dann nur deshalb, weil sein aufbäumender Stolz es nicht zuläßt, betrogen zu werden. Wenn eine Frau eifersüchtig ist, dann nur deshalb, weil sie sich entrüstet, eine andere sei hübscher als sie.